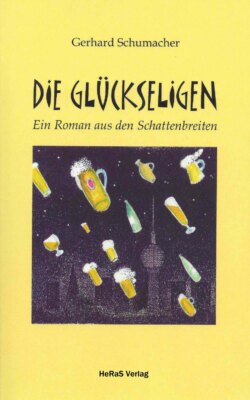Читать книгу Die Glückseligen - Gerhard Schumacher - Страница 6
unus: adventus et ientaculum Eins: Ankunft und Frühstück
ОглавлениеIn dieser schwurbeligen Zeit, Anfang der neunziger Jahre, des Oktobers Dritter war schon zum bedenklichen Tag befördert, fuhr ich mit der Eisenbahn, von Hannover kommend, über das verkackte Magdeburg auf abenteuerlich schlackernden Geleisen gemächlichen Tempos an grauer Dörfer Mauern vorbei Richtung künftiger, mit ausreichender Mehrheit beschlossener Hauptstadt.
Die Fahrt gestaltete sich durchaus nicht angenehm noch komfortabel, die Mitropa war mit altbekannter Kundenfeindlichkeit und ebenso erprobtem Personal noch voll in Fahrt und alles rappelte, klackerte, schuckelte, stank lysolig und dauerte zum was weiß ich wessen Erbarmen lang.
»Warum gerade ich?«, fragte ich beim düsteren Blick auf Schwarz-Weiß-Landschaften mitten im Sommer, die Kraft Kanzlerwort einmal bunte, sprich: blühende werden sollten? Warum gerade ich? Weil du es so gewollt hast, raunte mir der Gepäckträger zu, oder die Hutablage, oder der dreckige Aschenbecher, oder alle zusammen im Chor, weil dich keiner gezwungen hat, in das verschnarchte Hannover zu fahren, dort zwei Tage rumzuhängen und zum Dornen krönenden Abschluss noch mit der Reichsbahn, ehrlich, so hieß das damals, heimzukehren. Keiner hat dich gezwungen, es war dein ureigenster Entschluss. Und dafür musst du leiden. Aber wie.
Und ich litt.
Es war weniger der tumbe Kellner mit seiner befleckten Jacke und dem taumeligen, immerhin, Bemühen zwischen schnoddrigem Desinteresse und neu gefordertem Dienstleistungseifer einen für ihn gangbaren Mittelweg zu finden, der mit lässiger Handbewegung und sächsisch eingefärbten Amerikanismen das pisswarme Radeberger auf den fahrbewegten Tisch knallte, auch nicht der beißende Gestank nach Toilettensteinen aus dem Klo, der immer dann mich umwaberte, wenn die Milchglas bestückte Tür des Speise(hä,hä)wagens sich fully automatically öffnete, sobald jemand unverständlicherweise Einlass begehrte, unter denen ich leiden musste.
Es war vielmehr die Lektüre der dörflichen Hauptstadttageszeitung, die ich in Ermangelung anderen Lesestoffs, die mitgeführte Reiselektüre hatte ich im niedersächsischen Metropolis im Suff verloren oder gar versetzt, was weiß ich, auf Hannovers Hauptbahnhof erstanden hatte und die kaum dazu angetan war, des Reisenden Herz zu erquicken, noch ihn der Kurzweil zu überantworten.
Nun denn, so geht es. Ein Fehler, der mindestens drei Stunden lang nicht zu korrigieren ist, weil man trotz des maroden Schienenstrangs (wie, stellt sich bei dem Gerumpel die Frage, wollte der Sozialismus eigentlich darauf vorwärtskommen? Und wenn nicht darauf, worauf sonst?) und dem dadurch bedingten mäßigen Tempo nicht abspringen kann. Es hätte auch nichts genutzt, das Abspringen, denn in den, ich sag´ mal wohlwollend: Ortschaften, die der Zug durchschlich, gab es zwar jede Menge umfallorientierter Schornsteine und windanfälliger Rinderbaracken, von holzwurmigen Schweinekoben nicht zu reden, aber mit Sicherheit keinen Zeitungskiosk. Und wenn doch, dann keinen, der etwas wirklich Lesbares zum Kauf anbot. Aber das tat der Kiosk auf dem Hauptbahnhof in Hannover eigentlich auch nicht. Oder ich habe das Falsche gewählt. Wovon man ausgehen kann, denn ich habe mein ganzes Leben lang das Falsche gewählt. Oder das Richtige. Kommt drauf an, von welcher Seite man es sieht.
Immer, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Das Lichtlein, das mein trauriges Dasein im vormaligen Interzonenzug schlagartig erleuchtete, in gleißende, Spot an, Helligkeit tauchte und das Gemüt mit aller Unbill der vergangenen Tage versöhnte, fand sich im Anzeigenteil besagter Tageszeitung, genauer gesagt, in der im unteren Teil der Todesanzeigen (sic!) eingerückten Rubrik „Ärzte“. Und es war wunderschön, gerahmt und doppelnamig. Aber das zuhauf.
Christine Jurk-Knallfass zum Beispiel teilt schwarz auf weiß und wahrscheinlich allen Ernstes mit, ihre Praxis demnächst an Mirjam Klein-Ballwenge zu übergeben und macht, quasi nebenbei und in einem Abwasch, für allerlei von ihr praktizierten medizinischen Zauberkram und sonstiges Beschwörungs- und Besprechungsgedöns Reklame. Na bitte, das war doch schon mal ein gelungener Auftakt, der Interessierte, wie mich zum Weiterlesen animierte. Zwischen annoncetechnischem Mittelmaß ohne pornografische Doppelnamen stand dann allerdings die absolute Knalleranzeige, für die sogar ein Jahres-, nun, bleiben wir auf dem Teppich, mindestens aber ein Halbjahresabonnement dieses verbröselten Blattes ohne Weiteres zu rechtfertigen wäre.
Die Anzeige selbst war in geschicktem Understatement schlicht gehalten, schwarz gerandet, nur mäßigen Umfangs und in zwei Bereiche geteilt. Im ersten, oberen Teil verkündete ein anspruchsloser Einzelname, aus Altersgründen die gemeinsame Praxis zu verlassen und diese verlassene Praxis nun ganz alleine, voll und ganz, ohne Wenn und Aber, geschweige denn Widerspruch, ihrer bisherigen Partnerin (oder sagt man Compagneuse?) zu überlassen. Und dann kam, fett gedruckt, oh holde Melodei wie süßer Glocken Klang, der alles verzeihende, alles beschreiende, nicht zu überbietende Rexysexisupername der sicherlich überglücklich durchgenässten Socia:
Susi Bürstmann-Pümpel.
Hat man so was Schönes je gesehen, gelesen, und wenn ja: wo? Es war wie Donnerknall und –fall, wie wetterleuchtende Kopulation am weißen Strand im warmen Gewitterregen bei subtropischem Feuerwerk und einem nie enden wollenden Orgasmenstakkato, es war wie das Öffnen der aladinschen Wunderlampe, es war schlicht Balsam auf die mitropageschundene Seele.
Flugs orderte ich bei dem vorbeischlafenden Kellner ein neues Fläschchen Radeberger und als verdiente Zugabe einen doppelten Wilthener Weinbrand. Im Glas, wenn gerade eins frei sei.
Natürlich entzieht es sich (Gott sei Dank) meiner Kenntnis, wer von den beiden mit Bindestrich Zusammengefügten wen zuerst gebürstet respektive gepümpelt oder zum Bürsten respektive Pümpeln überredet oder mit sonst welchen Mitteln bürsten- oder pümpelmäßig flachgelegt hat.
(Flott stochert Pümpels Dideldum in Susi Bürstmanns Bürste rum! Ach Kindermund, wie bist du doch weise und erfrischend.)
Das spielt eigentlich auch nicht die große Rolle. Tatsache ist und bleibt doch, dass zwei Individuen mit strotzdummen Nachnamen, zugegeben, dafür kann keiner wirklich was, nicht die Chance genutzt haben, bei ihrer Heirat wenigstens einen davon elegant loszuwerden. Nein, stattdessen haben sie den Horror durch Vereinigung nebst Bindestrich noch potenziert, die Verbrecher.
Gerade so, wie es die Regierenden mit diesem unserem Land taten. Jedes für sich war schon schlimm genug, aber beide zusammen? Nicht auszudenken.
Zur Blödheit der schwartigen Zusammenfüger kommt natürlich noch die Oberblödheit der elterlichen Erzeuger von Bürstmann und Pümpel junior. Wer, der schon mit dem Namen Bürstmann geschlagen und dennoch einigermaßen bei Sinnen ist, (oder schließt sich das aus?), nennt das vermutlich pausbäckige Töchterlein auch noch Susi? In toto: Susi Bürstmann. Da ist ja, verhext, verhext, Bibi Blocksberg noch besser dran. Bei diesem defekten Namen scheint eine größere Karambolage auf dem weiteren Lebensweg in persona eines Partners mit mindestens gleichwertig bescheuerter Benennung, z. B. Pümpel, geradezu programmiert. Ich weiß zum Glück nicht, wie der Herr Pümpel mit erstem Vornamen gerufen wird, könnte mir aber Maik (mit ai, wohlgemerkt), Paul oder, besser: Percy gut vorstellen. Percy Pümpel. Das hat was.
Bist du, Susi Bürstmann bereit, den hier anwesenden Percy Pümpel zu deinem dir angetrauten Gatten … in guten wie in schlechten Zeiten … und so weiter, laber laber?
Den Saal verlassen Frau Susi Bürstmann-Pümpel nebst Gatten Percy Pümpel. Die Kakophonie des auditiven Grauens Arm in Arm mit der abgründigsten Verbalität, die man sich denken kann. In Stereo, Quadro und was es sonst so gibt. (Subwoofer? Bin auch ich berufen? Es möge bitte an der Endstufe hapern.)
Dass nicht der Susi Bürste nach Percys Pümpel dürste.
Jetzt ist es aber genug, Kindermund, stillgestanden. Spötter, die ihr seid, unschuldigen aber treffsicheren Auges.
Es läuft schon einiges schief mit den Genen, aber gewaltig, Damen und Herren (der Wilthener Weinbrand, doppelt, im Glas, zeigte erste Wirkung). But nobody is perfect. Gell, Frau Leutheusser-Schnarrenberger? Oder wie?
Der stressgeplagte sächsisch-amerikanophile Mitropakellner weigert sich, eine erneute Bestellung meinerseits zur Kenntnis zu nehmen, mit mir überhaupt in Blickkontakt zu treten und hat es sich am äußersten Ende des Waggons in einer Nische bequem eingerichtet. Auch dezente erst, dann kräftigere, schließlich lautstarke Zurufe ignoriert er standhaft, obwohl er sie trotz Schienengeklapper nicht überhören kann, denn ich bin der einzige, alleinige Gast, wenn die Bezeichnung denn zutrifft, im Speise- (noch mal: hä, hä) wagen.
Doch das sind Traditionen, gegen die unsereins nicht ankommen kann, weil sie gepflegt werden über Generationen hinweg, vom Großvater weitergegeben an den Sohn, von dem wiederum an seinen Sohn und so weiter, bis alle Mitropakellner abgeschafft werden und es nichts mehr weiterzugeben gibt. Doch solange wollte ich nicht warten.
Als auch wildestes Armgefuchtel nichts ändert, muss ich ein neuerliches Bier nebst Weinbrand aus Wilthen zur Feier der Bürstmann-Pümpelschen Verbalinjurie auf einen späteren Zeitpunkt verschieben und ergebe mich diesem Schicksal erstaunlich klaglos. So denn alles gut geht, wartet in etwa zehn Minuten am Perron des Bahnhofs Zoologischer Garten mein Aushilfsschwager Wenzel Wiener, mich abzuholen und nach Hause zu geleiten, auf dass es mir wieder wohlergehe nach meiner Rückkehr aus der niedersächsischen Provinz in das noch provinziellere Hauptstadtdorf, inmitten Sumpf und Sandbergen gelegen, von denen der Rote Adler hoch und immer höher steigen möge, dunkle Kiefernwälder von oben mit seinem rückwärtig versprühten Dünger zu bedecken, auf dass es dem Brandenburger Land zum Heil genüge, mit Stumpf, Stiel und Stolpe noch einmal.
Und der penetrant negierende Mitropaknecht kann mich mal, aber nach Strich und Faden, dieser Überbringer warmer Biere. Das Trinkgeld hau ich lieber selbst auf den Kopf. Jawoll.
Das Quietschen der Bremsen kündet von der Freude der Räder, die Qual der Interzonenstrecke einigermaßen heil überstanden zu haben, zeigt aber auch Erschöpfung und Ermüdung an. Wir sind durch Deutschland gefahren. Jedenfalls durch einen Teil, den grauen. Einfahrt in den Bahnhof, Schluss, Aus, Ende einer Dienstfahrt. Glücklich träumt das Gefährt sich ins Depot.
Der Ersatzschwager ist nicht kleinwüchsig zu benennen. Als ich mit meiner Zeitung aus dem Waggon kletterte, sah ich ihn, an der Rolltreppe stehend, schon von Weitem beidarmig winken. Er hatte Tag und Uhrzeit nicht vergessen, oder aber doch zumindest sich wieder daran erinnert. Wenzel war körperlich vorhanden. Er war, Wort haltend, da, vor Ort, und seine Anwesenheit ehrte ihn, jedenfalls in meinen überraschten Augen.
Noch etwa dreißig Meter von ihm entfernt, dröhnte seine kräftige Stimme schon gewaltig auf mich ein, nicht wenige Mitreisende duckten die Köpfe. Wenn man es genau nimmt, war Wenzel Wiener nur unwesentlich leiser als der quäkende Lautsprecher der Bahnhofsanlage, aber deutlich besser zu verstehen:
„Mensch Morbi, dass du noch gekommen bist, mit der Bahn, dem Dings, dem Zug, klasse, ehrlich, ein Stück weit, kein Quatsch, huhu, hier, Morbi, hier, du musst nach links gucken, alter Sappel, hier bin ich…“, und so weiter und sofort ohne Punkt und Komma, vom Semikolon ganz zu schweigen und schwallte schon aus der Entfernung gnadenlos auf mich nieder und ein und verwehrte mir aufgrund des Abstands zwischen uns jede Möglichkeit körperlicher oder verbaler Gegenwehr.
Aber den Leuten hat es offensichtlich gefallen. Bis auf ein paar der Deutschen, nein, der Berliner Sprache wahrscheinlich nicht mächtigen Migranten hat die Mehrzahl der dem Ausgang Zustrebenden gelacht und nur wenige haben mit dem Zeigefinger an die Stirn getippt. Bahnpolizei war weder anwesend, noch anscheinend alarmiert. Wenzel hatte ein Auditorium und für seine Verhältnisse war es ein Maximum, das er nicht alle Tage zur Verfügung hatte und das es auszunutzen galt.
Als ich etwa zehn Meter vor ihm war, brüllte er mit einer Stimmgewaltigkeit, die bis zum nächsten Stellwerk reichte:
»Morbi, wie war´s bei den Leinepissern? Hast du wenigstens gut gemauselt, ha ha, in Hannover an der Leine, ham die Mädchen dicke Beine und der Arsch ist kugelrund, was Morbi, stimmt doch, oder, sag mal, alter Torfstecher?«
Ich merkte leichte Röte in mir aufsteigen, als verschiedene Leute mich anguckten, zumal just zu diesem Zeitpunkt der verkommene Kellner des Mitropa-Speise-(mir-ist-der-Appetit-vergangen)wagens aus einem Abteilfenster lugte, hämisch sabbrig grinsend erst Wenzel, dann mir den nackten Zeigefinger entgegenstreckte und sich dabei offensichtlich nicht nur köstlich zu amüsieren schien, sondern dies auch noch einem im hintergrundigen Halbdunkel lauernden Unter- oder Hilfskellner mitteilte. Diesem Arsch, der vierzig lange Jahre hochnäsig Club-Cola durch die Gegend geschmissen hatte, wenn er denn nicht auf der Parteischule den Fahnenappell verschlief, diesem HO-Gauner, der er immer noch war, der nie irgendwo, schon gar nicht in der Zivilisation, ankommen würde, dem hätte ich seine Schadenfreude am allerwenigsten gegönnt. Aber was soll´s, ich konnte es mir ja nicht aussuchen. So ist das postsozialistische Wendeleben, zumindest reichsbundesbahnmäßig gesehen.
Ich war inzwischen fast bei Wenzel angelangt. Er hatte das bärtige Köpfchen leicht angewinkelt, zwinkerte vergnügt mit den blitzblanken Äugelein und streckte mir beide Arme empfangsbereit entgegen, so, als würde er mich gleich inniglich in selbige schließen. Im letzten Augenblick überlegte er es sich anders, zog die Ärmchen wieder in ihre Grundposition und ich war froh, nicht vor all den Leuten an seine Brust gedrückt und eventuell auch noch abgeknutscht zu werden.
»Du kommst ja pünktlich«, schrie er mich an, »das ist schön, da braucht man nicht solange zu warten«, schlussfolgerte er messerscharf. Dass Wenzel schrie, war normal, es war ihm von der Natur nicht gegeben, in angemessener Lautstärke zu reden.
Dann lud er mich zum Frühstück ein und auch mein Hinweis, es sei ja nun doch schon früher Nachmittag, brachte ihn nicht davon ab, denn er hatte höchst Wichtiges mit mir zu besprechen.
»Hast du schon gefrühstückt Morbi, mein Freund, komm mit frühstücken, ich lad´ dich ein, ein Stück weit, ins Omero, ein gutes Frühstück gibt´s da, geh´ schon mit, Schwager, ehrlich…«
Wer konnte da schon Nein sagen? Wir schnürten die Treppen hinunter zur Haupthalle, vorbei an zugedröhntem Drogenvolk, Bahnpolizisten und sonstigen Pennern und kamen durch schwingende Türen ins Freie. Wenzels Volvo, in der Grundfarbe ursprünglich einmal weiß, stand mitten auf dem Trottoir des kleinen Bahnhofsvorplatzes direkt an einer Notrufsäule. Ob er keinen Schiss hätte, abgeschleppt zu werden, wo es doch hier von Polizisten nur so wimmelte, fragte ich ihn erstaunt. Wenzel verneinte und schloss den Wagen umständlich auf. Er habe da einen einfachen aber wirksamen Trick, erklärte er und reichte mir aus der Windschutzscheibe einen Notizbuchzettel, auf dem mit Bleistift in Druckbuchstaben geschrieben stand: EILIGER NOTDIENST!!! und darunter war mit Filzstift ein rotes Kreuz nicht ganz symmetrisch gemalt. Das Ganze sah aus wie die ungelenke Krakelei eines Zehnjährigen.
»Und den Wisch kaufen dir die Bullen ab?«, fragte ich ungläubig.
»Immer«, antwortete Wenzel vergnügt. Und richtig, ich konnte kein Strafmandat entdecken. Was ja auch wieder einiges über die grünen Jungs und Mädels aussagt.
Wir fuhren die Joachimstaler Straße und Bundesallee Richtung Steglitz und Wenzel bemühte sich, allzu dunkle Ampelphasen zu vermeiden indem er zügige Hochgeschwindigkeit vorgab. Unter dem Rückspiegel baumelte ein Duftbäumchen in Tannenform vor sich hin, sonderte aber gnädigerweise keinen Nadelwaldgestank mehr ab. Es hatte schon beim Kauf des Wagens dort gehangen und war inzwischen zu alt für diese Art von Spielereien. Nachdem wir endlich in die Leonorenstraße einbogen, parkte er den Wagen vorschriftsmäßig am Straßenrand einer Seitenstraße und wir schlenderten durch wärmende Sonnenstrahlen zur Restauration Omero.
Es ist dies nun ein nicht eben gut beleumdetes Etablissement, das sich seit immerhin fast 15 Jahren einer mir unverständlichen Beliebtheit bei bestimmten Bevölkerungsschichten erfreut. Wir Alten gehen nur ungern in diese Suff- und Fresshöhle, da hier unbestritten die noch Älteren das Zepter schwingen, das sie erst bei ihrem biologisch bedingten Abgang an den sorgsam herangezüchteten Nachwuchs unter sich weitergeben, der es dann genauso hält, das Zepter. Ein verschworener Zirkel von Greisen, in sich geschlossen, abgeschirmt durch die eigene Senilität wie weiland das Zentralkomitee im Moskowiter Kreml. Im Omero tagte das richtungskompetente Oberorgan der gerontologischen Bewegung in permanenter Sitzung.
Die Räumlichkeit selbst, deutsche und internationale Spezialitäten, besteht aus einem langen schlauchartigen Saal, der sich meterweit im Hintergrund durchs Halbdunkel kämpft und wohl auch darin verliert. Kein Bild stört die schlichte Schmucklosigkeit der Wände, die beidseitig mit Tischchen für jeweils vier Greise vollgestellt sind. Die Tischreihen trennt eine Art Laufsteg für das Bedienungspersonal, das, wie sich mir bald erschloss, aus einer einzigen, mehr als zwielichtigen, Person besteht, die offensichtlich Tag und Nacht hier schlaflos ihr Wesen treibt und mittels des schmalen Knüppeldamms allerlei Gemenge von der Feuerstelle an die Tische speditiert, Bier und Schnaps sowieso.
Im hinteren, fast schon dunklen Teil der schlauchigen Schankstube gelangt man durch ein Gewirr verschiedener Türen und tückisch auf ihre Chancen lauernder Stufen in den per Schild deklarierten „Raum für Festlichkeiten aller Art“, in dem die Untoten ihre Jubiläen, Gedenkfeiern, letzte Tänze und, wer weiß, schwarzen Messen oder andere kultischen Orgien bei tauchsiedergewärmten Gerstensaft und sonstigen Gaumenkitzlern abfeiern.
Kurz vor dem Türgewirr, gerade noch im rauchgeschwängerten Dunst zu erahnen, befindet sich der Tresen mit Zapfanlage, Waschgelegenheit und Schränken aller Größen und Couleur, die Gläser unterschiedlicher Abmaße, Zubehör und sonstige Accessoires des Suffs bergen und verwahren.
Ein weiteres Schild im Eingangsbereich weist großspurig auf einen sommerlich zu nutzenden Biergarten hin, den jedoch keiner, den ich kenne, je gesehen, geschweige denn betreten hat. Nicht wenige behaupten sogar, der Biergarten existiere ausschließlich in der blühenden Phantasie des Schildermalers. Wer weiß.
In diese Lokalität verbrachte mich Wenzel Wiener, der Substitut aller Schwäger.
Kaum, dass wir den Gastraum betraten, schleuderte Wenzel ein behände gedonnertes »zwei Halbe Fred«, in Richtung eines sich undeutlich im Halbdunkel herumdrückenden Individuums, das hier augenscheinlich den Schankkellner gab und sich infolge der wienerschen imperativen Diktion beherzt am Zapfhahn zu schaffen machte. Ich war einigermaßen verblüfft, denn der Ersatzschwager schien hier offensichtlich wohl bekannt und gelitten zu sein, stand mit dem Personal auf vertrautem Fuß, duzte hierhin und dorthin die zwielichtigen Diener des Suffs und deren halbseidene Klientel und schämte sich auch keineswegs, mir diese mehr als fragwürdigen Bekanntschaften bislang verheimlicht zu haben. Was lief hier ab? Was ist jahrelang an mir vorbeigeschlittert?
Um diese Zeit, dem frühen Nachmittag, war das Omero nur mäßig besucht, so dass wir ohne Mühe Plätze fanden. Der Vertretungsschwager bugsierte mich an einen freien Greisentisch in strategische Nähe zur Theke und dem in ihrer Umgebung lauernden Kellner Fred, der, unmittelbar, nachdem wir saßen, schiefmäulig grinsend die georderten Biere vor uns stellte und sich dann flugs in das Zwielicht seiner Tresenexistenz zurückzog.
Von dem angekündigten Frühstück war keine Rede mehr. Wenzel starrte einige Sekunden auf sein Glas, bevor er es konzentriert an die Lippen führte und ansatzlos etwa die Hälfte des Bieres in seinen Hals schüttete, es sodann absetzte und mit Schwung auf den Tisch zurückknallte.
»Ahhh, das tut gut, ein Stück weit, was Schwager?«, schwallte Wenzel mich an und guckte verträumt durch den Raum.
Was für eine hochwichtige Mitteilung er mir denn nun eigentlich machen wolle, versuchte ich vorsichtig den Grund unserer Anwesenheit herauszufinden, hatte aber vorerst kein Glück bei Wenzel, der voll und ganz damit beschäftigt war, sein Bier auszutrinken, mich blinzelnd ebenfalls zum Trinken aufzufordern, beim Kellner zwei neue Halbe in Auftrag zu geben und außer seinem Standardrepertoir: Ahhh, Prost, gut was, ein Stück weit, nichts weiter von sich gab.
Wir tranken recht tapfer mit hoher Frequenz fast schweigend vor uns hin. Ich sinnierte beschaulich über Susi Bürstmann-Pümpels knalligen Doppelnamen, Wenzel erfreute sich seiner Umgebung und scherzte auf deftig humorige Art mit den Greisen vom Nachbartisch, »Na, heute schon die Skelette rhythmisch bewegt, Companeros, oder wie? Was sagt das Friedhofsamt dazu?« und ähnliche Büttenreden mehr.
Nach dem dritten Halben schlich sich mir ein leichter Schwurbel ins Hirn. Er äußerte sich aufs Angenehmste, denn plötzlich stellte ich mir den Schankkellner Fred in schwarzen Netzstrümpfen mit Minirock und weißem Häubchen vor, wie er durch die Tischreihen den Knüppeldamm entlang tänzelte und den Gerontologen des Zentralkomitees Schwabbeleisbein und Räuberspieß vor die Sabberlätze knallte. Der Beuteschwager wurde immer unbestimmter in seiner Gestalt, zerfloss bis zur Undeutlichkeit, drohte zur Gänze mit dem Hintergrund zu verschwimmen und ward nur noch durch seine dröhnende Dreistigkeit, lass mal die Luft aus den Gläsern, Fred, ehrlich, als Wenzel Wiener identifizierbar.
Es erfasste mich ein wohliges Gefühl, Frohsinn verbreitete sich im Gemüt. Was wollte die Welt da draußen von mir? Meiner Gattinschwester Beschäler umgab mich, ein Stück weit. Und Fred, der Schankkellner, der sogar auf Zuruf Biere ohn´ Zahl apportierte. Kann es Schöneres geben? Na ja, die Familie Bürstmann-Pümpel vielleicht, Susi und Strolch, Pardon, Percy…
Inzwischen hatte sich das Omero auch mit seiner gegen das ewige Vergessen ankämpfenden Stammklientel gefüllt, die kam, ihren Mittagspamp in sich hineinzulöffeln, um dabei verstohlen unter des geilen Kellners Minirock zu linsen, vielleicht den schwarzen Zwickel der Netzstrumpfhose zu erheischen, haha.
Mit Beginn des vierten Halben schwand die Verschwommenheit und wich einer präzisen Gedankenschärfe, wie sie außerordentlicher nicht sein konnte. Auch Wenzels Konturen hoben sich nun wieder deutlicher vom Hintergrund des Raums ab. Er schlabberte sein Bier in kleinen Schlucken mit spitzem Mäulchen und war dabei allerliebst anzusehen. Plötzlich kam mir ein unanständiger, höchst verwegener Einfall.
Welche Bedeutung es wohl mit dem Namen Wenzel auf sich habe, wollte ich von Wiener wissen, ob sich seine Eltern etwas dabei gedacht hätten, wenn überhaupt. Er tat zunächst so, als hätte er nichts gehört, verzog in bekannter Manier die Schnute, schnitt schönste Grimassen und pfiff tonlos ein Liedchen. Die Augen streunten durch die Rauchschwaden und über die Köpfe der mümmelnden Greise.
Ich aber blieb hart und wiederholte mein Anliegen, etwas nachdrücklicher im Ausdruck vielleicht, die Ernsthaftigkeit zu betonen.
Wenzel schaute mir eine kurze Weile ins Gesicht und erklärte dann, alles hinge mit Prag zusammen, dem Prager da, dem Wenzel, du weißt schon, »Morbi, der Platz da in der Altstadt, verstehst du mich, wo er steht, der Dings, der Wenzel, ein Stück weit?«
Das Konvolut unzusammenhängender Wörter und Satzfetzen ergab, dass seine Eltern, unverheiratet noch, sich bei einem Kurzbesuch Prags (Wenzel bevorzugte das nette Wörtchen Trip), nächtens, vom süffigen Urquell durchgurgelt, unter dem Denkmal des tschechischen Nationalhelden und vielerlei Geknutsche, Geküsse, und sicher auch Gegrapsche, die Ehe versprochen und dieses Versprechen dummerweise auch gehalten hatten, was in der Folge die vorgeschriebenen Monate später den kleinen Wenzel zur Welt kommen ließ.
Mehr Verständliches war zu diesem Thema von ihm nicht herauszubekommen. Vielleicht schämte er sich auch ob der Trivialität der damaligen Umstände, respektive nicht der Umstände, sondern der Tatsache als solcher mit dem ganzen Betatschen, nachts im Mondenschein. Dubcek war gerade auf einem Kurztrip in Moskau, um anschließend in der Versenkung zu verschwinden, da versprechen sich zwei, spätestens durch diesen Akt ausgewiesene Dummerchen, auf dem Wenzelplatz die Ehe. Auweia. Fürwahr, es ist sehr wohl getan.
Da hat er Glück gehabt, der Wiener, dass Vati und Mutti in spe zu dieser Zeit nicht im französischen Orleans waren, sonst hieße er heute Johanna, der Wenzel.
Wenzel gluckerte an seinem Bier herum und schnäbelte sehr charmant vor sich hin. Meine Frage nach den Wurzeln seiner Existenz hatte ihn verlegen gemacht. Namensforschung, zumal die eigenen Ursprungs, verletzte offenbar sein Schamgefühl. Mein bäriger, schaurig verschwiemelter Honigschwager, der du bist.
Plötzlich blinzelte er süffisant in meine Richtung. Suchte er den Einstieg, mich in die Gründe unseres Hierseins, seiner Einladung zum Frühstück, einzuführen? Werde ich endlich in die letzten großen Geheimnisse der Menschheit, die Mysterien, den Heiligen Gral gar, eingeweiht? Bin auch ich berufen?
Im Hintergrund hantierte der Schankkellner Fred geräuschvoll mit Essnäpfen und Schnabeltassen. Langsam füllte sich der Raum mit den Siechen des Zentralkomitees. Dämpfe allerlei Suds drückten durch die Ritzen der Höllenpforte, die den Schankraum von den Feuerstellen der Bratstube trennte. In der nahen Ferne wog der Wind sanft die Glocke des christlichen Tempels in löchrigem Turm. Ein Säuseln war in der Luft, mehr noch, ein Hauch von Frieden machte sich breit im Omero und legte sich schwer über Krücken, Rollstühle und unsere erneut gefüllten Biergläser. Für den Augenblick war alles wohlgefällig.
Unvermittelt stieß Wenzel sein ameisenbäriges Rüsselchen in die Luft, warf das offene Haar hinter sich und schwagerte mich an:
»Du weißt, warum wir hier sind?«,
und legte, ehe ich noch irgendwie zur Antwort kam ohne weitere Umstände nach: »Ich habe einen Hund gekauft, ein Tier, du verstehst?«, donnerte es mich an. Ich verstand. Wie denn das Tier heißen würde, fragte ich ihn.
»Na Hund«, Wenzel glotzte mich verwirrt an.
»Der Hund heißt Hund?«, jetzt war es an mir, verständnislos dreinzuschauen, »ist das nicht ein bescheuerter Name für einen Hund, Hund zu heißen?«
»Der Hund heißt ja gar nicht Hund. Das Tier heißt Hund, der Hund heißt Cholera, Manfred Cholera. Ist doch ganz einfach Morbi, du verstehst?«
Nun ja, vielleicht lag es ja auch an der zuckeligen Bahnfahrt von Hannover in unser Hauptstadtdorf, Reichsbahn-Jetlag oder so, aber ich verstand nicht viel. Schon überhaupt nicht, warum man seinen Hund Manfred Cholera taufen sollte.
Etwas umständlich und kompliziert klärte mich Wenzel auf, wie es zu dieser, verhalten gesagt, ungewöhnlichen Namensgebung gekommen ist.
Vereinfacht wiedergegeben ging es darum: Er, Wenzel, habe den Köter ursprünglich Stolpe nennen wollen, und zwar in Anerkennung der Verdienste eines gleichnamigen Politikers aus der Partei, der Wenzel aus traditionellen Gründen nahesteht: »du weißt es Morbi, ich bin ein Roter, schon immer, unbedingt.«
Diese Idee aber habe er fallen gelassen, als ihm ein guter Bekannter mitteilte, der Name Stolpe würde ihn nicht nur phonetisch, sondern auch visuell sofort an die Hundekrankheit Staupe erinnern, und zwar zwingend. Dabei bekäme er immer Bauchschmerzen übelsten Ausmaßes und müsse anschließend kotzen.
Nach eingehenden Überlegungen und diversen Fernsehbildern des von ihm, Wenzel, mit der Ehrung bedachten Politikers, konnte er nicht umhin, sich der Meinung seines Bekannten anzuschließen und beschloss, wenn auch schweren Herzens, eine Namensänderung nicht nur in Erwägung zu ziehen, sondern, anders als es in besagter Partei bei Beschlüssen gängige Praxis war, auch tatsächlich umzusetzen.
Das mit der Krankheit gefiel ihm, Wenzel, allerdings nicht schlecht und über Staupe, Buda und Pest fiel ihm schließlich Cholera ein, was er provokativ lustig fand.
»Hat doch was, Morbi, was?«
Was?
Dem ursprünglichen Gedanken und dem Gedenken an seinen, wenn auch unfreiwilligen, Ideengeber, nicht ganz die Reminiszenz zu verweigern, nannte er seinen Hund dann endgültig Manfred Cholera. Und dabei blieb es, Herr und Hund waren es zufrieden.
Kein schöner Hundename, zugegeben, aber originell und sicherlich einmalig. Auf jeden Fall stach er aus dem üblichen Einheitshundenamenangebot heraus. Gegen Manfred Cholera konnten Stupsi, Waldi, Boppele, Hexi, Harras und wie die idiotischen Halter ihre Viecher auch immer zu nennen pflegen, nicht mithalten, soviel war mal klar.
Nun ja, Wenzel zwinkerte mir, Komplizenschaft erbettelnd, mehrdeutig zu, der Hund habe eine, wenn auch kleine, aber immerhin, Macke, das wolle er mir nicht verheimlichen. Ein minimales Handicap, ihm persönlich wäre es sowieso egal, »du kennst mich, Schwager, ich bin tolerant,« aber nicht alle würden so denken wie er, »hab ich recht, Morbi, was sagst du, ich hab doch recht, oder?«
Und druckste und malmte herum, ehe er nach neuerlicher Bierorder und -lieferung endlich zum Kern der Angelegenheit kam. Manfred Cholera nämlich, gestand Wenzel raunend und mit leicht vorgebeugtem Oberkörper, würde alles rammeln, was ihm in die Quere, bzw. vor die Füße, richtiger, vor sein Gemächte käme, und zwar nicht nur seinesgleichen, Hund und Katz, sondern auch sonstiges Getier, einschließlich der Gattung Mensch, wenngleich Letzteren auch nur am Bein, was er bisher so beurteilen könne, »was sagst du?«
Aber damit nicht genug würde das possierliche Tierchen auch Dinge, »Sachen halt, du verstehst, Tischbeine, Plastiktüten und sonstigen herumliegenden Kram, Gegenstände halt,« als Sexualpartner durchaus nicht verschmähen. Das sähe dann doch ein wenig peinlich aus, wenn er, Wenzel, mit ihm, dem Hund, auf der Straße spazieren gehe und dieser mit heraushängender Zunge, verdrehten Augen und eindeutigen Geräuschen über einem herabgefallenen Ast, einer leeren Pizzaverpackung oder einer mit Abfall gefüllten Alditüte hinge und sich redlich abmühte, die rot geschwellte Kuppe endlich zum Schuss zu überreden. Überdies gelänge gerade das dem Hund, zumindest bei Ästen und Tüten, äußerst selten und nur unter Einsatz letzter Kräfte und wenn es wider Erwarten dann doch passierte, sei er danach immer dermaßen überrascht und geschwächt, dass er sich, alle Glieder, ha ha, von sich streckend, schlichtweg weigere, den Weg fortzusetzen, und er, Wenzel, ihn dann nach Hause tragen müsse. Ein unwürdiger Abgang sozusagen und ein schwerer, zumindest für Wenzel.
Zu welcher Rasse der Hund denn gezählt wird, wollte ich wissen. Das könne er so genau nicht sagen, erklärte Wenzel. Auf jeden Fall sei ein Dackel dabei gewesen und ein Terrier wohl auch, wenn er der Expertenmeinung des impfenden Tierarztes trauen darf, und noch ein paar andere Sorten, »kannst du dir ja denken.« Klar konnte ich.
Eigentlich hätte ich mich genau an dieser Stelle fragen müssen, ob der Hundekauf aus Wenzels Sicht wirklich Grund genug war für eine nachmittägliche Einladung, die einen zunehmend kostspieligen Charakter annahm. Die Angelegenheit, die er mir noch auf dem Bahnhof als höchst wichtig avisiert hatte, versandete doch nicht etwa in den profanen Niederungen eines Plastiktüten rammelnden Vierbeiners unbestimmter Sortenzugehörigkeit. Selbst wenn ich gewollt hätte (habe ich aber nicht), was konnte ich dazu beitragen, den Hund Manfred Cholera von seinen peinlichen Sexualpraktiken abzubringen? Wozu auch, bei seinem besten Freund, dem Menschen, gab es in dieser Hinsicht noch ganz andere Dinge zu bestaunen, da waren Äste und Pizzaverpackungen eher unbedeutend, geradezu lächerlich.
Aber ach, alle diese wohlfeilen Überlegungen kamen mir erst später, viel später, in den Sinn. Hier und jetzt, im Omero, unter des Schankknechts Gesetz, schwappte mir das Bier literweise durch Körper und Gehirn, beruhigte und stachelte gleichzeitig auf, erfreute und ließ traurig werden, kurz, ich näherte mich, Heidewitzka, Herr Kapitän, dem trunkenen Zustand, und zwar mit Riesenschlucken. Und in dieser Verfassung denkt man nicht weiter nach, sondern ordert alert die nächste Runde, respektive lässt ordern, denn soviel klaren Kopf hatte ich noch, mich der Einladung des Hundeschwagers zu erinnern. Und der ließ sich, was die Bestelltechnik und auch deren häufige Umsetzung anging, nicht lumpen.
»Außerdem,« Wenzel donnerte wiederum in meine Richtung, »außerdem kaufe ich mir ein Aquarium, mit Fischen, Zierfischen, Exoten drin, englisch. Als Wertanlage, ein Stück weit, ehrlich.«
Nun war es also raus. Das ganze nachmittägliche Besäufnis fand statt wegen einer Menagerie unterschiedlichster Tierarten, im konkreten Fall wegen eines vierbeinigen Sexmonsters und jetzt auch noch eines Aquariums, mit Fischen, englisch, ehrlich. Oh Schwager mein. Wo soll das alles enden? Im Wasser, ein Stück weit? Als Wertanlage?
Ein Aquarium sei eine tolle Sache, machte ich Wenzel Mut, besonders mit Fischen drin, jedoch solle er die Folgen einer diesbezüglichen Kaufentscheidung wohl bedenken, besonders auch im Hinblick auf den erst kürzlich erworbenen Hund Manfred Cholera. (Wo war der überhaupt? Warum rammelte der nicht hier im Omero die Prothese eines der siechen Gebissträger und anschließend noch des Schankknechts Spülbürste?) So ein Fischbehälter verlange jede Menge Pflege, wegen unerwünschter Algenbildung, Fischkot und manch anderer widriger Dinge. Das gälte es abzuwägen. Schon beim Reden fühlte ich die Halbherzigkeit meines Einwurfs. Sachlichkeit war gefragt.
Wie denn das zu verstehen sei, englisch und die Bemerkung mit der Wertanlage, wollte ich wissen.
Der Schwagerrüssel atmete tief durch, rollte verträumt mit den Augen und belehrte mich dahin gehend, dass englisch der fachidiomatische Hinweis auf die Anlage der Unterwasserlandschaft sei, Wenzel sagte allen Ernstes seagarden, und das Ensemble, also seagarden und Zierfische, exotische zumal, als Ganzes gesehen in Fachkreisen durchaus als Wertanlage gelte.
»Das hat Bestand«, raunzte Wenzel nicht emotionslos dahin, »der Dings da, der Dings, der, na sag schon, der Schmalenberg, der Günther Schmalenberg, du kennst ihn auch, der Günther, der hat schon seit Jahren ein Aquarium, echt, und verdient sich dumm und dämlich daran, ehrlich. Der züchtet Zierfische mit seiner Schwester, der Gabi, kennst du auch, sicher, die sitzt beim Reichelt an der Kasse, ein Stück weit. Dumm und dämlich, sag ich dir«, schob er zur Sicherheit nach.
Dann kam ein kurzer aber eindrucksvoller Rülpser. Das Bier tat seine Wirkung. Allmählich quakte Wenzel sich in Form.
»Weißt du, Morbi, ich mach´s ja nicht wegen dem Geld.«
»Genitiv«, warf ich ein.
»Was? Wie bitte?«, Wenzel schien irritiert.
»Genitiv«, wiederholte ich, »nach wegen wird der Genitiv benutzt, zweiter Fall, Wesfall. Es muss heißen: wegen des Geldes. Hört sich besser an, Wenzel.«
»Ach so, klar, weiß ich doch, klaro. Also ich mach´s ja nicht wegen dem…« er suchte, »wegen der Kohle, der Wertanlage da, sondern, ein Stück weit«, Wenzel holte tief Luft, »sondern wegen der Freude, der Natur. Also wegen der Freude an der Natur, Pflanzen, Fische, Exotik, das tut gut, ehrlich.« Jetzt kam er ins Schwärmen.
Warum gerade Aquarium, ließ ich nicht locker, es gäbe so viel andere Dinge, aber ausgerechnet Fische, Zierfische, betonte ich, die Verantwortung.
»Na eben«, wienerte es zurück, »da siehst du´s.«
Wie es schien, lief ein Großteil des Weltgeschehens ohne mich ab. Erst die Entdeckung, nein, nicht Amerikas, ein bisschen mehr Ernst, Herrschaften, wenn ich bitten darf. Erst die Entdeckung, wie tief Wenzel in die mafiöse Szene des Omero verstrickt war und kurz darauf die Erkenntnis, wie engagiert der Substitut aller Schwäger in die professionellen Sphären der Aquaristik (seagarden!) und deren algigen Bodensatz sich eingeschlammt hatte. Von Manfred Cholera und dessen sexistischen Ausschweifungen ganz zu schweigen. Und nichts davon hatte ich auch nur ansatzweise geahnt.
Zwischenzeitlich öffnete sich die Tür des Omero und herein kam ein sehr dunkelhäutiger Mann unbestimmten Alters, der allseits als Leroy begrüßt wurde.
Das aber hatte Wenzel in seinem Unterwasserrausch noch nicht mitbekommen.
»Alles andere ist am Arsch«, krähte Wiener vor sich hin, »Autos, Motorräder, Möbel, eben alles. Am Arsch, sag ich dir. Natur zählt und sonst nix, ehrlich, am Arsch.«
Jetzt war er in der Fäkalphase angelangt. Im Hintergrund hatte der Leroy benannte mittlerweile einen Tisch in Beschlag genommen, den Ellbogen seines linken Arms auf die Platte gestemmt, den Kopf, den schweren schwarzen, zu stützen. Mit dem Zeigefinger der rechten Hand popelte er in der Nase. Unaufgefordert stellte Fred ein Bier vor ihn hin. Die Greise grinsten. Aber das tun sie immer kurz vor dem Abschied.
»Du kennst mich, Morbi, du kennst mich wie kein Zweiter, stimmt´s? Hab ich recht, sag ehrlich Schwager, hab ich nicht recht? Was soll der Scheiß, der Scheiß mit dem Terror da, dem Terror, dem…, dem…«, Wenzel suchte Augen rollend nach dem richtigen Wort.
»Afghanistan?«, warf ich ein, »Dschalalabad?«
»Dschalalala… was? Quatsch, Afghanistan, dem Terror da, nein, hier, dem Terror hier bei uns, dem Terror«, er schnaufte und nahm sich ein kleines Päuschen. Dann hatte er wieder das bekannte Blinken in den Äuglein, den verschmitzten, »Konsumterror, der da«, jetzt hatte er´s, »den mein ich, Konsumterror, versteh mich. Da setz ich die Natur dagegen, mach ich nicht mit beim Terror, ich liebe Fische, ein Stück weit, weil die so natürlich sind, natürlich und und…«
»Nass«, versuchte ich zu helfen, Wenzel aber hob den Zeigefinger und gegen den Konsumterror, die Exoten. Bingo.
Er wackelte mit dem Schädel und hatte dabei augenscheinlich den dunkelhäutigen Mann bemerkt.
»Ach der Leroy«, schrie Wenzel los, »schau an, der Leroy, bist du auch mal wieder da, hier, du Neger du, was macht die Alte, Leroy, sag, was macht die Alte, noch gut bei Schuss, was, das freut mich ja, der Leroy, geht´s gut, ja, sag, geht´s gut?«
Dem Rattenschwanzschwager ging die Puste aus. Sein Köpfchen drehte zu mir.
»Der Leroy ist ein feiner Mensch«, grummelte er mir, für seine Verhältnisse gedämpft zu, ein ganz feiner Mensch, »so vornehm in seiner Art«, erneut suchte Wenzel nach Worten, »ein richtiger Adokrat«, oh Gott, das Bier, aber unverdrossen ging es weiter,
»Aristat, nein, jetzt: Aristokrat«, verbesserte er sich im dritten Anlauf, »edel, ehrlich. Gibt´s nicht oft. Und so stolz. Tuareg. Ein ganz feiner Neger.«
Es schauderte mir den Rücken runter. Edel sei der Leroy und vornehm und stolz. Halleluja.
Indes schien Wenzel den Leroy sofort wieder vergessen zu haben, denn er drehte sich erneut zu mir und nachdem er ein wenig am Bier genuckelt hatte, schaute er mich mit treuem Blick an.
»Darf ich dich was fragen, Morbi? Bitte, ich muss dich was fragen, gib mir eine ehrliche Antwort Schwager, gib mir eine faire Chance, ein Stück weit, mein Freund.«
»Klar Wenzel«, erwiderte ich ohne Begeisterung, denn ich kannte die wienersche Fragenpalette in seinem jetzigen Stadium der fortgeschrittenen Alkoholisierung. Meist drückte er eine imaginäre Träne aus dem Augenwinkel und wollte dann von mir wissen, ob er ein Weichei sei oder ähnlichen Unsinn mehr. Der Ritter von der traurigen Gestalt.
»Du hast ein Recht auf eine ehrliche Antwort, Wenzel. Und von mir bekommst du sie. Garantiert.« Natürlich war ich ein vermaledeiter Lügner. Ich spürte, noch während ich diesen dämlichen Satz vor mich hinsagte, es grausam in Magen und Gedärm zwicken und ziehen. Warum war ich nur so meineidig? Vor dem, der so viel Vertrauen in mich setzte, Sancho Pansa und Dulcinea in einer Person. Sonst hatte ich derartige Bedenken, zumindest Wenzel gegenüber, nicht. Mehrere Liter Bier hatten mich empfindsam und dünnhäutig gemacht. Ich schämte mich ob meiner moralischen Verkommenheit nicht wenig, aber auch nicht so stark, dass ich eine Umkehr, Beichte gar, ernsthaft in Erwägung gezogen hätte. Wenzel hätte es eh nicht verstanden. So ist das Leben, mein liebes Schwagerschweinchen. Grausam und doch irgendwie gerecht. Wie du mir, so ich euch. Ehrlich.
»Morbi«, er rang offensichtlich mit den richtigen Worten, »Morbi, was hältst du von der Idee mit der Natur da, dem Aquarium, mit den Fischen, den Dings, den Exoten, ehrlich. Was hältst du davon? Pass auf, ich sag dir was.«
Wenzel hielt kurz inne und nahm einen tiefen Schluck aus dem Bierglas. Eigentlich hatte ich verstanden, ihm die Frage zu beantworten, jetzt wollte er mir was sagen. Auch gut, mir war alles recht, ich schwelgte noch selbstmitleidig in meiner moralischen Vierteldepression. Der Schnäuzelschwager wuchtete seinen Körper in eine Drehung, um dem Schankkellner Fred lauthals eine neue Order von zwei Halben zuzubrüllen. Dabei fiel ihm der popelnde Leroy wieder ins Blickfeld.
»Ach der Leroy«, krakeelte Wenzel sofort los, »schau an, der Leroy«, stutzte dann aber und machte ein ausgesprochen blödes Gesicht.
»Der Leroy«, murmelte er selbstvergessen jetzt vor sich hin. Anscheinend hatte er seine Begrüßungstirade wenige Minuten zuvor nicht mehr parat und versuchte sich nun zu erinnern, wann er den dunkelhäutigen Herrn zuletzt gesehen hatte. Und ob das eventuell heute gewesen sein könnte. Leroy selbst schien das Dilemma seines Duzfreunds kalt zu lassen, er popelte ungerührt weiter. Mit Schwung dreht Wenzel sich zurück. Er hatte sich entschieden, den schwarzen Gast erst vor Kurzem begrüßt zu haben, war aber noch nicht so stark betrunken, meinen skeptischen Blick zu übersehen. Indem er mit dem Daumen der rechten Hand über seine linke Schulter Richtung Leroy deutete, versuchte er seufzend seinen faux-pas galant zu überspielen.
»Ja ja, der Leroy, ein feiner Kerl. Ehrlich. Wo war ich stehen geblieben? Jawohl, ich sag dir was Schwagerherz, bitte hör zu, hör nur einmal zu. Du hilfst mir bei der ganzen Sache, ja, du hilfst mir, komm, sag schon ja, kostet dich doch nichts, was? Nur ein bisschen Überwindung.«
»Helfen, Wenzel, helfen wobei?« Jetzt hatte er mich überrascht. Statt, wie üblich, weinerlich über seine eigene Situation zu heulen, versuchte er mit geänderter Taktik, mich in irgendetwas hineinzuziehen. Äußerste Achtsamkeit war angesagt, was sich angesichts meines Bierkonsums als durchaus nicht einfach ausnahm.
»Schau Morbi, du sprichst mit der Katharina, dass sie´s erlaubt, das Aquarium, die Fische, dass sie zustimmt, du verstehst. Auf dich hört sie, sicher, ich spür´s, Morbi, sie legt großen Wert auf deine Meinung. Und wenn du ihr erklärst, wie wichtig alles ist, Natur und so, wegen dem Konsumterror, Pardon Schwager, Wesfall, ich weiß, wird sie´s schon packen. Machst du das für die Natur, für mich, ein Stück weit, was?«
Der Vertretungsschwager schaute mich mit Treue vortäuschendem Augenflor an, ich musste unwillkürlich an bettelnde Dackel denken. An seiner statt sollte also ich die Auseinandersetzung mit Katharina führen, die er, Wenzel seinerseits schon vor Beginn für verloren wähnte. Im Gegensatz zu ihm war nämlich die Gattinschwester eine weitestgehend vernunftbestimmte, praktisch veranlagte Persönlichkeit, die schützend ihre Hand über den Schwagersubstitut hielt und dadurch manch größere Hanswurstiade verhinderte. Ihr dafür erforderliches Durchsetzungsvermögen indes minderte das sowieso kaum vorhandene Wenzels, denn einer musste schließlich nachgeben, sollte es zu einem Ergebnis kommen. Kompromiss war da eher nicht ihre Sache, wenn schon, denn schon. Dies allerdings durchaus im Sinne Wenzels, auch wenn er es nicht immer einsehen konnte oder wollte, etwa wie ein Kind nicht einzusehen vermag, warum es nicht auf die heiße Herdplatte fassen soll. Solcherart an vermeintliche Niederlagen gewöhnt, schätzte er die Situation bezüglich seines aquaristischen Vorhabens schon richtig, goldrichtig geradezu, ein. Allein er überschätzte meinen Einfluss auf Katharina, der in realiter nicht bestand. Zwar hörte sie sich geduldig, wohl aus Rücksicht auf ihre Schwester, die viel geliebte Geliebte, meine Argumente an, handelte dann jedoch so, wie sie es für richtig hielt, was zumeist auf das Gegenteil zu meiner Meinung hinauslief. Wohl nicht zu Unrecht vermutete ich hinter ihrem Verhalten ähnliche Gründe, wie sie auch Wenzel gegenüber zum Tragen kamen. Es war deshalb der wienersche ein verzweifelter, aus meiner Sicht hoffnungsloser Versuch, seinen kleinnautischen Ambitionen zu einer positiven Wendung zu verhelfen.
»Klar Wenzel, mach ich, ich spreche mit Katharina, wenn´s dir denn hilft, ich versuch´s zumindest, versprochen.«
Halbherzig wollte ich mich aus der Affäre zu ziehen, zu feige, ihm die Wahrheit zu sagen, insgeheim hoffend, dass Wenzel den gesamten Aquaristikquatsch schnell wieder vergaß und der fischige Exotenkelch an mir vorüberging.
Er schien erleichtert.
»Ich danke dir Morbi, ehrlich. Du hast dann was gut bei mir, wir machen eine Fete am Aquarium, mit allem Drum und Dran, wenn´s klappt. Eine Unterwasserfete, ha ha, jeder, der kommt, kommt mit was«, (oh Gott was quatscht er da vor sich hin),
»Schwimmflossen, Taucherbrille, Rettungsboje. Den Leroy laden wir auch ein, was Leroy, alter Freibeuter, Pirat sozusagen«, er beugte sich nach hinten und schrie dem Schwarzen ins dunkle Gesicht, »du kommst, mit Angelrute und Entermesser, ha ha, der Leroy mit einer Angelrute, Würmer am Haken…, Entermesser mit Blut an der Scheide, Schneide…, hahaha…« und schien sich allerköstlichst zu amüsieren.
Wenzel taumelte sich wieder in seinen normalen Wahn hinein und quakelte vergnügt vor sich hin. Für ihn schien das Problem gelöst.
Wo denn eigentlich sein Hund sei, wollte ich wissen.
»Was für ein Hund?«, fragte Wenzel mit blinzelnden Äuglein zurück.
»Na dein Hund, Manfred Cholera, der alles rammelt, was sich ihm in den Weg stellt, das kleine Sexschweinchen mit dem perversen Triebleben. Kannst du dich etwa nicht mehr an ihn erinnern?«
»Ach den meinst du, Manfred Cholera, der ist zu Hause. Ich wollte ihn nicht mitnehmen, Morbi, bei so einer wichtigen Besprechung stört er nur, weil er keine Ruhe gibt, der kleine Racker, du verstehst. Wahrscheinlich vögelt er gerade eins der Tischbeine. Er hat halt keine Kinderstube, eine schwere Jugend, Vollwaise, kann er nichts für. Sei so gut und verzeih ihm. Du wirst ihn mögen, da bin ich sicher, ein Stück weit. Er mag dich auch, der Manfred.«
Einmal abgesehen davon, dass es mir zur zweifelhaften Ehre gereicht, von einem Straßenköter ohne jegliche Kinderstube gemocht zu werden, war mir nicht ganz klar, wie der Vollwaise mit dem bescheuerten Namen dies zustande brachte, ohne mich überhaupt zu kennen. Nur durch Wenzels Erzählungen hat er mich lieb gewonnen. Erstaunlich. Der kleine Racker.
Allmählich war das Hungergefühl, das ich seit einiger Zeit verspürte, verschwunden, von den Biermassen fortgespült. Ich empfahl Wenzel einen Abbruch der Veranstaltung und täuschte unaufschiebbare Telefonate vor. Das versprochene Frühstück war ja nun ausgeblieben, respektive ausschließlich in flüssiger Form erfolgt. Wenzel schien, da er sein Herz erleichtert hatte, durchaus Willens, meinem Vorschlag zu folgen, bestand aber nachdrücklich auf einer Abschiedsrunde,
»Scheide-, nein, Scheidenbecher, haha«, wie er sich schwer ins Ordinäre verflog. Nach dem Ersten gab es dann noch einen Zweiten, »auf einem Bier kann ich nicht stehen, Morbi, denk an mein Knie, du weißt«, und dann ging´s ans Bezahlen. Wenzel pfiff den Schankknecht heran und ließ ihn seelenruhig die Zeche ausrechnen, ohne jedoch Anstalten zu machen, die Geldbörse zu ziehen. Da ich mich trotz der Biermengen sehr wohl erinnerte, eingeladen worden zu sein, dachte ich meinerseits nicht daran, den pekuniären Teil des Nachmittags zu gestalten, verhielt mich abwartend und blinzelte ohne Scham dem dunkelhäutigen Leroy zu, der jetzt aufgehört hatte zu popeln und sich voller Inbrunst seinem Bier widmete. Dadurch entstand eine Situation, die einer gewissen Komik nicht entbehrte. Wenzel starrte unschuldig auf die Tischdecke vor sich und pfiff leise einen Gassenhauer aus anmutig gespitzten Lippen, ich zwinkerte über seine Schulter dem trinkenden Leroy zu und der Knecht Fred stand zwischen uns und wippte schweigend auf seinen Schuhsohlen vor und zurück. Wahrscheinlich kannte er Wenzels Spielchen schon und setzte auf Zeit. Erfahrungsgemäß.
»Na dann wollen wir mal, immer, wenn´s am Schönsten ist, soll man aufhören«, ließ Wenzel sich plattitüd vernehmen und war im Begriff, aufzustehen.
»Zahlen Wenzel, du musst noch zahlen«, ergänzte ich.
»Zahlen, klar doch, zahlen muss sein«, entgegnete er, »was wir getrunken haben, du und ich, müssen wir zahlen, sonst wär´s ja keine Marktwirtschaft, also der Fred will, nein, der muss auch leben, ehrlich. Was Fred? Könntest du vielleicht, Morbi, ein Stück weit, in Vorlage, Auslage mein ich, treten, bis zum nächsten Mal?«
»Vergiss es Wenzel«, stoppte ich seinen zechprellerischen Versuch sofort, »deine Idee, dein neuer Hund, dein Aquarium, deine Einladung, deine Zeche, dein Geld, denk an Afghanistan, ehrlich.«
Warum ich nun Afghanistan ins Spiel brachte, war mir selbst nicht klar. Taliban Wenzel startete einen erneuten Versuch:
»Schau mal, Schwagerherz, der Hund, der Cholera, der Manfred, der Manfred Cholera, hat ein Schweinegeld gekostet, mit all den Impfungen und Spritzen und Halsband und Wurmpillen. Das Aquarium sowieso. Geh, sei so nett und…«
Ich blieb hart, schüttelte energisch den Kopf und nach einigem Gliederwackeln, Schmatzen, Klappern und Stöhnen sah er die Vergeblichkeit seines Bemühens ein, zückte die Geldbörse und zählte dem Schankkellner mit saurer Miene die geforderte Summe in Scheinen auf den Tisch, die dieser ungehobelte Alkoholsklave ohne jede Gefühlsregung oder auch nur einen Anflug von Dankbarkeit einstrich, um sich darob in das Zwielicht hinter der Theke zu verziehen, wo die Welt für ihn einigermaßen sicher war. Aber mein Widerstand hat bewiesen: Vorwärts und nicht vergessen, es geht doch, wenn man bereit ist, zu kämpfen.
Wir verließen das Etablissement des kulinarischen Grauens gehörig schwankend und konnten von Glück sagen, nicht an einem der Greisentische hängen geblieben zu sein. Mümmelnd sahen die zitternd zutzelnden Zausel uns hinterdrein. Grimmig und zu allem entschlossen. Mir fiel unwillkürlich die Liedzeile ein: only the best die young. Stimmt wohl. But where have all the good guys gone?
Hinter dem Windfang und der Tür blendete grelles Sonnenlicht, obwohl der Tag schon weit fortgeschritten war, die empfindlichen Augen. Ein beiderseitiges Schulterklopfen deutete Trennung an, ein Handschlag vollzog sie. Wenzel trollte sich nach rechts zur Bushaltestelle (entweder hatte er vergessen, dass er mit dem Auto da war, oder aber, wo er es abgestellt hatte, ein glücklicher Umstand für alle Verkehrsteilnehmer), ich linksseitig in die andere Richtung, meiner Behausung zustrebend.
Nach mühsamen etwa hundert Metern Fußmarsch hörte ich aus der Entfernung hinter mir Wenzel trompeten: »Denk dran, Morbi, ein Stück weit, ehrlich.«
Es fuhr mir angenehm kribbelnd den Rücken hinunter. Womit hatte ich die Bekanntschaft dieses so trefflich indisponierten Zeitgenossen verdient, wem sie zu verdanken? Kleine Schweißperlen bildeten sich mir auf Stirn und Oberlippe, aber das konnte auch am Kreislauf liegen.
Es ist durchaus nicht meine Gewohnheit, schon nachmittags dem Alkohol in einem Ausmaß zu frönen, das einem das Geradeausgehen noch komplizierter macht, als es im nüchternen Zustand ohnehin schon ist. Von Ausnahmen, die ja bekanntlich die Regel bestätigen, einmal abgesehen. Hinzu kam die Schwierigkeit, auf dem Heimweg all jenen Exkrementen auszuweichen, die, in größeren Kolonien auf dem Gehweg verteilt, von Manfred Cholera und seinen Artgenossen täglich tonnenweise in unserer dörflichen Idylle ausgeschieden werden. Nun gibt es kaum ein Zweifel darüber, dass selbst Kreaturen, die zu blöde sind, ein normales Wasserklosett zu benutzen, der Auswurf unverwertbarer Nahrungsbestandteile nicht abgesprochen werden kann. Allein, die Schuld trifft wieder einmal die egozentrischen Besitzer der kackenden Vierbeiner, die sich größtenteils, da wette ich, aber hallo, die Benutzung des heimischen Klos durch ihren Liebling schwer verbitten würden. Weiter darüber nachzudenken ist wenig lohnenswert. Es ist dies eines jener Probleme, die nicht zu lösen sind.