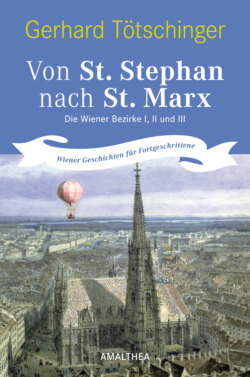Читать книгу Von St. Stephan nach St. Marx - Gerhard Tötschinger - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Wien wird Hauptstadt
ОглавлениеDie Babenberger verlegten ihre Residenz mehrmals, fast immer entlang der Donau, Gars am Kamp war eine Ausnahme. Es war vorausschauend, dass sie noch nicht in Wien residierten. Denn 1030 waren die Ungarn schon wieder da. Sie hatten einen Grenzstreit mit Bayern und Kaiser Konrad II. im Kampf entschieden, waren in der Schlacht erfolgreich – und zogen in Wien ein. Das Reich gab nach, Konrads Sohn Heinrich überließ den Ungarn das Gebiet zwischen Leitha und Fischa und die Magyaren ritten nach Hause, ab 1031 gehörte das noch kleine Wien wieder den Wienern.
Über Pöchlarn und danach Melk und Tulln kamen die Babenberger endlich nach Neuburg, heute Klosterneuburg. Bald bezogen sie auf dem Leopoldsberg Quartier, doch die letzten wenigen Kilometer bis Wien legten sie erst 1145 zurück, als Markgraf Heinrich II. regierte. Er wurde 1156 in den Herzogsrang erhoben, mit dem Privilegium minus dieses Jahres war Ostarrichi ein selbstständiges, nicht mehr von Bayern abhängiges Herzogtum.
Zu dieser Zeit konnte man in der jungen Residenzstadt immer noch Reste römischer Bauwerke nicht nur sehen, sondern auch bewohnen. Die Babenberger wählten alte römische Mauern für ihre Residenz, und was seit Jahrhunderten Am Hof heißt, war tatsächlich Am Hof. Der Herzog bewohnte einen mächtigen Bau, an dessen Stelle mehrere Nachfolgebauten von Bedeutung stehen: An der Ecke zur Bognergasse die Bank Austria, heute ein feudales Hotel, anschließend die Kirche zu den neun Chören der Engel und danach noch, durch einen Bogen verbunden, das Palais Collalto.
Alle diese Gebäude verdienten eine ausführliche Betrachtung – doch bleiben wir bei Heinrich II. mit dem Beinamen Jasomirgott. Der wird gedeutet als »So wahr mir Gott helfe …« An Gottesvertrauen dürfte es dem Herzog nicht gemangelt haben – kaum hatte er sich entschlossen, das väterliche Haus in Klosterneuburg zu verlassen und in das bescheidene Wien zu ziehen, berief er eine Mönchsschar in seine neue Residenz. In Regensburg hatte Heinrich in seinen Jahren als Herzog von Bayern die irischen Benediktiner der Abtei St. Jakob kennengelernt, nun berief er sie nach Wien. Man nannte sie Schotten, obgleich sie ja Iren waren. Das kam nicht aus dem Volksmund, der vielleicht von Geografie wenig wusste, es war ihre offizielle Bezeichnung. Das neu gegründete Kloster an der heutigen Freyung hieß und heißt mit vollem Namen »Benediktinerabtei Unserer lieben Frau zu den Schotten«. Der Herzog selbst nannte sie in seiner Stiftungsurkunde so, als er ihnen zusicherte, keinen anderen Orden zu berufen – »solos eligimus scottos«.
Diese Bestimmung hielten auch die Nachfolger der Babenberger, die Habsburger, bis zum Jahr 1418 aufrecht. Damals bemühten sich die Melker Benediktiner um eine Erneuerung, um der aufstrebenden Reformation zuvorzukommen. In Wien hatte die sogenannte Melker Reform ein weites Betätigungsfeld. Die Disziplin hatte nachgelassen, der Nachwuchs blieb aus. 1418 verließen die letzten sechs Mönche Wien und zogen zurück in ihr Kloster in Regensburg. Albrecht V. holte Benediktiner aus deutschen Abteien nach Wien, aber der Name blieb auch den Neulingen.
Die ersten Schotten erschienen 1155 in Wien und begannen auf der Stelle mit dem Klosterbau auf dem weiten Areal, das Heinrich Jasomirgott ihnen geschenkt hatte, knapp vor den teilweise noch römischen Mauern. 1200 wurde die Kirche geweiht.
Freilich stand hinter der Klostergründung der geistliche Gedanke, doch die Mönche kamen nicht nur als Priester. Sie brachten ihr geballtes Wissen mit, konnten lesen und schreiben und gaben dies weiter. Denn sie wirkten auch als Ärzte und Apotheker, bauten ein Spital. Sie waren kompetent im Bauwesen, in der Landwirtschaft, verfügten über Kenntnisse und Erfahrung in der Verwaltung. So war die Berufung der Schotten eine weitblickende Entscheidung gewesen.
Mit Kaiser Friedrich I., Barbarossa genannt, war Heinrich Jasomirgott verwandt. Darüber hinaus war er mit ihm durch ein frühes gemeinsames Abenteuer verbunden, das sie beide glücklich überstanden hatten: Gemeinsam waren sie zum Zweiten Kreuzzug aufgebrochen, gemeinsam erlebten sie den Untergang ihres Heeres am 26. Oktober 1147. Kaiser Friedrich wusste politische Probleme diplomatisch zu lösen, so auch im Umgang mit dem Babenberger Heinrich.
1165 erschien er selbst in Wien, wohnte zwei lange Wochen Am Hof bei seinen Verwandten – da ließ sich die kleine Residenz offenbar schon herzeigen. 24 Jahre später kam er wieder, und nicht alleine. Heinrich Jasomirgott war schon gestorben, nun war sein Sohn Leopold V. der Gastgeber, dem die Geschichte den Beinamen »der Tugendreiche« verliehen hat.
Herzog Heinrich war Ende November 1176 beim Überqueren einer morschen Holzbrücke in Melk samt seinem Pferd eingebrochen, er verletzte sich dabei schwer und konnte nicht mehr geheilt werden. Er wurde 1177 in seiner Gründung beigesetzt, in der Kirche des Schottenstifts. Als die unruhigen Zeiten und etliche Umbauten sein Hochgrab massiv beschädigt hatten, fand man eine neue Grabstätte. In der Krypta hat der erste Herzog von Österreich seine ewige Ruhe gefunden. Dort liegt er Seite an Seite mit seiner Frau, der byzantinischen Prinzessin Theodora Komnena, und der Tochter Agnes.
Der zweite Wiener Aufenthalt Friedrich Barbarossas war eine Folge seines Aufrufs zu einem neuen Kreuzzug, er zog noch einmal in das Heilige Land. In Regensburg hatte er sein Heer gesammelt, 15 000 Mann, nun marschierte das größte Kreuzzugsheer, das es jemals gegeben hatte, nach Wien; der Kaiser reiste auf der Donau. In Wien wusste man ihn dann glanzvoll zu unterhalten.
Leopold V. hatte den weiten Platz vor seiner Wohnburg zum Turnierplatz gemacht, in seinem Palast blühte höfisches Leben. Da traten Minnesänger auf, wie der herzogliche Hofdichter Reinmar von Hagenau oder Walther von der Vogelweide, Künstler, die an den ersten Höfen des Reichs bestehen konnten. Nun sangen und dichteten sie für den Kaiser – der gerne länger blieb, was nicht zuletzt zum Wohl der Wiener Wirtschaft massiv beitrug. Die Wirte verdienten, Waren wurden getauscht, die Hufschmiede waren im Stress.
15 000 abenteuerlustige Männer auf Reisen – das muss man sich erst einmal vorstellen. Das bedeutet zuerst einmal, dass auf jeden Wiener, jung und alt, ein waffenstarrender Tourist gekommen ist. Väter und nervöse Ehemänner müssen eine schlimme Zeit gehabt haben. Dabei hatten sie noch Glück – die Franzosen und Engländer hatten sich für den Weg zu Wasser entschieden, mit Friedrich Barbarossa reisten also Norddeutsche, Bayern, Franken …
Walter von der Vogelweide, Figurine von Helmut Krauhs, 1960
Am 11. Mai 1189 war der Kaiser in Regensburg aufgebrochen. Am 22. Mai wurde die ungarische Grenze erreicht. Solch eine große und schwer bewegliche Menschenmasse brauchte natürlich viel länger für weite Distanzen als eine heutige Vergnügungsreisegesellschaft. Immerhin, auch wenn das Gros nur einige Tage in Wien blieb, der Herrscher mit seiner Entourage blieb länger. Aber am 4. Juni war auch er in Gran, wo ihn das ungarische Königspaar erwartete.
An diesem Dritten Kreuzzug nahm auch Herzog Leopold V. teil, mit einer kleinen Begleiterschar, er brach im August 1190 auf. Für ihn und für das Reich sollte dieser Kreuzzug zum Schicksal werden, ebenso wie für Friedrich Barbarossa. Der Kaiser war auf dem Weg nach Jerusalem im Juni 1190 im Fluss Saleph ertrunken, er hatte sich, obgleich nicht mehr jung, in der Mittagshitze zu viel zugetraut.
Der Babenberger führte zunächst bei der Belagerung der Festung Akkon ab Jänner 1191 das Kommando über das deutsche Ritterheer. Im Frühjahr stellten sich ihm französische und englische Ritter zur Seite, und am 12. Juli 1191 war Akkon erobert.
Aber nun gab es einen Streit um den Vorrang. Herzog Leopold habe bei der Eroberung nur eine Nebenrolle gespielt, erklärte der König von England, Richard Löwenherz. Er soll das Banner des Babenbergers, von diesem vielleicht etwas vorschnell als Siegeszeichen aufgepflanzt, von der Mauer gerissen und in den Graben geworfen haben. Damit hebt eine Reihe von historischen Berichten an, die man unter »Dichtung und Wahrheit« subsumieren kann. Das führt uns auf Gebiete außerhalb Wiens, aber bald kehren wir zurück.
Die erste Unwahrheit ist die, jahrhundertelang auch in Schulen verbreitete, Behauptung, Österreichs Farben Rot-Weiß-Rot hätten ihren Ursprung in Akkon. Herzog Leopold habe löwengleich den ganzen Tag lang gekämpft und sich am Abend von seiner Berufskleidung befreit. Über der Rüstung trug er das weiße Kleid des Kreuzritters, nun nahm er seinen Gürtel ab – und darunter war der Stoff noch weiß, aber der große Rest war vom Blut der Feinde rot. Aha, wird Leopold V. gesagt haben, gar nicht schlecht, da haben wir also eine schöne Fahne.
Doch die babenbergischen Farben waren Rot-Silber-Rot, und im silbernen Kleid wird selbst der Herzog nicht gekämpft haben. Und wenn es wirklich so gewesen wäre, hätten auch andere größere und kleinere Länder den österreichischen Bindenschild als Symbol, denn die übrigen Ritter haben sicher nicht untätig zugesehen, wie ihnen der Herzog von Österreich die Eroberungsarbeit abnimmt. Babenbergs Farben waren außerdem schon zuvor in Gebrauch.
Auch die angebliche Folge des Fahnenstreits, die Fehde zwischen König Richard und Herzog Leopold, ist eine Legende.
Leopold V. verließ Akkon und das Heilige Land und zog nach Hause. Im Spätherbst 1191 war er wieder in Wien. Auch die Engländer hatten ihren Kreuzzug beendet, ohne ihr Ziel, Jerusalems Eroberung, zu erreichen. Der König reiste zu Schiff in Richtung Frankreich, um heimzukehren.
Nun hatte er sich aber kurz vorher mit dem früheren Verbündeten Philipp II., Frankreichs König, verfeindet. Der ließ seine Häfen für englische Schiffe sperren, ein anderer Weg musste gefunden werden. Also fuhren die Engländer über die Adria – da entstanden weitere Legenden, von Schiffbruch bis zum Überfall durch Piraten. Wie auch immer, Richard reiste weiter nach Kärnten, in Friesach erkannte man ihn – und hätte ihn beinahe festgenommen.
Doch er reiste unbehelligt weiter, wollte über Wien nach Bayern, zu seinem Schwager Heinrich dem Löwen. Offenbar wusste er noch nicht, dass er auf der Fahndungsliste stand. Kaiser Heinrich VI. hatte Richards Festnahme mit Philipp, dem König von Frankreich, verabredet. Die Gründe dieser Abmachung führen zu weit weg vom Thema, also weiter: Richard ahnte wohl auch nicht, wie weit Leopolds Abneigung gegen ihn und Treue zum Kaiser führen könnten. Sonst hätte er kaum die Reiseroute über die Residenzstadt Wien gewählt. Jedenfalls – und das ist historisch außer Zweifel – kam er bis Erdberg, nunmehr ein Ortsteil des 3. Bezirks. Dort erkannte man ihn, der sich als einfacher Pilger getarnt hatte, in einem kleinen Gasthaus an der Ecke Erdbergstraße 41 und Schwalbengasse 17. Ein Reisegefährte soll Lebensmittel in großer Menge gekauft und in fremder Währung bezahlt haben. Am 21. Dezember 1192 wurde der König festgenommen und zu Herzog Leopold gebracht. Da standen die beiden Widersacher von Akkon einander wieder gegenüber, der mit dem Löwenherzen und der Tugendreiche.
Nach wenigen Tagen brachte man den Engländer auf die Burg Dürnstein, und der Babenberger meldete dem Kaiser die Gefangennahme. Schon am 27. Dezember traf die gute Nachricht bei Heinrich VI. ein. Der Meldereiter muss seinen Beruf beherrscht haben, notabene bei den damaligen Straßen und Ende Dezember!
Jetzt kommen wir zur nächsten Geschichtsfälschung. 1851 ist die Geschichte der Wiener Stadt und Vorstädte von Albert A. Wenedikt erschienen. In diesem Jahr hat der Tourismus in Österreich schon eine beachtlichen Umsatz gemacht. Da liest man: »Bis vor einigen Jahren hatte man – leider anstandslos – die unerhörte Frechheit, im Schlosse Greifenstein an der Donau (!!!) einen hölzernen engen Käfig, beiläufig Schweinestall, als Richards Gefängnisort den fremden Besuchern zu zeigen. Die Engländer schnitten sich, man könnte sagen balkenweise, Späne zum Andenken herunter und bewahrten solche als heilige Reliquien auf, trotzdem augenscheinlich von Zeit zu Zeit das Material sich als nagelneu angefertigt zeigte. Wie sinnlos und der geschichtlichen Wahrheit widersprechend diese Erzählung, zeigt der Brief Richards aus der Gefangenschaft an seine königliche Mutter, in welchem er ausdrücklich erwähnt, vom Herzoge in der ehrenhaftesten Art gehalten zu werden.«
Greifenstein einfach für das wahre Dürnstein zu erklären, ist schon sehr kühn. Schließlich erscheint auch noch der treue Hofsänger Blondel auf der Szene, der sich von Burg zu Burg singt, bis er seinen König gefunden hat: auch das ein Märchen.
Tatsächlich war Richard Löwenherz fast drei Monate in Leopolds Hand, am 28. März wurde der Gefangene dem Kaiser übergeben und in die Reichsburg Trifels im Pfälzer Wald gebracht. Die Bedingung dafür war der Vertrag über die Aufteilung des zu erwartenden Lösegelds gewesen. Heinrich VI. und Leopold V. bekamen jeweils die Hälfte. 23,3 t Silber hatten sie in langen Verhandlungen den Engländern und den französischen Verwandten Richards abpressen können, eine riesengroße Summe, deren heutiger Wert sich schwer schätzen lässt. Sie soll den Einkünften von zwei Jahren des englischen Staatshaushalts entsprochen haben und stürzte das Land in eine schwere Krise. Mit dem Reichstag in Mainz im Februar 1194 endete Richards Gefangenschaft.
Der Kaiser brauchte das Geld für einen Feldzug gegen das aufständische Sizilien. Herzog Leopold V. aber verwendete seinen Teil in einer Weise, die heute mit dem Modewort Nachhaltigkeit bezeichnet würde. Er ließ den alten Stadtgraben zuschütten, der von der Freyung bis St. Stephan verlief. Und er gab Wien eine moderne Stadtmauer, deren Dimensionen sich bis ins 19. Jahrhundert nicht änderten.
Das war noch lange nicht alles – Leopold gründete südlich von Wien eine neue Stadt, die auch so genannt wurde: Wiener Neustadt. Das kleine Friedberg bekam eine Stadtmauer, und Hainburgs Befestigungen wurden ausgebaut.
In dieser spannenden Zeit florierender Wirtschaft, in den Jahren zwischen 1189 und 1194, wurde in Wien eine Münzprägestätte gegründet, ältere bestanden in Enns, Krems und Fischau. Damals gab es schon eine kleine jüdische Gemeinde, der erste in Urkunden genannte Name eines Juden war Schlomo, das meint Salomon. Er hatte das Amt des Münzmeisters inne, also die Leitung der gerade gegründeten Wiener Prägestätte. Das Lösegeld für Richard Löwenherz wurde von ihm verwaltet. 1194 erscheint sein Name, wir wissen aber nur wenig von ihm. Er diente unter Leopold V. und danach unter Friedrich I. In der Seitenstettengasse, neben der Ruprechtskirche, besaß er vier Grundstücke, in der Gegend des Judenplatzes. Das war die Basis des ersten Wiener Ghettos, mit der ersten Synagoge 1204. Eine Gruppe von Kreuzfahrern, die auf ihrem Heinweg durch Wien kamen, hat Schlomo und seine Familie 1197 ermordet – dazu noch weitere Personen, insgesamt waren es 16. Das war zwar das erste, aber lange nicht das letzte Unglück, das die Wiener Judengemeinde getroffen hat.
Allerdings waren die Babenberger ungewöhnlich judenfreundlich. Ihre »Judenordnung« war die toleranteste Minderheitenregelung im deutschsprachigen Raum. Auf die Schändung jüdischer Friedhöfe und die Ermordung jüdischer Mitbürger stand die Todesstrafe. In den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts wurde Wien zu einem geistigen Zentrum des Judentums. Der jüdische Friedhof lag in der Nähe des Kärntnertors. Auch in den wenigen Jahren der Herrschaft Ottokar Přemysls florierte die jüdische Gemeinde und wuchs zur größten im deutschen Sprachraum.
Das änderte sich freilich ab dem Jahr 1267. Das vierte Laterankonzil hatte im Jahr 1215 in seinem Canon Nr. 68 den christlichen Gemeinden vorgeschrieben, an Juden keine öffentlichen Ämter zu vergeben. Schon damals wurde bestimmt, dass Juden und Moslems sich einer Kleiderordnung zu unterwerfen hätten. Diese Regelungen wurden nun verschärft. Juden durften keine Bäder und keine Gasthäuser betreten, sie durften keine christlichen Dienstboten beschäftigen, nicht am Handel teilnehmen, kein Gewerbe ausüben und keine Landwirtschaft betreiben – so blieb ihnen nur das Geldgeschäft und der Altwarenhandel. Vor allem aber mussten sie einen gelben spitzen Judenhut tragen – und dem Pfarrer eine Steuer bezahlen, die Stolgebühr.
Am 31. Dezember 1194 starb Herzog Leopold mit erst 37 Jahren in Graz, nach einem ungemein reichen Leben. Er hatte bei einem Turnier einen offenen Beinbruch erlitten, an dessen Folgen er verstarb. Ihm folgte sein Sohn Friedrich I., der nur kurz der Regent von Ostarrichi war – von 1194 bis 1198. Zu den von seinem Vater übernommenen Problemen zählte das Vorhaben, zu einem neuen Kreuzzug auszurücken. Leopold V. hatte das, vom Bannstrahl des Papstes getroffen, versprochen. Der Sohn begann also, das Versprechen einzulösen – aber es gelang ihm nur zum Teil. Er reiste ab – und starb auf der Reise.
Ihm folgte Leopold VI., sein jüngerer Bruder. Er erwies sich als echter Glücksfall für sein Land und besonders für dessen Hauptstadt. Seine Regierungszeit währte von 1198 bis 1230, sein Beiname wurde »der Glorreiche«. Wien wurde erweitert, seine Grundfläche verdoppelt. Im Jahr 1221 bekam Wien zusammen mit dem Stadtrecht das Stapelrecht. Das war eine wichtige Maßnahme auf dem Weg zum Wohlstand. Während wir heute unter dem Transitverkehr stöhnen, der Österreichs Autobahnen belastet, war damals der Transit vor allem von Bayern und da wieder aus Regensburg nach Ungarn und weiter ostwärts ein Segen. Wer über die Wiener Route exportieren wollte, musste seine Ware zwei Monate lang den hiesigen Kaufleuten anbieten. So wurden Felle, edle Tuche, Edelmetall hier gelagert, Wiens Wirtschaft erlebte dank dem florierenden Zwischenhandel einen lang anhaltenden Aufstieg. Andere Städte des Reichs erlangten dieses Stapelrecht erst ab der Mitte des 13. Jahrhunderts, wie die norddeutschen Hansestädte. Das Stadtrecht Wiens hatte unter anderem zur Folge, dass ein Rat von 24 Bürgern – allesamt erfolgreiche Handelsleute – in Wirtschaftsfragen ein Mitspracherecht erhielt.
Leopold VI. förderte auch die Kunst seiner Zeit – Walther von der Vogelweide und Reinmar von Hagenau waren ständige Artists in Residence, Ulrich von Liechtenstein und Neidhart von Reuental gaben am Herzogshof Gastspiele. Letzterer freilich wurde erst unter Leopolds Sohn Friedrich zum Wahlwiener.
Leopold war wie schon sein Großvater Heinrich Jasomirgott mit einer byzantinischen Prinzessin verheiratet, Theodora, einer Enkelin des Kaisers Isaak II. Angelos. Mit diesen beiden, seiner Großmutter und seiner Ehefrau, kam eine Atmosphäre von Internationalität am Herzogshof auf. Die Damen brachten aus ihrer fernen Heimat einen kleinen Hofstaat mit, Zofen, Kindermädchen, vielleicht auch Rezepte. Das sei die Wurzel des Wiegenliedes Heidschi, Bumbeidschi gewesen, hört man in Wien. Aber die wirklichen Byzantinisten sind nicht dieser Meinung, das sei eine Erfindung.
Leopold dachte jedenfalls nicht in lokalen oder regionalen Bahnen, sein Horizont war weiter. Seine Grundhaltung war auf Harmonie und Ausgleich gerichtet. In der langjährigen Auseinandersetzung zwischen Papst Innozenz und Kaiser Friedrich II., die bis zur Exkommunikation Friedrichs geführt hatte, wusste er zu vermitteln. 1230 zog er nach Italien, in San Germano wurde verhandelt.
Stift Klosterneuburg. Babenbergerstammbaum: Papst Gregor IX., Herzog Leopold VI., Kaiser Friedrich II.
Wer auf seinen Spuren diesen Ort sucht, wird ihn nicht finden. Der Name kommt in Italien mehrfach vor, unser San Germano wurde 1863 auf seinen früheren Namen Cassino umbenannt. Das Städtchen liegt 130 km südlich von Rom, an der Autobahn A1, der Strada del sole. Dort traf der Babenberger Leopold VI. Papst Gregor IX. und den Staufer Friedrich II.
Ende August waren die zähen Verhandlungen beendet, es kam zur Versöhnung. Das war der letzte Staatsakt des Herzogs – in San Germano ist er gestorben. Damit war nach einem Vierteljahrtausend die Epoche der Babenberger beinahe zu Ende, mit einer Glanzzeit des Landes und seiner Hauptstadt. Dem Glorreichen folgte »der Streitbare«, Friedrich II.
Manche dieser von der Nachwelt ersonnenen Beinamen sind schwer nachvollziehbar – andere hingegen treffen tatsächlich einen wesentlichen Charakterzug. Herzog Friedrich II. war außerordentlich streitbar, sein kurzes Leben lang. Er kam am 12. Juni 1211 in der Burg von Wiener Neustadt zur Welt, seine Brüder starben früh und er erbte – zwar das Land seines Vaters, aber nicht dessen Weitblick und diplomatisches Geschick. Schon als Jüngling übte er sich in Opposition gegen seinen Vater, weit über das gewöhnliche Maß von Generationenkämpfen hinaus.
Mit 19 Jahren kam er an die Macht, und sogleich gab es innenpolitische Probleme. Das mächtige Geschlecht der Kuenringer hatte treu zu Friedrichs Vorgängern gehalten – nun stellten sie sich gegen den neuen Landesherrn an die Spitze einer großen Gruppe Adeliger. Sie blieben nicht alleine, der junge Herzog hatte bald nur mehr Gegner, in allen Ständen.
Er suchte förmlich nach Feinden. Sein Vater Leopold VI. hatte zu den benachbarten Ungarn gute Beziehungen gehabt, er war mit König Andreas II. 1217 zum Fünften Kreuzzug aufgebrochen. Friedrich brach diesen Frieden unmittelbar nach Andreas’ Tod 1235 und fiel in Ungarn ein, mit dem Ziel, die Stephanskrone zu erobern. Das ist wörtlich zu nehmen, nicht nur symbolisch. Denn der Besitz der Krone bedeutete den Ungarn tatsächlich die Königswürde.
Béla IV., der Kronprinz und nunmehr neue ungarische König, hatte sowohl das Recht als auch, wie der Aggressor schnell erkennen musste, die Macht auf seiner Seite. Sein Heer besiegte den Babenberger, schlug ihn in die Flucht und verfolgte ihn fast bis Wien. In ihm hatte Friedrich einen Gegner, den die Mitwelt wie die Nachwelt verehrte – Venerabilis, der Verehrungswürdige, ist sein Beiname. Bei dieser Gelegenheit, auch wenn das aus Wien hinausführt: Eine von Bélas Schwestern wurde und wird von den Magyaren innig verehrt, Elisabeth die Heilige. Sie war mit dem Landgrafen von Thüringen verheiratet und lebt seit Jahrhunderten in der Erinnerung der Ungarn wie der Thüringer.
Da hatte sich Friedrich II. also keinen einfachen Gegner ausgesucht. Seine Hauptstadt Wien wurde zwar nicht eingenommen, jedoch nur gegen hohe Reparationszahlungen – die durch Steuererhöhungen aufgebracht werden sollten. Aufgebracht waren aber nun die Wiener, die keinen Sinn für die Machtspiele ihres Herrn hatten. Der hatte sie schon auf vielfache Weise geärgert – so hatte er sie etwa um ein Schauspiel gebracht, und das wird einem hier nicht leicht verziehen. In den ersten Maitagen des Jahres 1234 richtete Friedrich II. für seine Schwester Konstanzia ein prachtvolles Hochzeitsfest aus, mit zahlreicher Prominenz und mit Ritterspielen. Bräutigam war Markgraf Heinrich von Meissen. Aber es fand nicht in Wien statt, was man doch hätte erwarten können, sondern im kleinen Stadlau.
Was immer den Herzog zu der ärgerlichen Entscheidung bewogen haben mochte, sie trug zum latenten Zwist bei. Und nun die Forderung, die Wiener Bürger für Friedrichs ungarisches Kriegsspiel bezahlen zu lassen!
In großer und seltener Einhelligkeit wandten diese sich an die nächste Instanz, den Kaiser. Ihre Stadt hatte in den Jahrzehnten unter Leopold VI. in langen Friedensjahren an Bedeutung und Bevölkerung stark zugenommen, sie stand nach Köln an zweiter Stelle im Reich. Der Kaiser, auch er ein Friedrich II., gab den Wienern recht und verhängte über seinen Namensvetter 1236 die Reichsacht. Seit 1220 folgte dem Kirchenbann automatisch die Reichsacht – so war man »in Acht und Bann getan«. Das immerhin blieb dem Babenberger erspart, doch er war seines Lehensrechts verlustig gegangen.
Das war dem jungen Neustadt, das seinen Zusatz »Wiener« erst im 17. Jahrhundert bekommen hat, ziemlich egal. Man nahm den Sohn des Gründers – Leopold VI. hatte 1195 zu bauen begonnen – mit Ehren in seiner Geburtsstadt auf. Und obwohl der Rechtlose an sich nichts zu melden, geschweige denn zu vergeben hatte, wurde nun das Münzrecht den Fischauern weggenommen und auf Neustadt übertragen, das Marktrecht hatte die Siedlung schon. Der Kaiser beauftragte den Herrscher von Böhmen, Wenzel I., seinen aufmüpfigen österreichischen Kollegen zur Vernunft zu bringen, der tat wie geheißen und eroberte Niederösterreich und damit auch Wien.
1236 zog der Kaiser mit seinem Heer nach Wien, im Jänner 1237 bereitete ihm die Stadt einen festlichen Empfang. Das dürfte Friedrich gefallen haben, er blieb beinahe ein halbes Jahr. Und er brachte als Gastgeschenk die Erhebung zur Freien Reichsstadt mit. Das bedeutete etliche neue Privilegien, die freilich viele andere Städte schon lange innehatten, weit kleinere wie Memmingen, Dinkelsbühl oder Rothenburg ob der Tauber.
Nunmehr konnte der Landesherr neue Steuern nur noch mit Zustimmung des Stadtrates einheben, die Stadträte erhielten auch ad personam weitere Rechte.
Der kaiserliche Glanz war nicht von Dauer. Der Kaiser rückte mit seinen Truppen ab, der Herzog rückte heran, auch er mit seinen Truppen. Diese verweigerten wie die Neustädter den Gehorsam nicht und schlugen sich erfolgreich gegen die Kaiserlichen. Wien wurde 1238 belagert, monatelang. Im Dezember 1239 war es mit dem Mut vor dem Fürstenthron vorbei, da konnte auch der vom Kaiser zurückgelassene Reichsverweser nicht helfen, der Hunger schlug die Stadt, sie musste aufgeben. Bald darauf versöhnten sich die beiden Friedriche.
Nun hätte man ein Donnerwetter erwarten können, doch es blieb aus. Die Reichsunmittelbarkeit war freilich zur lieben Erinnerung geworden, nach kaum drei Jahren. Die Regierung führte wieder der Landesherr. Bei den Steuern ließ er sich auf keinen Kompromiss mit dem Wiener Stadtrat ein. Nach seiner Rückkehr aus Neustadt war Friedrich in mancher Hinsicht großzügig gewesen, aber nicht auf diesem Gebiet. Die Steuern, die zuallererst die Reichen trafen, wurden neu festgesetzt – auf merkwürdige Weise. Der Herzog saß auf seinem Thron, daneben hatte man einen breiten Vorhang aufgezogen. Hinter diesem Vorhang saß ein gut informierter Wiener aus allerbesten Kreisen, aber offenbar nicht von allerbestem Charakter. Er hieß übrigens Wolfgang von Parau. Nun traten die Patrizier in langer Reihe vor ihren Landesherrn, nannten ihre Namen und der Steuerspitzel gab aus seinem Versteck flüsternd die jeweiligen Vermögensverhältnisse an. Und Friedrich bestimmte willkürlich die Steuerhöhen. Ob das nur aus Akten zu entnehmen ist oder ob der Name des liebenswürdigen Mitbürgers allgemein bekannt wurde, wissen wir leider nicht.
Friedrich bestätigte den Wienern sogar manche Privilegien seines Vaters, ja mehr noch, er wollte Wien endlich zu einem eigenen Bistum verhelfen. Friedrichs Hauptstadt hatte keinen eigenen Bischof, sie gehörte zum Bistum Passau. Der Herzog, dem der eigene Rang ebenso wichtig war wie jener der Residenz, wie später auch dem Habsburger Rudolf IV., trat in Verhandlungen ein. Aber er scheiterte, wie auch in den nächsten Jahrzehnten seine Nachfolger, bis zum Jahr 1469.
Einmal soll Friedrich II. aber seinen Zielen, dem Bistum Wien und dem Königsrang, recht nahe gewesen sein, auf seltsamem Weg. Sein versöhnter Kaiser war ein bekannter, ja berüchtigter Frauenfreund, dessen diesbezügliche Interessen auch mit den Jahren nicht erlahmten. Dafür hatte der Herzog wohl Verständnis, denn ihm erging es nicht anders. Der Journalist und Historiker Thomas Chorherr hat den Babenberger mit dem Herzog von Mantua aus Verdis Rigoletto verglichen, hat ihn einen Hallodri genannt. Der Aufstand der Wiener gegen ihren Herzog im Jahr 1236 war nicht zuletzt durch sein Benehmen gegenüber den Bürgerinnen bei einem Tanzfest ausgelöst worden, das hatte das Fass zum Überlaufen gebracht.
Kaiser Friedrich II. also hatte wenigstens 20 Kinder, mit 13 Frauen. Kirchliche Quellen sprechen von höheren Zahlen, doch dahinter steckte wohl der päpstliche Geheimdienst. Als dreifacher Witwer fasste der Staufer den Plan, die Achse zu dem tatkräftigen Babenberger zu verstärken. Er war, Jahrgang 1194, auf den Gedanken gekommen, sich mit Gertrud, Jahrgang 1226, der Nichte des Herzogs, zu vermählen. Als Morgengabe hatte er ein ganz großes Geschenk für die Braut, den Onkel, das Land vorgesehen. Österreich sollte aus einem Herzogtum zu einem Königreich werden. So würde es endlich neben den benachbarten Königen von Böhmen und Ungarn den König von Österreich geben, mit Gertrud als Gegenleistung.
Der Onkel hatte klarerweise keinen Einwand, also wurde ein Vertrag vorbereitet, in dem das Mädchen als futura consors nostra bezeichnet wird, als »unsere künftige Gattin«. Auf dem Hoftag von Verona im Juni 1245 sollte der Vertrag unterschrieben werden. Die Großen des Reichs versammelten sich – der Kaiser, die Erzbischöfe, der Vertreter des byzantinischen Kaisers, natürlich auch der Herzog von Österreich, in aller Pracht, mit großem Gefolge. Aber die Braut kam nicht.
Man weiß nicht, ob ihr der 51-Jährige zu alt war, ob sie sich wegen der zahlreichen Gerüchte über Affären des »kaiserlichen Wüstlings« um ihre Zukunft Sorgen machte oder ob sie den schon zuvor mit ihr verlobten böhmischen Königssohn Vladislav einfach lieber hatte, jedenfalls war sie nicht da. Das muss für den Babenberger sehr peinlich gewesen sein. Kopfschüttelnd wird diese G8-Versammlung des Mittelalters auseinandergegangen sein.
Gertruds unerklärliche Absenz hatte für Österreich weitreichende Folgen. Wien wurde nicht Residenz eines Königs, nichts war es mit dem Königsrang, für immer. Denn auch wenn Franz II. sich 1804 zum Kaiser von Österreich ausgerufen hatte, das alte Kernland der Babenberger blieb Erzherzogtum. Denn »Österreich« meinte 1804 das Ganze. So war also auch noch der letzte Kaiser von Österreich, Karl I., zwar König von Böhmen, König von Ungarn, König von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien, Illyrien, König von Jerusalem, aber Erzherzog von Österreich.
Der von der Braut versetzte Kaiser Friedrich heiratete eine seiner Geliebten und starb 1250. Und der Onkel Herzog? Auch er gab klein bei und hatte zudem schon wieder andere Probleme.
Er stand vor einem Zweifrontenkrieg mit den Nachbarn, wieder einmal mit dem Böhmenkönig Wenzel I. und mit Béla IV., seinem lang erprobten ungarischen Widersacher. Das böhmische Heer wurde 1246 bei Staatz besiegt, bevor es auch nur in Wiens Nähe gekommen war. Aber der böhmische Thronfolger bekam seine österreichische Braut, die eigenwillige Gertrud heiratete ihn im selben Jahr.
Dieses Jahr wurde Friedrichs letztes. Er zog wieder gegen die Ungarn ins Feld, stand selbst vorne an der Front, wie das vor Zeiten üblich war, und starb am 15. Juni 1246. Ob er in der Schlacht an der Leitha, in der Nähe von Pottendorf, im ritterlichen Kampf gegen den Feind fiel oder ob ihn der Tod aus den eigenen Reihen ereilte, darüber herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Friedrich soll die fliehenden Ungarn verfolgt haben, vom Pferd gestürzt sein, dann wurde er erschlagen oder durch einen Lanzenstich ins Auge getötet.
Stift Heiligenkreuz, Kapitelsaal, Hochgrab Friedrichs II. des Streitbaren
Er hatte sich nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch im Inneren immer wieder Feinde gemacht. Zwar verstand er es, die Tradition seines Vaters und des Großvaters weiterführend, auch zu feiern, doch das war die Ausnahme.
Friedrich II. bekam ein bis heute eindrucksvolles Hochgrab im Kapitelsaal von Stift Heiligenkreuz. Dieser Gründung seines heiliggesprochenen Ahnherrn Markgraf Leopold war er stets ein großzügiger Förderer gewesen.
Franz Grillparzer hat sich in seinen Gedichten zu vielen Themen geäußert. Nennt man ihn einen allzu trockenen Poeten, so tut man ihm unrecht und weiß zu wenig. In der Liste seiner Lyrik finden sich Titel wie An meinen Schreibtisch oder Beim Tod einer Fliege. Den toten Herzog Friedrich hat Ulrich von Liechtenstein besungen, über den äußerst lebendigen Friedrich hat Grillparzer gedichtet:
Ein Herzog war in Österreich
Herr Friederich genannt.
Dem tat so leicht es keiner gleich
Im ganzen deutschen Land.
Wenn er erschien, da ward ringsum,
Soweit sein Fußtritt klang,
Mit eins der lautste Prahler stumm
Und auch der Kühnste bang.
Doch kannte auch der Mägdlein Schar
Des Starken Sporenklang,
Und mancher, die fast trotzig war,
Ward, wenn er nahte, bang.
Auch der Minnesänger Neidhart von Reuental hat Friedrich II. in vielen Liedern auftreten lassen. Er preist ihn für seine Großzügigkeit – der Herzog hat ihm ein Haus »am Lengenbach« geschenkt. Diese Ortsangabe wird mit Neulengbach oder Altlengbach gedeutet. Neidhart war sehr produktiv – 132 Lieder sind erhalten, 55 davon mit der jeweiligen Melodie.
Der letzte Babenberger war tot. Lange Jahre der Unsicherheit, der Unruhe folgten. 1250 starb auch der andere Friedrich II. und eine Epoche begann, die in die Geschichte als »die kaiserlose, die schreckliche« eingegangen ist. Der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein beschrieb, wie es weiterging:
Gott muez sin pflegen, er ist nun tot,
sich hob nach ihm viel groziu not
zu Stire und ouch zu Oesterrich,
da war maneger arm, der eher was rich.
Fuer war ich ju daz sagen will,
nach ihm geschah unbildes vil:
man roubt die lande nacht und tac
da von vil Dörfer wueste lag.
Er war nicht verwandt mit dem österreichisch-böhmischen Geschlecht der Liechtensteiner. Seine Besitzungen lagen in der Steiermark, wo er zeitlebens (1200–1275) hohe Ämter innehatte. Er wusste also, wovon er sprach. Hat er sich sonst mit der Minne befasst, dem »Frauendienst«, so beklagt er hier die politischen Zustände. Mit »Stire« ist Steyr gemeint und damit das ganze Land, nun Oberösterreich. Die Stadt hatte eine glänzende Vergangenheit erlebt, das war mit Friedrichs Tod vorbei.
Österreich, das Reichslehen, fiel zurück ans Reich. Hatte Kaiser Friedrich noch vor wenigen Jahren Wien seine Huld gewährt, jetzt konnte er nichts mehr gewähren, er steckte in zahlreichen Problemen im italienischen Teil seines Reichs. Die Schwester des verstorbenen Herzogs, der keine Erben und kein Testament hinterlassen hatte, Margarete, und seine Nichte hatten zwar durch die Bestimmungen des Privilegium minus Anspruch auf Babenbergs Länder, aber der Kaiser entschied anders. Friedrich II. schickte Statthalter – Graf Otto von Eberstein erschien 1247 in Wien, an das er keine gute Erinnerung haben konnte. Der Kaiser hatte ihn schon früher hierhergesandt, um den geächteten Babenberger Friedrich in die Schranken zu weisen – doch der Streitbare hat zweimal in der Schlacht gesiegt.
Auch diesmal hatte Otto von Eberstein keinen Erfolg in Wien, er erkannte, dass eine provisorische Regierung keine Zukunft haben konnte, und gab auf. Der Kaiser sandte den nächsten Statthalter, Otto von Bayern. Neuerlich hatte er keine glückliche Wahl getroffen. Denn die Treue des Bayern zum Kaiser, den der Papst mit dem Bann gestraft hatte, führte zum gleichen Schicksal für den neuen Statthalter.
Den Österreichern reichte es. 1251 wählten die Stände den kaum 20 Jahre alten Sohn des Königs von Böhmen zum Herzog, Ottokar Přemysl. Diese Wahl erwies sich binnen kurzer Zeit als glückliche. Der Jüngling kam in Wien mit dem Rang eines Markgrafen von Mähren an, wurde von den Ständen zum Herzog ernannt und heiratete 1252 die tatsächliche Erbin Margarete, des Streitbaren Schwester. Ottokar war 20, Margarete 48 Jahre alt.
Der Böhme wurde trotz seiner Jugend von den Wienern geachtet, er zeigte sich umsichtig und hilfsbereit. Als Wien 1276, nach 1258 und 1262, erneut brannte, traf er rasch Maßnahmen. Er sorgte für Holz, das damals wichtigste Baumaterial, und den Wiederaufbau der Stephanskirche. Und er begann mit dem Ausbau der Neuen Burg, deren Grundstein schon Leopold VI. gelegt hatte. 1257 wurde das Bürgerspital vor dem Kärntnertor gegründet, keine Krankenanstalt im heutigen Sinne, sondern ein Versorgungsheim. 1267 errichtete man das Siechenheim »Zum Klagbaum« auf der Wieden, zur Pflege Aussätziger.
Die oberen Zehntausend hatte der Böhme auf seiner Seite, darunter den wichtigsten Bürger Wiens, Paltram vor dem Freithofe. Dieser war nicht nur außerordentlich reich, er war auch im Besitz wichtiger Ämter – als Richter, was dem Bürgermeister entsprach, als Amtmann. Und er war als Kaufmann erfolgreich, er belieferte Ottokars Heer mit Lebensmitteln. Hier sei er besonders erwähnt, weil von ihm nicht nur Kenner der Wiener Geschichte wissen, sondern auch Theaterfreunde – er tritt bei Grillparzer auf, in König Ottokars Glück und Ende. Aber dazu wollen wir später kommen, wenn wir bei Rudolf I. anlangen.
Ebenso wie um das Wohl seiner Bürger kümmerte sich Ottokar Přemysl auch um sein eigenes und die Erweiterung seiner Macht. Dafür zog er immer wieder in den Krieg, 1254 nach Polen, 1260 gegen die Ungarn.
Im Frieden von Ofen war 1254 ein Großteil der Steiermark an Ungarn gefallen. Der steirische Adel stand hinter dieser Entscheidung, dem Böhmen Ottokar war man bis zu seinem Ende kein Freund. Damit verlor Steyr seinen Rang als Herzogssitz und war auch von der Einnahmequelle Erzberg abgeschnitten. Auf diesen Kummer seines Heimatlandes bezog sich Ulrich von Liechtensteins Erwähnung von »Stire«. Doch mit Ottokars Sieg 1260 ging die Steiermark den Ungarn wieder verloren – die Stadt Steyr aber blieb beim Land ob der Enns.
Der Machtbesessene strebte weiter und weiter – mit allen Mitteln. Seine Ehefrau Margarete hatte die Basis seines Anspruchs auf die Babenberger-Lande geliefert. Nun hatte Ottokar andere Präferenzen. Der gerade geschlossene Friede mit Ungarn sollte gesichert werden. Er ließ sich von Margarete scheiden und heiratete König Bélas Enkelin Kunigunde. 1267 brach Ottokar in den Kampf nach Litauen auf. 1269 erbte er Kärnten und die Krain, zum heftigen Unwillen des heimischen Adels.
1273 war es so weit: Die vielen Feinde, die Ottokar Přemysl sich in den eigenen Ländern und unter den weltlichen und geistlichen Fürsten des Reichs gemacht hatte, sahen ihre Stunde gekommen. Die langen Jahre der Unruhe sollten ein Ende haben. Man setzte für den Herbst 1273 einen neuen Termin für die Wahl eines römisch-deutschen Königs an. Die sechs anwesenden Kurfürsten trafen eine ungewöhnliche Entscheidung – sie berücksichtigten nicht das Wahlrecht Ottokars, des siebten Kurfürsten, der durch den Herzog von Niederbayern Heinrich XIII. ersetzt wurde. Die Macht des Böhmen war so stark gewachsen, dass sie den Nachbarn unheimlich geworden war: Ottokar Přemysls Herrschaft reichte vom Norden Böhmens bis an die Adria.
Der König von Böhmen erschien nicht in Frankfurt, vermutlich war er sich seiner Königswahl so sicher. Doch es kam anders. Am 1. Oktober 1273 wurde der aus dem Südwesten des Reichs kommende Graf Rudolf von Habsburg gewählt.
Ottokar war aufs Äußerste getroffen. Er wollte die Wahl nicht anerkennen, doch es kam noch schlimmer. Der neue König machte Ordnung – wer sich ein Reichslehen ohne Berechtigung angeeignet hatte, sollte es zurückgeben. Ottokar aber wollte seinen Besitz wahren. Vor dem Reichsgericht unterlag er im Streit um das von ihm besetzte Egerland. Nun wurde die Reichsacht über ihn verhängt. Daraufhin begannen in fast allen seinen Landesteilen Unruhen, die schon lange oppositionellen Adeligen sahen ihre Stunde gekommen.
Ab 1276 wurde Krieg gegen Ottokar geführt. Rudolf von Habsburg marschierte mit dem Reichsheer entlang und per Schiff auf der Donau bis Wien – dessen Tore für ihn verschlossen blieben. Den Wienern war die gute Erfahrung mit dem Böhmen lieber als die unsichere Zukunft mit dem Süddeutschen, dem »Schwaben«, wie man ihn hier bald nannte. Der mächtige Paltram leitete erfolgreich die Verteidigung. Sie hielten einige Monate lang durch, dann gaben sie auf. Die Lebensmittel waren knapp geworden, es gab keine Aussicht auf Entsatz – durch wen auch? – und damit keine Zukunft.
Am 21. Oktober 1276 wurde Frieden geschlossen. Ottokar musste klein beigeben. Die Wiener aber waren bereit, auch weiterhin zu ihm zu stehen. Obwohl Rudolf mit seiner Ritterschar in die Stadt eingezogen war, kam sie nicht zur Ruhe. Paltram blieb aufseiten des böhmischen, nicht des römischen Königs, ja, er bereitete einen Aufstand vor.
Franz Grillparzer: König Ottokars Glück und Ende. Aufführung anlässlich der Wiedereröffnung des Burgtheaters am 15. Oktober 1955, mit Attila Hörbiger (Rudolf von Habsburg) und Ewald Balser (Ottokar Přemysl)
Davon ahnte der Habsburger nichts. Er setzte den 25. November 1276 für die Kapitulation seines hartnäckigen Gegners an. Sie sollte öffentlich stattfinden. Ottokar erschien – würdevoll, reich gewandet, mit großem Gefolge. Und er traf auf einen Mann, der in einfacher Kleidung auf einem Holzschemel saß. Und von dem sollte er sich nun belehnen lassen, ihm sollte er huldigen … Natürlich war das eine gezielte Beleidigung, eine Demütigung vor aller Augen. Mit gebeugtem Knie musste Ottokar den Lehensakt ertragen. Diese Geste, der Empfang des Lehens auf Knien, fand zum ersten Mal in der Geschichte statt. Danach war die Reichsacht aufgehoben, man machte Hochzeitspläne, die den jungen Frieden zwischen Přemysliden und Habsburgern festigen sollten. Aber es kam nicht dazu.
Rudolf war um Eintracht mit den widerspenstigen Wienern bemüht. Er bestätigte alte Privilegien, gab der Stadt die verlorene Reichsunmittelbarkeit zurück. Das machte offenbar den gewünschten Eindruck. Der immer noch obstinate Paltram hatte nun mit seinem lang vorbereiteten Aufstand keinen Erfolg, man unterstützte ihn nicht, er musste aus der Stadt flüchten.
Derartige Verbündete hatte Ottokar nach wie vor, trotz des Lehensaktes gab er nicht auf. Weil die Details zu weit von Wien wegführen, greifen wir zur Kurzform: Der römische König und der gedemütigte Böhme bereiteten wieder einen Krieg vor, sammelten Mitstreiter. Rudolf vertraute auf die habsburgische Hausmacht und hatte im König von Ungarn einen starken Verbündeten, rund 30 000 Mann warteten vier Tage lang auf den Gegner im Marchfeld, vor Wiens Toren. Ottokar trat mit einem ungefähr ebenso großen Heer zur Schlacht an – am 26. August 1278 bei Dürnkrut und Jedenspeigen.
Beinahe wäre der Kampf für den Habsburger tödlich ausgegangen, er war von seinem verwundeten Pferd gestürzt und wurde im letzten Moment von Heinrich von Ramschwag, einem Ritter aus dem Thurgau, einem engeren Landsmann also, gerettet.
Die Schlacht hätte Rudolf nicht gewonnen, hätte er nicht die leichten, wendigen ungarischen Reiter, Kumanen – und eine aus einem Versteck brechende Reserve einsetzen können.
Ottokar blieb auf dem Schlachtfeld. Er wurde ein Opfer seiner österreichischen Feinde, die nun an ihm Rache genommen hatten. Und so begann nun eine neue Epoche, die 640 Jahre dauern sollte.