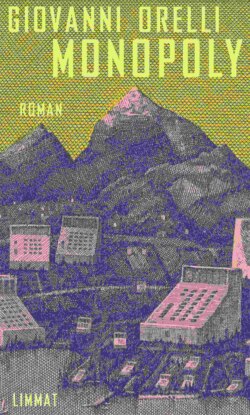Читать книгу Monopoly - Giovanni Orelli - Страница 5
ОглавлениеWIE MAN MONOPOLY SPIELT
—
Um Monopoly zu spielen, muss man mindestens zu zweit sein. Doch hat auch dieses Spiel seine Regeln und seine Ausnahmen. Man könnte nach dem Frühstück das Spiel vor sich auf den Tisch legen und anfangen, allein zu spielen, indem man die verschiedenen Rollen in seiner eigenen Person vereinigt: man ist gleichzeitig der Bankhalter, der verwegene Spieler, der bedachtsame Spieler, der x, y, z. Man könnte die Züge jedes einzelnen Spielers selber lenken und auf diese Weise Glück, Krise und Umsturz bestimmen.
Der Spielleiter kann den Spieler x verwöhnen, kann ihm zu seinem unerhörten Erfolg gratulieren, dagegen kann er den Spieler y bis zum letzten Rappen ausquetschen und ihn dann seinem Schicksal überlassen. Doch erst wenn man mit anderen Personen spielt, gewinnt das Spiel seinen wahren Reiz, erst dann ist es gerecht und billig – und es tut wohl. Wenn es wahr ist, dass Gott, der Schöpfer, sich in souveränem Gleichmut die Nägel putzte und dann sprach, «ES WERDE», so sollte man sich auch fragen, warum Gott am ersten Schöpfungstag überhaupt beschlossen hat, die Welt – und dann den Menschen – zu erschaffen. Was war vor dem ersten «ES WERDE»? Eine graue Ewigkeit? Ein Gott der Einsamkeit? Lichtjahre der Langeweile?
Gott hatte sicher seine guten Gründe, den Menschen zu erfinden, aber wer die ganze Schöpfung für einen Irrtum hält, hat wohl nicht ganz unrecht.
Das gleiche gilt für die Bank und für das Spiel Monopoly: welchen Reiz könnte es noch haben, wenn nicht mehrere Spieler daran beteiligt wären? Darum ist es zweckmässig, ja geradezu notwendig, einen Partner zu haben. In diesem Spiel braucht er keinen Namen. Für die Bank ist er nur eine Zahl, ein Nummernkonto.
Hauptperson ist das Geld. Es klirrt vergnüglich am Kassenschalter, auf dem überall reichlich vorhandenen Marmor. Kein Spieler wird also beim Namen genannt, und auch im Spiel bleibt unsere Bank einem ihrer heiligsten Prinzipien treu: der Geheimhaltung. Der Spieler hat natürlich die Möglichkeit, seine privaten Notizen über Gewinn und Verlust zu machen, genauso wie ich selber es hier tue.
Ich bin Cornelius Agrippa, und ich befasse mich mit Public Relations für einen der bedeutendsten Bankiers unseres Landes, Helmut Crunch. Ich komme aus einer Bauernfamilie, doch gehöre ich heute zu den wenigen, die in massgeblichen Gesellschaftskreisen Beachtung finden. Ich bin geboren und aufgewachsen in einer dem Namen nach liberalen Gesellschaft, die aber in Tat und Wahrheit konservativ ist und in der die Besetzung der leitenden Posten durch Parthenogenese geregelt ist, wobei diese Selbstreproduktion nach strengsten Auswahlkriterien vor sich geht, die zu Anfang in der Schule, danach in der Armee und auf anderen Gebieten wirksam werden.
Doch um das Gesicht einer demokratischen Gesellschaft vor sich und vor anderen zu wahren, um allgemein überzeugend zu wirken, gewährt man einer bescheidenen Anzahl von mittellosen, doch hinreichend intelligenten Leuten das Privileg, an den Brüsten der Wissenschaft zu saugen, an der Alma Mater, an unseren ausgezeichneten Universitäten zu studieren. Dort findet man darum nicht selten die Söhne von Bauern, Maurern und Schmieden, die mutig und ihres ehrenvollen Auftrags bewusst ihre Studien betreiben. Sie werden unterstützt und schliesslich in massgebliche Kreise aufgenommen, wo man sich ihres Eifers, ihrer respektvollen Dankbarkeit (wieviel Schweiss hat dieser Aufstieg gekostet!) zu bedienen weiss, um die Bindung zur Klasse der Kundschaft, zu den Klienten, im klassenlosen Abstimmungsritus neu zu festigen. Im vierten Studienjahr hat es mich auf die fantastischen Wege der Magie verschlagen. Das ist kein totes Gleis. Doch kehren wir zu den Namen zurück: Die Namen der anderen Spieler werden aus verständlichen Gründen verschwiegen, nicht aber die Namen der Männer, die – wie man so sagt – die Fäden in der Hand halten.
Meine Notizen werden also, während die Würfel rollen, bestimmte Persönlichkeiten beim Namen nennen: Bankdirektoren, Finanzleute, Grundbesitzer, Spekulanten, Versicherungsunternehmer – und auch andere, weniger wichtige Leute. Die bedeutendsten sind jedenfalls Helmut Crunch, mein Chef, Walter Krachnuss, Maximilian Galak, Jean-Marie Pralines, Rudolf (Rudi) Toblerone.
Es liegt in der Natur des Monopoly-Spiels, die Wirklichkeit zu verzerren. Da gibt es keine Landschaften, nicht einmal unfruchtbare Landstriche, man trifft weder auf Dörfer noch auf Vorstädte oder armselige Bergtäler. Jeder Staat wird durch vier Streifen dargestellt, die die Seiten eines Quadrates bilden. Jeder Streifen setzt sich aus zehn Feldern zusammen, und jedes Feld trägt den Namen eines charakteristischen Platzes oder einer bekannten Strasse einer Stadt. In der nationalen Fassung des Spiels ist Zürich daher den Städten Mailand, Paris, Frankfurt, New York gleichgestellt. Monopoly ist ein multinationales Spiel.
Es ist meine Pflicht, vor dem ersten Würfeln darauf hinzuweisen, dass schon zu Beginn des Spiels eine empfindliche Störung eintrat, und zwar durch den geheimnisvollen, noch ungeklärten Tod von Albin Dash jr., der auf dem Wege war, zur wichtigsten Finanzautorität des Landes aufzusteigen.
Dash ist über die Felsplatten eines steilen Wildbaches hinabgestürzt, der sich in Kaskaden bis zum Talgrund ergiesst. Dieser an sich schon mysteriöse Tod wird noch geheimnisvoller durch einige Ereignisse, die in der Geschichte unseres Landes einzig dastehen. Da sind drei Tage nach dem Tode von Dash – der am 26. September, dem Fest der Heiligen Cyprian und Justine, eintrat – in Olten, Montreux und Rapperswil sehr merkwürdige Dinge geschehen:
In Olten hat jemand um sechs Uhr morgens einen dumpfen Fall auf der Strasse gehört. Es hätte ein herabfallender Ast sein können; in der Nacht vorher herrschte ein gewaltiger Föhnsturm.
Es war jedoch kein Baumast, sondern ein schwarzgekleideter Mann mit neuen, schwarzen Schuhen. Wieso kauft man sich einen Tag vor seinem Tod neue Schuhe?
Es war ein Bankdirektor, ein sehr bekannter Mann aus Olten. Am selben Tag um acht Uhr morgens entdeckte in Montreux eine Putzfrau im Hause des Vizedirektors der dortigen Niederlassung die Leiche des Hausherrn. Er sass im Sessel, lässig ausgestreckt wie einer jener Schwachköpfe, die im Korbstuhl unter der sengenden Sonne dösen. Die Pistole war zu Boden gefallen.
Und am Abend desselben Tages sah ein Fischer, der am Ufer des Zürichsees in der Nähe von Rapperswil langsam dahinruderte, einen Schatten im Schilf liegen. Als er mit dem Boot näher heranfuhr, gab es keinen Zweifel mehr: ein schwarzgekleideter Mann lag auf dem Grunde des Sees, der hier nur etwa drei Meter tief ist. Das Gesicht lag im Schlamm. Die Identifikation machte keine Schwierigkeiten, und man kam zum längst gefürchteten Ergebnis: es war einer der bekanntesten Geschäftsleute der Bahnhofstrasse. All das geschah, während jeder normale Bürger seiner Arbeit nachging, während die Züge mit gewohnter Pünktlichkeit am Hauptbahnhof einliefen, während niemand an so etwas wie Streik dachte – den man hierzulande ja so gut wie abgeschafft hat –, während sich Arbeit und Freizeit in gewohntem Rhythmus ablösten; ein Virus war in höchste Kreise eingedrungen, ein tödlicher Wirbel erfasste die Exponenten der Hochfinanz.
Die begrüssenswerte Zurückhaltung, das Schweigen der Presse ist erklärlich.
Der Mann auf der Strasse aber fühlte sich doch ein wenig beunruhigt. Die Fälle von Olten, Rapperswil und Montreux blieben ja nicht die einzigen. An einem Morgen kann es passieren, dass man die Wohnungstür öffnet und auf dem Treppenabsatz einen leblosen Körper liegen sieht – einen Bankprokuristen –, doch passiert das nur selten, eigentlich geschah es nur ein einziges Mal, in Rorschach. Oder man sieht einen Mann kopfüber das Treppenhaus hinabstürzen, einen Chefbuchhalter. Viel häufiger sind jedoch die Fälle von Vergiftungen mit Barbituraten oder mit rasch wirkendem Zyankali.
Schliesslich verfielen die Zeitungen auf die merkwürdigsten Beschönigungen, Metaphern, Wortmalereien; wie sollte man diese immer weiter um sich greifenden Erscheinungen von weitreichender Bedeutung erklären! Es gibt viertausend Banken im Lande; es ist, als stocherte man in einem Haufen Kuhmist voller Fäulnis und Würmer.
Man sprach von Bankrott, von Unregelmässigkeiten, die bislang nicht geklärt werden konnten, und schliesslich von kolossalen Verlusten. Doch müsse man mit einem Urteil zuwarten, bis sich die Lage beruhigt hätte. Man ist dabei, den Fall zu untersuchen. Strengstens. Die Bank xxx ist geschlossen worden. Hunderte von kleinen Sparern haben ihre Einlagen verloren. Heute hat man sich davon überzeugt, dass eine Tür der Bank y zu einem Anwaltsbüro führt und dass dieses Anwaltsbüro Verbindungen zu einer Treuhandge sellschaft mit Sitz in Liechtenstein hat. Die Treuhandgesellschaft hat sich unvorsichtigerweise in allzu kühne Geschäfte eingelassen und fliegt auf.
Nicht jeder erträgt diese Panikstimmung. Mancher versucht, sich in Sicherheit zu bringen und demissioniert. Mancher besonders Sensible findet keine andere Lösung mehr als den Selbstmord. Anderen hat man nahegelegt, sich zur Verfügung zu halten. Die Schwesterbanken haben beachtliche Summen bereitgestellt, um die Verluste zu decken. Es ist in jedem Fall besser, Skandale zu vermeiden.
Endlich beruft der Generaldirektor der Zentrale die Aktionäre mit eingeschriebenem Expressbrief zu einer ausserordentlichen Generalversammlung ein. Er werde alle Fragen beantworten. Für diese Zusammenkunft mietet man den grossen Ausstellungspavillon im Schmuck aller Kantonsbanner und Städtefahnen. Man scheut das Licht des Tages nicht. Presse und Fernsehen sind geladen.
An den Wänden hängen grosse Tafeln mit grafischen Darstellungen, Zahlen, Prozentsätzen.
Der Generaldirektor spricht hochdeutsch, vermeidet den Zürcher Dialekt. Der Generaldirektor gleicht Arturo Toscanini.
Er spricht länger als zwei Stunden, erlaubt sich keine Zigarette, hat ein Stückchen Watte ins lange Mundstück gesteckt. Nur ein einziges Mal nimmt er die goldgeränderte Brille ab und putzt sie mit seidenem Taschentuch.
Nur ein einziges Mal trinkt er einen Schluck Mineralwasser. Glücklich die Männer, die niemals schwitzen!
Die Hände sind schneeweiss unter den Reflektoren der Fernsehkameras. Merkwürdige Fragen werden gestellt. Man könnte vermuten, dass die Fragen nur von den Neffen und den Schwiegersöhnen des Generaldirektors kommen.
Schon am gleichen Abend können Radio und Fernsehen dem Lande seine Sicherheit zurückgeben.
Als der Generaldirektor die Sitzung schliesst, geben die namhaften Persönlichkeiten aus Bankwesen und Politik, die die Versammlung über direkten Fernsehanschluss verfolgt hatten, ihren Sekretärinnen den Auftrag, herzliche Glückwünsche zu telegrafieren.
Die Seuche ist vorüber. Sie hatte sogar etwas Heilsames – wie alle Seuchen. Mit hartem Besen hat sie unbarmherzig die schwächsten Elemente hinweggefegt und hat den gesunden Geist der Bank gekräftigt. Verjüngt tritt sie aus dieser Prüfung hervor: Erneuerung des Blutes – wie bei den Radrennfahrern am Ende der Saison.
Als der Generaldirektor der Bank sich endlich zu den Seinen zurückzog, hatte er manchen warmen Händedruck zu erwidern. Das Übel war besiegt, das Leben kehrte in die gewohnten Geleise zurück. Auch das Monopoly-Spiel konnte beginnen.