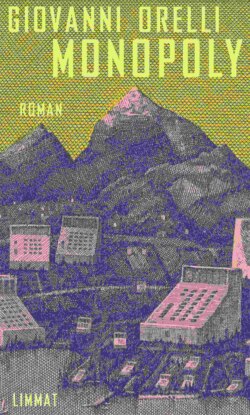Читать книгу Monopoly - Giovanni Orelli - Страница 8
ОглавлениеIII THUN
Ich würfelte 6 und machte einen Sprung bis nach Thun. Eine gepflegte Stadt. Hier hätte ich dem Professor Pareto von Lausanne begegnen mögen. Ich hätte ihm vorgehalten, dass es nicht genug sei, wenn man seinen Band Taine – wie üblich – schliesst und die Bourgeoisie in Bausch und Bogen verurteilt, die sich «an unflätigen Büchern weidet, mit denen verglichen das Satyricon ein geradezu puritanisches Werk ist, und in denen sie grausam verhöhnt wird. Es ist nicht nur die Faszination des Obszönen, es ist der perverse Genuss, mitanzusehen, wie alles in den Schmutz gezogen wird, was bis anhin Achtung und Respekt genoss. Die Hauptsorge einer derartverderbten Gesellschaft, die jegliche Würde verloren hat, sind denn auch die Frivolitäten im Theater.»
Der Kamerad Sbrinz jedoch, der das Fernsehen nur bei Cowboyfilmen einschaltet, befand sich im Einklang mit der vernichtenden Kritik des Professors Pareto und war ebenso besorgt: «Die Menschen sind unzufrieden mit allem. Sie sind zügellos. Sie beklagen sich über den steigenden Brotpreis und kaufen am Kiosk unsittliche Zeitschriften. Sie spotten über die Traditionen der Vergangenheit. Ausserdem ist viel zu viel Geld im Umlauf.» Und um alles noch schlimmer zu machen, fügte Professor Pareto hinzu: «Wann ist jemals soviel Schmuck unter die Leute gekommen? Die Juweliere, die Antiquitätenhändler verkaufen heute viel mehr als früher. Aber sie haben auch andere Kunden als früher.»
Ich war überaus betroffen von dieser Feststellung des Professors Pareto, und da ich ohnehin ein etwas langsamer Spieler bin, sagte die Dame, die nach mir an der Reihe war, leise, doch nicht allzu leise, zu ihrer Nachbarin: «Schläft er, oder macht er sein Testament?»
Nein, mein Testament machte ich nicht, aber ich war nahe daran: in Gedanken war ich beim Begräbnis von Dash, bei dem kleinen alten Mann, der aussah wie ein Jockey von Ascot und jetzt zerschmettert und zerschlagen nach dem fürchterlichen Sturz fünfhundert Meter über die Felsplatten in der Tiefe lag – einem Sturz von wenigen Minuten Dauer; entsetzliche Umkehrung eines lebenslangen Aufstiegs, der bis zum zweithöchsten Sitz der Bankhierarchie geführt hatte, von wo es nur noch ein kleiner Schritt zum höchsten war, zum Sessel des mächtigsten Mannes des Landes, in dem man bis zum Nabel versinken und die lange Zigarre kosten konnte, die allein dem Mächtigsten vorbehalten ist.
Ein geschickter Wärter hatte das Bündel Knochen in ein feierliches Totengewand gehüllt, die Gesichtszüge geglättet, soweit es nach der Verunstaltung noch möglich war. Der eingerissene Mundwinkel unter dem grauen Bärtchen betonte noch den Ausdruck von Verachtung und Strenge. Dieser Ausdruck war es, den er bei besonders wichtigen Unternehmungen zur Schau getragen hatte, und bei Dash war jede Unternehmung wichtig.
Diese Grimasse bekam etwas Komisches, wenn er in nervöser Laune zusätzliche Bestimmungen für sein Testament formulierte: Zum Beispiel verfügte er, dass sein Wagen im Falle seines Todes in der Zeitung zum Preise von 50 (fünfzig) Franken angeboten und dem ersten Interessenten verkauft werden solle, und dass diese fünfzig Franken nach geltendem Recht dem Erbe seiner Witwe zugeschlagen werden sollten, sofern diese nicht noch vor ihm von der Erde abberufen würde. Noch einmal, zum letzten Mal, sollte ihr nach seinem Tode klar werden, wer Dash war, dieser kleine Mann von einem Meter achtundfünfzig; seine Frau mass einsvierundsiebzig.
Die Nachträge zu seinem Testament waren nichts anderes als das Protokoll der Litanei von häuslichen Streitigkeiten. Letzthin hatten sie – während eines kurzen Waffenstillstandes – von Manila gesprochen, wie im Notizheft vermerkt war. (Die dortige Bank entwickelte eine lebhafte Tätigkeit.) Sie sprachen von einer durch Hunger verursachten Invasion von Mäusen und Schlangen, und sie, die Schwarzhaarige, hatte zu bemerken gewagt: «Du könntest doch einige Wochen lang dorthin gehen.»
«Wirklich?», und er hatte sein Testament wieder zur Hand genommen. Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Lachte er immer noch? Gab es im Jenseits eine Bank des Heiligen Petrus, eine Bank der Seraphim, der Throne und des ewigen Herrschers? Oder gab es im Jenseits viele Reihen von Gucklöchern, durch die die Toten zur Erde hinabschauen und sie bespitzeln?
Indessen treffen bei der schmerzerfüllten Witwe Tausende von Telegrammen ein, aus allen Landesteilen, aus dem Ausland – und dann kommt das Testament. Was mich betrifft, so scheint es mir gar nicht ausgeschlossen, dass ich – angesichts der Stadt Thun und des Zeughauses der Schweizer Armee – meinem letzten Willen die Bestimmung beifüge, in Uniform begraben zu werden. Hier könnte ich mich einkleiden, mich, wie die Frauen sagen, ins Zeug werfen. Ein Uniformrock mit steifem Kragen im Stil 1936 vielleicht? Ein Waffenrock aus der Kriegszeit, der bis zu den Knöcheln reicht? Ein schönes Paar Socken?
Besser, man denkt nicht zu oft an das Begräbnis von Dash, man sucht vielmehr, Körper und Geist in Einklang zu bringen, zusammenzuschweissen auf dem Waffenplatz Thun, wo man ständig Soldaten antrifft, einige mit – vermunich ungeladenem – Gewehr, andere ohne. Alte Kameraden treffen sich hier zur Inspektion. Mit Freude hören sie zu, wenn ihr Kommandant – wie in jenen goldenen Zeiten – verschiedene Einheiten zum Aufmarsch befiehlt oder das Gewehr präsentieren lässt wie ehemals, als der Zwanzigjährige mit jugendlicher Kraft und Energie das singende Gewehr zur Hand nahm und dem Befehl «Gewehr bei Fuss!» augenblicklich nachkam.
Die ganze Familie hatte mitgeholfen, als es galt, den Tornister zu packen, den Mantel nach den Regeln der Kunst um den Tornister zu schnüren und alle persönlichen Effekten blankzuputzen.
Kamerad Hermann Sbrinz, Sachverständiger des Zeughauses, ist davon überzeugt, dass die Inspektion genauso wichtig ist wie für einen praktizierenden Katholiken die österliche Beichte.
Das Zeughaus ist nur wenige Tage im Jahr für das Publikum geöffnet. Unser Volk ist ja von Natur aus ein Volk von Sammlern. Alles wird gesammelt: Bleisoldaten und Kupfermünzen, Bierdeckel und – neuerdings als Hobby der Hochfinanz – Platin. Kein Sammler lässt sich die Gelegenheit von Thun entgehen. Und Herrmann Sbrinz ermahnte mich bei unserem Gang durch die ausgedehnten Räumlichkeiten des Zeughauses:
«Jetzt überlegen Sie mal gut ...»
Ich überlegte nicht. Ich stellte mir vor, wir spazierten durch die Salons von Versailles. Sbrinz war einer der Minister in Amt und Würden, ich ein Emir aus Saudi-Arabien.
«Überlegen Sie mal: die Sammler von militärischen Effekten! Denken wir gar nicht an die Granaten-Hülsen, die vor allem von den Hausfrauen begehrt werden, aber manchmal auch von den Gattinnen hoher Bundesbeamter, die sich einen Spass daraus machen, hübsche Geranienbehälter daraus zu basteln; denken wir gar nicht an die historischen Gewehre, die vom Jahre Siebzig zum Beispiel. Ein Amerikaner ist einen Monat lang um mich herumgeschwirrt, weil er ein Bajonett wollte. Denken wir vielmehr an die Uniformen aus der Zeit vor 1870, als es noch kantonale Heere gab mit all ihren verschiedenen Schnitten und Formen. Aber kommen wir zu den höchsten Graden. Zur Generalsuniform. Wissen Sie, was eine Generalsuniform kostet? Aber seien Sie beruhigt: Sie ist unverkäuflich. Sie wissen ja: wir hatten nur vier Generäle, seitdem die Schweiz die Schweiz ist, und sie ist es ja schon ziemlich lange. Das waren: Dufour, Herzog, Wille und – last but not least – Henri Guisan. Generalsuniformen stehen nicht zum Verkauf, so wenig wie Leonardos Gioconda oder die Fassade von Notre Dame. Die römische Kirche verkauft ja nicht einmal die Pantoffeln des Papstes. Oder den Krummstab, die Tiara oder den Heiligen Stuhl. Sonst wäre schon eine Schiffsladung unterwegs nach Amerika. Uniformen niedrigerer Grade kann man hingegen kaufen, vom Stabsoffizier abwärts. Wissen Sie, womit man in jüngster Zeit die besten Geschäfte gemacht hat? Mit den Militärgeistlichen. Meine Güte, Sie wissen ja, mit denen ist in der Schweiz nicht viel Staat zu machen. Gewöhnlich werden ja die Priesteranwärter vom Militärdienst befreit. Wenn einer trotzdem einrückt und seine vier Monate in der Kaserne absolviert und alles mitmachen muss – man stelle sich vor, was das für ihn heisst: Flucherei, Frauengeschichten und so weiter –, dann wird er automatisch Hauptmann; Militärgeistlicher mit Hauptmannsgrad, und dann hat er während der ganzen Dienstzeit ein herrliches Leben. Er muss sich um die geistige Landesverteidigung kümmern, das heisst, er hat nichts zu tun – und wahrhaftig, er tut auch nichts.
Moment mal, das trifft vielleicht nicht ganz zu. Wenn zum Beispiel ein Hochverräter hingerichtet wird, dann müssen sie ihm Beistand leisten. Im letzten Kriege war das siebzehn Mal der Fall. Der Verurteilte soll ordnungsgemäss zum Tode geleitet werden. Gut also – aber ich komme jetzt nicht mehr drauf, wieviel die Berner und die Zürcher Sammler damals für einen mit Stempeln versehenen Degen eines Militärgeistlichen bezahlten. Einer besorgte sich die Liste sämtlicher Feldprediger und machte damit im ganzen Land die Runde.
Nur eine einzige Stadt liess er aus, nämlich Cham.
In Cham bei Zug war bisher alles glatt gegangen, das Geschäft war so gut wie perfekt, als der ältere Bruder des Militärgeistlichen dazwischentrat, der in der kirchlichen Hierarchie einen weit höheren Rang einnahm. Der Militärgeistliche ist im zivilen Leben Probst und hat immerhin das Recht auf den Titel Monsignore. Der Bruder aber war als junger Missionar ausser Landes gegangen, war in irgendeiner afrikanischen Wüste im Handumdrehen Erzbischof geworden und lebte jetzt im wohlverdienten Ruhestand, war rundlich und voll blühender Gesundheit, las die Messe mit Krummstab und weissen Handschuhen. In den Homilien sprach er lobend von der Gottesfurcht der Schwarzen, im Gegensatz zur Schamlosigkeit unserer ausschweifenden Jugendlichen, die wahrhaft Heiden seien. Doch werde Europa das zu spüren bekommen, und zwar bald.
Als ihm nun dieser angebliche Heimatforscher in die Hände fiel, in dem er sofort den Geschäftsmann witterte, kanzelte er ihn empfindlich ab und liess ihn vor die Tür setzen. Ein weiterer Entrüstungssturm entlud sich über dem unvorsichtigen Bruder, der ja Heereskaplan war: das Schwert, das die Heimat verteidigt hat, verkauft man nicht.
Nein, ein Offiziersdegen ist kein Soldatenkoppel, das dem Bauern dazu dient, sich den Hosenlatz zu schliessen oder den Wetzsteinbehälter mit seinem guten Wetzstein um die Hüfte zu schnallen.
Was den Degen betrifft, da heisst es Nein. Sonst wären wir bald so weit, das Réduit der Nation an den Meistbietenden zu verkaufen.
Alles hat seine Grenzen! Stellen Sie sich eine Anzeige im «Bund» von 1990 vor: zu verkaufen vier oberstleutnants, oder eine im Jahre 2000: grosse versteigerung von vier festungen mit brigadier, und endlich wird im Jahr 2020 in den bedeutendsten Zeitungen Europas zu lesen sein: WÄHLT FÜR EURE FERIEN EINEN SCHAUERLICHEN ORT, DAS REDUIT DER SCHWEIZ!
Nein, wenn die Publizität die Seele des Handels ist und der Handel die Seele der Nation, dann werden wir uns wohl schliesslich fragen müssen: «Was ist die Nation?»
Sbrinz schwieg, als ob er eine Antwort erwartete.
Dann wechselte er das Thema.
«Ein Mann wie Sie müsste sich einmal ein Heeresarchiv ansehen!»
«Beim nächsten Besuch will ich das gerne tun, aber nur mit Ihnen als Führer.»
Inzwischen konnte ich es mir als eine Art Archiv des Himmelreichs vorstellen. Wie viele Protokollblätter werden im Paradiese abgeheftet? Wie viele Anlagen? Wenn keines unserer Worte, keine unserer Taten, nicht einmal mein Schwätzchen mit Sbrinz verlorengeht und alles einst im Tale Josaphat wieder präsentiert werden muss, wenn der grosse Abrechnungstag der himmlischen Archivare hereinbricht!
Ich vermute, dass der Chef, der Sankt Peter der Archivare, ein Mann wie Sbrinz sein wird. Es könnte ja nicht nur die Türkei allein unser Zivilgesetzbuch übernommen haben. Auch der Himmel könnte von uns lernen. Oder nehmen sie dort oben alles auf Band auf? Auf Mikrofilm? Oder verfügen sie dort über andere, völlig fremde Mittel, die unsere armselige Vorstellungskraft übersteigen?
Die ganze Kette der Worte, die von der frühesten Kindheit bis zum Tode ausgesprochen werden, verdichtet in einem einzigen Tropfen Blut, sterilisiert, in einem Bläschen wie jenes über Sbrinz’ rechtem Auge ...
Und plötzlich stellte Sbrinz eine andere Frage:
«Haben Sie den General gekannt?»
«Gewiss, ich habe ihn mehr als einmal gesehen. Wir waren auf dem Dorfplatz, bei Fackellicht, als er mit anderen hohen Offizieren oben auf einer Treppe erschien. Er sprach französisch und deutsch. Und als er sich auch dazu herabliess, uns in der dritten Landessprache zu begrüssen, bekamen mein Cousin und ich plötzlich einen Schrecken. Er betonte nämlich falsch und sagte ‹cari giovàni› anstatt ‹cari giòvani›, sodass mein Cousin Giovanni glaubte, er habe ihn gerufen. Ein andermal haben wir ihn gesehen, als er an die Grenze kam.»
«Als er an die Grenze kam?», unterbrach Sbrinz aufgeregt. «Er inspizierte alles und ermunterte die Soldaten. Wir befinden uns sehr im Irrtum, wenn wir glauben, ein General sei nur in Kriegszeiten nötig. Wer führt uns, wer stärkt uns in der Zeit zwischen den Kriegen? Darf ich Ihnen etwas im Vertrauen sagen? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich denke manchmal – und auch meine Frau ist derselben Meinung –, dass es auch seine guten Seiten hätte, wenn der Krieg nie gänzlich aufhörte, wenn er um uns herum weiterginge, weniger heftig natürlich und mit sauberen Waffen, aber doch ständig weiterginge. In unserem Lande, verstehen Sie, würde der nationale Zusammenhalt gestärkt, und wir hätten den General immer unter uns.»