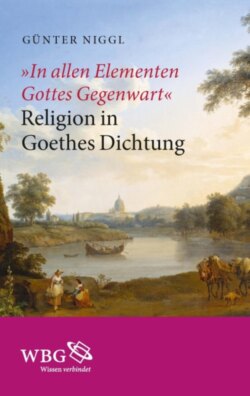Читать книгу "In allen Elementen Gottes Gegenwart" - Günter Niggl - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Goethe und das Christentum
ОглавлениеIch beuge mich vor Christus, als der göttlichen
Offenbarung des höchsten Prinzips der Sittlichkeit.
Goethe zu Eckermann, 11. März 1832
Um Goethes Verhältnis zum Christentum seiner Zeit recht zu verstehen, muss man die religionsgeschichtliche Situation dieser Epoche beachten. Es ist die Zeit der europäischen Aufklärung, und diese bedeutet für christliches Glauben und Leben eine Anfechtung von bisher nicht gekannter Radikalität. Diese von England und Frankreich ausgehende und bald ganz Europa erfassende Geistesströmung erklärt die Überprüfung aller Traditionen, Kritik und Zweifel an allen bisherigen Wahrheiten und Bindungen zu den neuen Prinzipien des Denkens und Handelns. Hand in Hand damit geht die Forderung nach Freiheit und Mündigkeit des Menschen in allen Lebensbereichen, auch und gerade im geistigen und religiösen Raum. Das bedeutet, dass im Laufe des 18. Jahrhunderts die sich seit der Renaissance abzeichnende Kluft zwischen Glaube und Vernunft immer deutlicher wird.1 Die mathematische Methode der neueren Philosophie (Descartes, Spinoza, auch Leibniz) unterstützt dabei den sich anbahnenden Siegeszug der Naturwissenschaften, und von solchem Rationalismus wird alsbald auch die Theologie der Zeit, zuerst und vor allem die protestantische Theologie, affiziert. Diese gesteht der menschlichen Vernunft immer mehr Erkenntniskräfte zu und glaubt schließlich, dass dieselbe auch ohne Offenbarung Gott als den Schöpfer, Erhalter und Richter erkennen könne. Gleichzeitig schwindet das lutherische Sündenbewusstsein, dem Menschen wird eine eigene positive Kraft zur Bewältigung aller Lebensschwierigkeiten zuerkannt, womit die Theologie der allgemeinen Tendenz des Jahrhunderts zum Individualismus und zur Autonomie jedes Einzelnen folgt und so den Weg zur subjektiven Religiosität ebnet.
Sowohl von der Philosophie als auch von der protestantischen Theologie der Zeit wird somit die Notwendigkeit, ja der Sinn der übernatürlichen Offenbarung eines persönlichen und heilsgeschichtlich handelnden Gottes bestritten, am deutlichsten in der damals aufkommenden historischen Bibelkritik, die etwa bei Johann Salomo Semler die meisten Bücher der Heiligen Schrift als Zeugnisse einer natürlichen Religion wertet, die man auch ohne Bibel kenne, und die wenigen übernatürlich zu deutenden Stellen für unverbindlich erklärt, weil sie aus den historischen Eigentümlichkeiten ihrer Verfasser herzuleiten seien.
Gegen diese neue Vernunftreligion hat im protestantischen Bereich die alte Offenbarungsreligion seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einen immer schwereren Stand, und sie findet in diesen Jahrzehnten nur wenige Verteidiger. Zu ihnen gehören vor allem die Pietisten gleichwelcher Provenienz. So halten die Herrnhuter an der augustinischen Erbsündelehre, an der Lehre von der Verderbtheit und Gnadenbedürftigkeit des Menschen fest, auch ihre intensive Bibellektüre und ihre ganz persönliche Heilandsfrömmigkeit zeigen das alte Gottesbild, das sie im Kampf gegen den oft gefühlsarmen Rationalismus der protestantischen Orthodoxie bewahren.
Auch die Katholiken der Zeit halten am Offenbarungsglauben fest, und namentlich hat das einfache Volk die alten Formen der Frömmigkeit und Gebräuche unbeirrt und unberührt von den Einflüssen der Aufklärung gelebt und an die folgenden Generationen weitergegeben. Dagegen suchte die gebildete Oberschicht der Katholiken vielfach die Kluft zwischen ihren religiösen Grundsätzen und der vorherrschenden rationalistischen Kultur zu überbrücken, indem sie etwa die Sakramente nur noch symbolisch deutete und auch sonst die konfessionellen Unterschiede verschleierte. Denn auch die katholische Kirche sah damals ihre Hauptaufgabe nicht mehr in der Führung zum ewigen Heil, sondern in der Erziehung zu einem edlen, harmonisch gebildeten Menschentum. Andererseits brachte solche aufklärerische Gesinnung im katholischen Raum die erfolgreiche Beseitigung des Aberglaubens, auch die Bekämpfung mancher Missbräuche des Wallfahrtswesens und der Wunderfrömmigkeit. Der hohe Klerus freilich kümmerte sich weder um Dogmatik noch um das Glaubensleben, sondern verfolgte fast nur seine politischen Interessen. Die Bischöfe waren als Anhänger des Episkopalismus vor allem bestrebt, sich von römischer Vormundschaft zu befreien, und dachten als Fürstbischöfe in erster Linie feudal, waren deshalb in der Reichspolitik konservativ gesinnt. Wenn sie also daran interessiert waren, dass innerhalb ihres Machtbereichs der traditionelle Offenbarungsglaube unangetastet blieb, war dies auch und gerade politisch motiviert.
***
In dieses Bild eines recht uneinheitlichen, unruhigen, von epochaler Krise geschüttelten Christentums sind nun Goethes Verhältnis und Auseinandersetzung mit diesem zeitgenössischen Christentum und seinen unterschiedlichen Erscheinungsformen einzuordnen.2 Da dieses Verhältnis nicht von vornherein feststand, sondern sich im Laufe eines langen Lebens entwickelt und gewandelt hat, wird dieses wechselvolle Pulsieren am besten in einer biographischen Folge der wichtigsten Stationen vorgestellt.
Goethe wuchs in einem protestantischen Elternhaus auf. Der Vater pflegte ein konventionelles Christentum, er beachtete gewissenhaft die kirchlichen Riten und Gebräuche und besuchte regelmäßig den protestantischen Gottesdienst. Die Mutter zeigte später darüber hinaus eine Neigung zu pietistischer Frömmigkeit mit intensiver Bibellektüre und pflegte die Verbindung zum herrnhutischen Kreis um ihre Freundin Susanna Katharina von Klettenberg. Goethe selbst wurde vom Beichtvater der Familie Textor getauft. Dieser Dr. Johann Philipp Fresenius war Senior des evangelisch-lutherischen Ministeriums in Frankfurt und als solcher zugleich Haupt des kirchlichen Pietismus Spener’scher Prägung und damit ein Gegner der Herrnhuter. Goethe besuchte den protestantischen Religionsunterricht und übte sich eine Zeitlang im Nachschreiben der sonntäglichen Predigten aus dem Gedächtnis. Die damals auch bei den Protestanten noch übliche Ohrenbeichte, den Empfang des Abendmahls und die Konfirmation erlebte er jedoch nur noch als äußere Zeremonien.
Wie kam es zu dieser Abkehr vom kirchlichen Glaubensleben? Die Erklärung dafür gibt Goethe selbst am Ende des 1. Buches von Dichtung und Wahrheit.3 Dort erwähnt er als letztes Lehrfach den Religionsunterricht der Kinder, jedoch nur, um daran Kritik zu üben: „Doch war der kirchliche Protestantismus, den man uns überlieferte, eigentlich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Vortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen.“ Das Bild dieses „kirchlichen Protestantismus“ war also mehr durch Mängel als durch positive Züge gekennzeichnet, und deshalb dient es hier nicht nur der Illustration des Religionsunterrichts, sondern noch mehr als Folie für andere religiöse Formen, deren Entstehung Goethe mit der Trockenheit der offiziellen Lehre erklärt, wenn er fortfährt: „Deßwegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der gesetzlichen Kirche. Es entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrnhuter, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pflegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Christum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu sein schien.“ Der Pietismus wird also aus seiner Spannung gegenüber der „gesetzlichen Kirche“ heraus definiert, und Goethe spricht dabei ein durchwegs positives Urteil über die abgesonderten Frommen aus, indem er voller Verständnis ihren Separatismus mit ihrem einzigen Wunsch nach größerer Nähe zu Gott erklärt. Goethe betont, dass gerade die originelle, herzliche und selbständige Gotteskindschaft der Pietisten großen Eindruck auf ihn gemacht und ihn schon als Kind angeregt habe, sich gleichfalls Gott „unmittelbar zu nähern“, und er dies mit dem Versuch eines Rauchopfers unternommen habe, dessen ausführliche Szene das 1. Buch von Dichtung und Wahrheit bedeutsam schließt. Der junge Priester ahmt dabei freilich keine pietistische Frömmigkeit nach; es ist vielmehr die kindliche Form einer naturreligiösen Liturgie, die den Gott des ersten Glaubensartikels „in seinen Werken aufsucht“, keiner Vermittlung durch Christus bedarf und höchstens „auf gut alttestamentliche Weise“ das Opfer vollzieht.
Auf diese erste Stufe einer natürlichen Religion folgte über mehrere Jahre hin die genauere Bekanntschaft, ja wachsende Vertrautheit mit der Bibel. Zuerst faszinierten den Zwölfjährigen die Geschichtsbücher des Alten Testamentes, und er begründet die ausführliche Nacherzählung der Patriarchengeschichte im 4. Buch von Dichtung und Wahrheit damit, „daß ich auf keine andere Weise darzustellen wüßte, wie ich bei meinem zerstreuten Leben, bei meinem zerstückelten Lernen, dennoch meinen Geist, meine Gefühle auf einen Punkt zu einer stillen Wirkung versammelte; weil ich auf keine andere Weise den Frieden zu schildern vermöchte, der mich umgab, wenn es auch draußen noch so wild und wunderlich herging.“4
Es blieb aber nicht bei dieser bloß psychologischen Wirkung der Bibellektüre. Nachdem sich der 16-jährige Goethe beim Abschied von Frankfurt endgültig von der offiziellen Kirche löste, kam er in Leipzig erstmals mit Pietisten in Berührung, vertiefte sich auf dem Krankenlager mit Gefühl und Enthusiasmus nunmehr ins Neue Testament und war nahe daran, das Evangelium für göttlich zu erklären. Diese neue Empfänglichkeit blieb ihm auch noch während der zweijährigen Rekonvaleszenz in Frankfurt (1768/69) erhalten, er näherte sich der dortigen Brüdergemeine, nahm gelegentlich an herrnhutischen Versammlungen im Elternhaus teil und führte religiöse Gespräche mit dem von ihm hochverehrten Fräulein von Klettenberg. Damals, im Januar 1769, schrieb er seinem Freund Ernst Theodor Langer, der ihn in Leipzig mit pietistischem Gedankengut vertraut gemacht hatte: „Mich hat der Heiland endlich erhascht, ich lief ihm zu lang und zu geschwind, da kriegt er mich bey den Haaren. [...] Ich binn manchmal hübsch ruhig darüber, manchmal wenn ich stille ganz stille binn, und alles Gute fühle was aus der ewigen Quelle auf mich geflossen ist.“5 Auf dieser zweiten Stufe von Goethes religiöser Entwicklung steht also der ernsthafte Versuch, sich aus freien Stücken einer positiven Religion, nämlich der Variante des pietistischen Christentums, anzuschließen, was auch daran erkennbar ist, dass ihm alle „ungerechten, spöttlichen und verdrehenden Angriffe“6 auf die Bibel von Seiten der historisch-kritischen Gelehrsamkeit missfielen.
Aber diese Bekehrung zum Heiland war doch nicht von Dauer. Schon während des Frankfurter Intervalls bahnte sich eine neue Wende an.7 Denn genau in dieser pietistischen Phase wurde Goethe mit Gottfried Arnolds Unpartheyischer Kirchen- und Ketzer-Historie (1699/1700, zuletzt 1742) bekannt, die er damals fleißig studierte und die nach eigenem Bekunden großen Einfluss auf sein religiöses Denken gewann. Das Attribut „unparteiisch“ will sagen, dass Arnold die Kirchengeschichte überkonfessionell, dabei aber durchaus parteiisch im Sinne des radikalen Pietismus darstellen will. Für Arnold besteht die christliche Religion nur in der individuellen Begegnung zwischen Gott und der Seele, weshalb für ihn einzig und allein das Urchristentum die geisterfüllte Zeit war. Die darauffolgende Kirchengeschichte mit Verfassung, Dogmatik, Kirchenrecht und Kult ist für ihn – übrigens in beiden Konfessionen – ein bis in die eigene Gegenwart fortdauernder Verfall. Arnold erkennt nur eine unsichtbare Geistkirche an, zu der die vom Geist erleuchteten Wiedergeborenen in und außerhalb der Konfessionen gehören, weshalb in dieser Kirchengeschichte gerade die Außenseiter und Abgesonderten, viele Ketzer und die „Stillen im Lande“ besonderes Lob erfahren.8
Goethe erinnert sich in Dichtung und Wahrheit an die Übereinstimmung seiner mit Arnolds Gesinnung und an seine Freude, „daß ich von manchen Ketzern, die man mir bisher als toll oder gottlos vorgestellt hatte, einen vortheilhaftern Begriff erhielt“9. Daraus habe er die Folgerung gezogen, daß „jeder Mensch [...] am Ende doch seine eigene Religion (habe)“ und also „ich mir auch meine eigene bilden könne“.10 Goethe sieht also Arnolds Bedeutung für seine religiöse Selbstklärung nicht in inhaltlichen Angeboten, sondern in der Aufmunterung, ein eigenes, eigenwilliges, von kirchlichen Normen abweichendes und also ketzerisches Credo zu bekennen. Dieses formuliert Goethe anschließend (am Ende des 8. Buches von Dichtung und Wahrheit)11 in Gestalt eines Weltentstehungsmythos, der aus neuplatonischen, hermetischen und kabbalistischen Elementen gemischt ist und der Gott und Luzifer als gleichmächtige Pole der Schöpfung im Sinne eines kosmischen Pulsierens von Konzentration und Expansion versteht, so dass auch Sündenfall und Erlösung nicht als einmalighistorische, sondern als sich immer wiederholende Phasen einer einheitlichen Natur- und Heilsordnung erscheinen. Dieses individuelle Glaubensbekenntnis des Heranwachsenden ist, analog zum phantasievollen Naturopfer des Knaben, Ausdruck einer selbständigen religiösen Tat, nur jetzt auf der höheren dritten Stufe ein bewusster Akt religiöser Emanzipation gegenüber allen etablierten, auch und gerade gegenüber den christlichen Glaubensformen der Zeit. Es darf uns dabei nicht überraschen, dass Goethes erster Schritt zu einer „eigenen Religion“ vom Buche eines radikalen Pietisten angeregt wurde. Denn vom Pietismus war ja am entschiedensten das Prinzip der religiösen Selbständigkeit verfochten und praktiziert worden.
Den endgültigen Abschied von jedem kirchlich gebundenen Christentum datiert Goethe jedoch auf seine letzte Begegnung mit herrnhutischen Pietisten anlässlich des Synodus von Marienborn im September 1769. An sich hatten die dortigen Oberen, so erinnert sich Goethe in Dichtung und Wahrheit, „meine ganze Verehrung gewonnen, und es wäre nur auf sie angekommen, mich zu dem Ihrigen zu machen“12. Aber damals geführte Gespräche deckten schwerwiegende dogmatische Differenzen zwischen ihm und den Herrnhutern auf und zogen ihm den Vorwurf des Pelagianismus von Seiten der Brüder zu. Goethe jedoch beharrte auf seiner Überzeugung, dass die menschliche Natur durch die Erbsünde nicht völlig verdorben sei, zumal er aus der Kirchengeschichte erfuhr, dass ein Teil der Christenheit von jeher diese Auffassung des Pelagius vertreten habe. Dieser Teil gab zwar, wie Goethe selbst erläutert, „die erblichen Mängel der Menschen sehr gern zu, wollte aber der Natur inwendig noch einen gewissen Keim zugestehn, welcher, durch göttliche Gnade belebt, zu einem frohen Baume geistiger Glückseligkeit emporwachsen könne“13. Aber schon allein die „Übung eigner Kraft“ und die seit einigen Jahren in ihm arbeitende „rastlose Thätigkeit“14 waren ihm so sehr zur zweiten Natur geworden, dass die zur Passivität zwingende strenge Erbsündelehre ihn notwendig von der pietistischen Gesellschaft Abschied nehmen ließ. Und wieder zieht Goethe, wie schon nach der Arnold-Lektüre, daraus die Konsequenz, sich eine eigene Religion zu bilden, wenn er die Marienborner Episode mit den Worten schließt: „[...] da mir meine Neigung zu den heiligen Schriften so wie zu dem Stifter und den früheren Bekennern nicht geraubt werden konnte, so bildete ich mir ein Christenthum zu meinem Privatgebrauch, und suchte dieses durch fleißiges Studium der Geschichte, und durch genaue Bemerkung derjenigen, die sich zu meinem Sinne hingeneigt hatten, zu begründen und aufzubauen.“15 Goethe hätte dabei gar nicht erst in die Kirchengeschichte zurückgehen müssen, schon die zeitgenössische protestantische Theologie konnte ihn zu einem privaten Christentum einladen16, drängte sie doch, im Unterschied zum Kirchenregiment, die Erbsündelehre vielfach zurück, hob dafür die Vernunft- und Moralkräfte des Menschen hervor und förderte so das allgemeine Streben nach Autonomie des Einzelnen auch im religiösen Bereich.
***
Damit aber war für Goethe der Weg frei zu einer individuellen Religiosität, die ihn in der Folgezeit immer mehr vom christlichen Glauben entfernte. Dies tritt im Laufe der siebziger Jahre immer deutlicher hervor, besonders als Johann Caspar Lavater in zudringlicher Weise Goethe zum Christentum bekehren wollte. Je mehr dabei Lavater sein persönliches Christusbild, der ihm „Gottes Ebenbild u. Urbild der Menschheit“17 war, als objektiv aufdrängen wollte, umso entschiedener wehrte sich Goethe gegen diese Zumutung und bekannte sich als „dezidirten Nichtkristen“18. Was Goethe darunter verstand, kann man seinem Brief an Lavater vom 22. Juni 1781 entnehmen, worin er dessen Glauben an die Exklusivität Christi für sich und seine Gesinnungsfreunde ablehnt, da „wir uns einer ieden, durch Menschen, und dem Menschen offenbarten, Weisheit zu Schülern hingeben, und als Söhne Gottes ihn in uns selbst, und allen seinen Kindern anbeten“19. Das Privileg Christi als Gottes Sohn wird hier dementiert durch den Plural „Söhne Gottes“ für alle Menschen, und der Ausdruck „Gott in uns anbeten“ ist ein klares Zeugnis dafür, dass sich der dezidierte Nichtchrist Goethe inzwischen zu einer Art von Pantheismus bekennt.
Denn seit seiner näheren Bekanntschaft mit Spinozas Schriften (zuerst 1773 und verstärkt seit der Mitte der achtziger Jahre) setzt Goethe in der Nachfolge dieses Philosophen Gott und Natur, Gott und Dasein in eins, und diese Gleichsetzung bleibt von nun an im Wesentlichen sein Glaubensbekenntnis als Naturforscher wie als Dichter.20 Aber je stärker er sich darin befestigte, desto mehr erschien ihm dieses Weltbild unvereinbar mit dem christlichen. So hat er 1811 Friedrich Heinrich Jacobis Schrift Von den Göttlichen Dingen21 mit ihrem Bekenntnis zur übernatürlichen Offenbarung und der daraus folgenden These, dass die Natur Gott verberge, entschieden zurückgewiesen22 und noch im Rückblick in den Tag- und Jahres-Heften 1811 seine eigene „reine, tiefe, angeborne und geübte Anschauungsweise“ dagegengestellt, „die mich Gott in der Natur, die Natur in Gott zu sehen unverbrüchlich gelehrt hatte, so daß diese Vorstellungsart den Grund meiner ganzen Existenz machte“23. Als unmittelbare Antwort auf Jacobis Schrift kann ein 1812 entstandenes Gedicht gelten, worin Goethe den transzendenten Gott Jacobis mit dem eigenen, pantheistisch verstandenen konfrontiert:
Was wär’ ein Gott, der nur von außen stieße,
Im Kreis das All am Finger laufen ließe!
Ihm ziemt’s, die Welt im Innern zu bewegen,
Natur in Sich, Sich in Natur zu hegen,
So daß was in Ihm lebt und webt und ist,
Nie Seine Kraft, nie Seinen Geist vermißt.24
Aufschlussreich ist hier, dass Goethe in der vorletzten Zeile – wie auch sonst gerne – aus der Areopagrede des Apostels Paulus zitiert, worin dieser seinen skeptischen Zuhörern entgegenkommt, indem er sich auf zwei griechische Autoren, Aratos von Soloi und den Stoiker Kleanthes von Assos, beide aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., beruft: „Denn in ihm leben, weben und sind wir; wie auch etliche Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts“ (Acta 17, 28).
Nun beschränkte sich Goethes Auseinandersetzung mit dem Christentum seit den achtziger Jahren nicht auf gelegentliche Repliken gegenüber Lavater und Jacobi. Sein Pantheismus konnte wesentliche christliche Glaubenssätze nicht einfach hinnehmen, musste vielmehr daran Anstoß nehmen: Dualismus von Gott und Welt; ein persönlicher, geschichtlich handelnder, um das Heil des Menschen besorgter Gott; Erbsünde und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen; die Göttlichkeit Christi und die Erlösung durch einen menschgewordenen Gott am Kreuz. So hat Goethe den persönlichen Gott in einem nachgelassenen Zahmen Xenion mit dem Titel Der Pantheist bestritten:
Was soll mir euer Hohn
Über das All und Eine?
Der Professor ist eine Person,
Gott ist keine.25
Auch erkannte er nur die Menschennatur Jesu, nicht seine Göttlichkeit an – in der Nachfolge Lessings, der in einem späten Fragment (1780)26 zwischen der „Religion Christi“ und der „christlichen Religion“, zwischen der Lehre des Menschen Jesus in den Evangelien und seiner Verehrung als Gottessohn, unterschied. So auch Goethe in einem Gedicht aus dem Divan-Nachlass:
Jesus fühlte rein und dachte
Nur den Einen Gott im Stillen;
Wer ihn selbst zum Gotte machte
Kränkte seinen heil’gen Willen.27
Man spürt aus diesen Zeilen, wie sehr Goethe den Jesus der Evangelien, den Menschen und Menschheitslehrer, verehrt hat. Noch elf Tage vor seinem Tod hat er gegenüber Eckermann (11. März 1832) Christi sittliche Hoheit gerühmt: „Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, ihm anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage ich: durchaus! – Ich beuge mich vor ihm, als der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der Sittlichkeit. –“ Und dann fährt er fort: „Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich abermals: durchaus! Denn sie ist gleichfalls eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die mächtigste, die uns Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind, und alle Pflanzen und Tiere mit uns.“28 Christus wird hier zu den höchsten Erscheinungen auf dieser Welt gezählt, die Gleichsetzung mit der Sonne aber ist wieder nur aus pantheistischer Perspektive verständlich, die nur natürliche Offenbarungen Gottes kennt.
Aus dem gleichen Gesichtspunkt musste Goethe das Kreuz ablehnen, da es für ihn nicht Zeichen der Erlösungstat Gottes, sondern ein Bild des Verbrechens an der Menschlichkeit Jesu war. Der Grad der Ablehnung aber wechselt. In der Jugend fehlt noch jede Polemik. Zwei Beispiele aus poetischen Werken lassen sogar eine positive Einstellung erkennen. Das erste ist eine sog. Fetzenszene im Urfaust mit der Überschrift „Landstrase“29. Es ist ein impressionistisch-knapper Dialog zwischen Faust und Mephistopheles, eingeschaltet zwischen „Auerbachs Keller“ und dem Beginn der Gretchenhandlung:
Land Strase.
Ein Kreuz am Weege rechts auf dem Hügel ein altes
Schloß, in der Ferne ein Bauerhüttgen.
FAUST
Was giebts Mephisto hast du Eil?
Was schlägst vorm Kreuz die Augen nieder?
MEPH:
Ich weis es wohl es ist ein Vorurtheil,
Allein genung mir ists einmal zuwieder.
Widerwillen gegen das Kreuz zeigt nur Mephistopheles, nicht Faust, der sich über das Verhalten seines Begleiters wundert. Uns überrascht das nicht, denn das Zeichen seiner Niederlage wird der Teufel kaum anerkennen. Auffällig aber ist, dass der junge Dichter von 1773 hier seine spätere eigene Abneigung gegen das Kreuz noch dem Mephistopheles in den Mund legt und diesen gar noch seinen Widerwillen als „Vorurteil“, als unsachgemäße subjektive Meinung zugeben lässt. Diese kurze Szene wird dann allerdings nicht mehr in das Faust-Fragment von 1790 und auch nicht in Faust I von 1808 übernommen. Das zweite Beispiel stammt aus dem Epenfragment Die Geheimnisse (1783), wo über einer Klosterpforte das Kreuz erblickt und als ein Zeichen gerühmt wird,
Das aller Welt zu Trost und Hoffnung steht, [...]
Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet,
Das in so mancher Siegesfahne weht [...]30
Dieses Kreuz ist freilich hier „mit Rosen dicht umschlungen“31 – als Emblem einer Bruderschaft, die die Vereinigung aller Religionen im Zeichen der Humanität symbolisiert. Der italienische Goethe hingegen äußert seine Abneigung gegen das Kreuz in einer Polemik von verletzender Schärfe, vor allem im Venetianischen Epigramm Nr. 66 (1790)32. Man muss allerdings bedenken, dass Goethe sich besonders gegen die Darstellung des Gemarterten am Kreuz gewehrt hat. Das „leidige Marterholz“ erscheint ihm als „das Widerwärtigste unter der Sonne“.33 Goethe lehnt als Augenmensch, noch dazu im Raum der klassischen Ästhetik, alles Hässliche, Extreme, Maßlose, Furchtbare und Grauenerregende ab. Im Alter gibt es dennoch keine Ausfälle mehr, die Ablehnung des Kreuzes wird jetzt näher begründet. So vermitteln die Lehrer in der Pädagogischen Provinz der Wanderjahre (1820) ihren Zöglingen das Leiden und den Tod Christi als „ein Vorbild erhabener Duldung“, halten es aber „für eine verdammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüst und den daran leidenden Heiligen dem Anblick der Sonne auszusetzen, die ihr Angesicht verbarg, als eine ruchlose Welt ihr dieß Schauspiel aufdrang“.34 Goethe hat wohl nur spätgotische und barocke Darstellungen mit ihrer oft drastischen Dramatik gekannt. Hätte er ein romanisches Kruzifix erlebt, das den Erlöser nicht als Leidenden und Sterbenden, sondern als Triumphator über Tod und Sünde in königlicher Ruhe darstellt, hätte er das Kruzifix vielleicht eher akzeptieren können.
Neben den dogmatischen Fragen hat sich Goethe auch mit dem kirchlichen Leben der Konfessionen, mit dem Kirchenregiment in Geschichte und Gegenwart, mit Frömmigkeit, Kult und Liturgie auseinandergesetzt. In der Kirchengeschichte erblickte er, ganz mit den Augen Arnolds, nach einem reinen Beginn im Urchristentum eine fortdauernde Verfallsgeschichte, wofür er die klerikale Verfassung, das „Pfaffenwesen“, wie er es gerne nannte, verantwortlich machte, bei dem er von jeher die Neigung zu Willkür und Unterdrückung zu wittern glaubte.35 – Kult und Liturgie nahm er vor allem in Italien wahr, fand den barocken Pomp katholischer Gottesdienste „prächtig und würdig“, aber doch auch überladen, so dass er als ein zweiter Diogenes ausrufen wollte: „Verdeckt mir doch nicht die Sonne höherer Kunst und reiner Menschheit.“36 Umso überraschender war es für die Zeitgenossen, als Goethe im 7. Buch von Dichtung und Wahrheit (1812)37 die sieben katholischen Sakramente als symbolischen Zyklus für den geistigen Zusammenhang des menschlichen Lebens würdigte und dabei so genau die transzendente Qualität der sakramentlichen Zeichen wahrte, dass schon damals katholische Leser voll Bewunderung waren38, protestantische hingegen vielfach Ärgernis nahmen.39 Zwei Jahre später erlebte Goethe auf seiner Rheinreise im Sommer 1814 katholische Volksfrömmigkeit. Er nahm am St.-Rochus-Fest in Bingen teil und bewies in seinem heiter-beschwingten Bericht40 über diese bunte und volkreiche Wallfahrt erneut eine erstaunliche Einfühlungskraft, diesmal in das Zugleich von katholischer Frömmigkeit und Lebensfreude, von Andacht und weinlustiger Geselligkeit. Diese Harmonie von Geistlichem und Weltlichem war Goethe überaus sympathisch, kam seiner eigenen Weltsicht recht nahe, und so hat er denn auch in der Schilderung des Rochusfestes diese Harmonie in vielen ernsten und humorvollen Szenen gezeichnet. Immer aber bleibt er Zuschauer, nicht eigentlich Teilnehmer, er beobachtet und registriert, ja die Kernstücke dieses Heiligenfestes – die Rochuslegende und die Schlusspredigt41 – werden lediglich zitiert, nicht kommentiert, nur ihre Wirkung auf die gläubigen Zuhörer genannt. Goethe bleibt also distanziert, begegnet aber hier – anders als in Italien – der katholischen Welt mit unverkennbarem Wohlwollen.
***
Die beiden letzten Beispiele zeigen den Anfang einer neuen Offenheit Goethes gegenüber ihm fremden oder fremd gewordenen religiösen Formen und Denkarten. Um 1813 weicht der bisherige Ausschließlichkeitsanspruch seines Pantheismus einer Trias religiöser Perspektiven. In den Maximen und Reflexionen findet sich der Satz: „Wir sind naturforschend Pantheisten, dichtend Polytheisten, sittlich Monotheisten.“42 Seine bisher vorherrschende Weltsicht wird jetzt auf das Gebiet der Naturforschung eingeschränkt, für sein Dichten reserviert sich Goethe die Vielfalt des heidnischen Götterhimmels und für sein persönliches Leben bekennt er sich zu dem einen Gott, der als Schöpfer, Erhalter und Richter auch von der protestantischen Theologie der Zeit aus der natürlichen Offenbarung abgeleitet worden war. Wenngleich Goethe mit dem Monotheismus nicht zum Christentum zurückkehrt, öffnet er sich doch wieder einer metaphysischen Anschauung der Welt.43 Ein wichtiges Zeugnis dafür ist der Begriff des „Dämonischen“, den Goethe 1813 für das letzte Buch von Dichtung und Wahrheit rückwirkend in die Geschichte seiner religiösen Entwicklung einfügt.44 Zunächst hatte er sein Leben nach den notwendigen, zielsicheren Naturgesetzen der pflanzlichen Metamorphose darzustellen gedacht, doch seit dem Frühjahr 1813 wird ihm dieses Modell fragwürdig, und er ersetzt es durch die Vorstellung eines von willkürlichen Außenkräften beherrschten Lebens.45 Diese Kräfte nennt er „das Dämonische“ und rückt es ausdrücklich in religiöse Zusammenhänge, indem er betont, dass ihm schon früh auf seinen Wanderungen von der „natürlichen“ über die „positive“ Religion bis zum „allgemeinen Glauben“ ein dazwischenliegendes „Ungeheures, Unfaßliches“ begegnet sei46, und er umschreibt dieses „Unfaßliche“ als „eine der moralischen Weltordnung, wo nicht entgegengesetzte, doch sie durchkreuzende Macht“47. Damit werden die immanenten Kräfte von Ich und Welt ihrer bisherigen Selbstherrlichkeit beraubt und von einer wie immer gearteten metaphysischen Komponente relativiert.
***
Wir haben bisher Goethes persönliches Verhältnis zum Christentum und seine Auseinandersetzung mit ihm und zugleich seine eigene religiöse Entwicklung in den Blick genommen und dafür vor allem Selbstzeugnisse verschiedener Art, aus Briefen, Gesprächen, autobiographischen Schriften und Spruchliteratur, herangezogen. Nun hat sich aber Goethe über Gott und die Welt nie nur philosophisch oder theologisch geäußert, er war auch – und dies in erster Linie – ein Dichter, und so hat er sein nuancenreiches Bild vom christlichen Glauben und Leben vielfach in seine Dichtungen aufgenommen und in poetische Bilder verwandelt, die auf dieser fiktiven Ebene einen neuen Symbolwert gewinnen. Ein paar Beispiele haben wir schon kennengelernt, einige weitere wichtige seien im Folgenden näher betrachtet, und zwar aus dem Doppelroman Wilhelm Meisters Lehrjahre und Wilhelm Meisters Wanderjahre sowie aus beiden Teilen der Faust-Dichtung.
***
In Wilhelm Meisters Lehrjahre hat Goethe 1795 als 6. Buch die „Bekenntnisse einer schönen Seele“48 eingelegt, die lange als bloße Überarbeitung einer realen herrnhutischen Konfession, nämlich der Susanna Katharina von Klettenberg, betrachtet worden sind. Auf den ersten Blick scheinen in der Tat zumindest die beiden ersten Drittel des Buches, also vor seiner Verknüpfung mit dem übrigen Roman, weithin mit realen pietistischen Konfessionen übereinzustimmen. Der Aufbau folgt durchaus dem Schema der Erweckungsgeschichte, ein Stufenweg führt zum Höhepunkt, einer Vision des Gekreuzigten; ja bis in den Wortlaut hinein erinnern diese „Bekenntnisse“ mit bestimmten Termini, Wendungen und Bildern deutlich an herrnhutische Lebensläufe. Aber alle diese Übereinstimmungen können und wollen nicht verbergen, dass hier nicht das Bekenntnis eines von oben her bestimmten Gnadenweges, sondern das einer sich in Stufen vollziehenden Selbstverwirklichung formuliert ist. Zentrum der Darstellung ist nicht mehr Gott, sondern die Sensibilität des Herzens oder der Seele, die durch äußere Umstände sofort auf sich selbst zurückgeführt wird. Wenn dabei jedes Mal der Wunsch erwacht, sich darüber mit Gott zu unterhalten und Hilfe bei ihm zu holen, dann wirken auch diese Gebete immer wie Selbstgespräche, worin eine sittliche Natur mit sich ins Reine kommen will. Ja, selbst die Vision Christi wird nicht, wie bei den Pietisten, als Epiphanie, sondern als eine durch höchste Konzentration des Geistes erfahrene innere Anschauung gedeutet. Ziel all dieser Anstrengungen der schönen Seele ist also nicht mehr die Erlösung durch einen gnädigen Gott, sondern die aus eigener Kraft erreichbare Selbständigkeit des Individuums gegenüber der Welt, weshalb ihre Bekenntnisse auch keinen Bekenntniston, sondern einen sehr ruhigen und distanzierten Erzählstil besitzen.
Bis in die übernommenen Stil- und Aufbauformen hinein erweisen sich so die „Bekenntnisse einer schönen Seele“ als Verwandlung der religiösen in eine psychologische Konfession. Goethe hat diese Säkularisation unternommen, weil er damit den traditionellen Nuancenreichtum religiöser Konfessionen in der Darstellung seelischer Zustände und Vorgänge für seine Erzählung nutzen konnte. Solche Säkularisation war zugleich notwendig, um dieses Lebensbild in die Welt des Oheims und des ganzen Romans als einen weiteren Bildungsweg aufnehmen zu können. Denn gerade die Umdeutung ihres religiösen Erlösungswunsches in den Willen zu geistiger und moralischer Selbständigkeit macht die schöne Seele dem Oheim wesensverwandt und zu einer positiven Begegnung mit diesem Repräsentanten höchster weltlicher Kultur fähig.
Eine andersartige Säkularisierung des Christentums, nämlich in Form eines religionsgeschichtlichen Lehrvortrags, unternehmen im 2. Buch von Wilhelm Meisters Wanderjahren (1820) die Oberen der Pädagogischen Provinz in langen Gesprächen mit Wilhelm.49 Die seltsame Gebärdensprache ihrer Zöglinge erklären sie als Ausdruck der Ehrfurcht vor dem, was über uns (Gott), neben uns (der Mitmensch) und unter uns (die Erde) ist. Auf diesen drei Ehrfurchten seien drei Religionen gegründet, die zuerst abstrakt erläutert und hernach in Bildergalerien illustriert werden:
1) die ethnische oder heidnische Religion, die Religion der Völker, zu deren Muster die israelitische Religion und Geschichte des Alten Testaments erklärt wird;
2) die philosophische Religion. Sie werde vom „Philosophen“ oder „Weisen“ vertreten, der „alles Höhere zu sich herab, alles Niedere zu sich herauf zieht“ und im Durchschauen aller Verhältnisse „allein in der Wahrheit (lebt)“. Nun aber erklären die Oberen diese „philosophische Religion“ mit Beispielen aus dem Leben und der Lehre Christi, mit Wundern und Gleichnissen aus dem Neuen Testament und verstehen Christus als „wahren Philosophen“ und „Weisen im höchsten Sinne“, der in den Armen und Kranken „das Niedere zu sich herauf zieht“ und durch seine Gleichstellung mit Gott „das Höhere“ zu sich herabzieht. Auf diese Weise wird der göttliche Erlöser zu einem Repräsentanten der Humanität in Lehre und Praxis säkularisiert, weshalb die Galerie nur Bilder von Christi Erdenwandel bis zum letzten Abendmahl, nicht von seinem Ende zeigt. Von diesem Ende sprechen die Pädagogen nur bei der Erläuterung der dritten,
3) der christlichen Religion. Von ihr heißt es, dass sie „Niedrigkeit und Armuth, Spott und Verachtung, Schmach und Elend, Leiden und Tod als göttlich anerkennt, ja Sünde selbst und Verbrechen [...] als Fördernisse des Heiligen verehrt und liebgewinnt“. Und da die Oberen das Leben Christi für fruchtbarer halten als seinen Tod, bleiben die Bilder „jener Verehrung des Widerwärtigen, Verhaßten, Fliehenswerthen“, also die Bilder der Passion Christi einschließlich des Kruzifixes, im „Heiligthum des Schmerzes“ verschlossen, das jedes Jahr nur einmal geöffnet wird. Diese christliche Religion wird als ein religionsgeschichtlich „Letztes“ bezeichnet, „wozu die Menschheit gelangen konnte und mußte“ – eine äußerste Konsequenz also in einer fast naturgesetzlich verstandenen Kulturgeschichte.
Im Anschluss an diese Aufzählung bekennen sich die Pädagogen zu allen drei Religionen, da sie zusammen erst die „wahre Religion“ hervorbringen, nämlich die Ehrfurcht vor sich selbst, die als oberste aus den drei Ehrfurchten entspringe.50 Dadurch gelange der Mensch zum Höchsten, was er erreichen kann, er dürfe sich für das Beste halten, „was Gott und Natur hervorgebracht haben“. Hier mündet die Religionslehre der Pädagogen in den Pantheismus der Zeit, der den „Gott in uns“ anbetet und die Menschen für „Söhne Gottes“ erklärt. Folgerichtig deuten die Oberen das christliche Credo in ihrem Sinne um. Sie finden nämlich in den drei Glaubensartikeln die ethnische, die christliche und die philosophische Religion ausgedrückt und interpretieren dabei die christliche wieder nur als Religion der Leidenden und bei der philosophischen die „Gemeinschaft der Heiligen“ als „der im höchsten Grad Guten und Weisen“. Und wenn daraufhin die mit den drei Artikeln verbundenen „drei göttlichen Personen“ für die „höchste Einheit“ gelten sollen, so erscheint die christliche Dreieinigkeitslehre nur noch als eher schiefe denn zutreffende Metapher für das Verhältnis der einen „wahren“ zu den drei historischen Religionen.
***
Zum Schluss sei der Stellenwert christlicher Glaubens- und Lebenswelt in einigen wichtigen Szenen der Faust-Dichtung erkundet. Es sind Szenen von existenzieller Bedeutung für die Titelgestalt dieser Tragödie: Faust wird an Angelpunkten seines Lebens mit dieser ihm fremd gewordenen Welt konfrontiert, wodurch sein eigenes Wesen schärfer konturiert, ja zuletzt umgewandelt wird.
Eine erste Begegnung erlebt Faust am Schluss51 der Eröffnungsszene „Nacht“ von Faust I. Als er dort nach dem Absturz aus seiner vermeintlichen Gottähnlichkeit diese Welt verlassen will und schon die Schale an den Mund setzt, hört er „Glockenklang und Chorgesang“, Wechselchöre der Osternachtliturgie aus benachbarter Kirche. Es sind nach dem Muster mittelalterlicher Osterfeiern Responsorien der Engel, der Frauen am Grabe, der Jünger des Herrn, die teils hymnisch die Auferstehung Christi preisen, teils den Verlust des nunmehr „lebend Erhabenen“ beklagen. Der von diesen Responsorien eingerahmte Monolog Faustens reagiert auf diese ihn überraschenden Klänge zunächst mit Fragen und Zweifeln, ja mit dem Versuch einer Abwehr, sich „jenen Sphären“ auszusetzen, „woher die holde Nachricht tönt“. Dann aber muss er bekennen, dass dieser ihm von Jugend auf gewohnte Klang und die damit verbundene Erinnerung an frühe Erlebnisse geistlicher Art ihn vom letzten Schritt zurückhalten, und er wünscht am Ende gar das Forttönen der „süßen Himmelslieder“. Sosehr hier an sich die inhaltliche Analogie gegeben ist zwischen der Auferstehung des Herrn und der Auferstehung des Faust, nämlich aus tiefster Verzweiflung zu neuem Lebensmut – der Dichter hat darüber hinaus deutlich machen wollen, dass im religiösen Bereich nicht nur Glaubensinhalte, sondern vielleicht noch mehr frühe Kindheitseindrücke, vermittelt durch Liturgie und Kirchenlieder, unverlierbare Wirkmacht besitzen.
Eine ganz andere, für ihn höchst prekäre Konfrontation mit dem Christentum erfährt Faust im Religionsgespräch mit Gretchen (schon im Urfaust, 1774 entstanden)52. Das zu kirchlicher Frömmigkeit erzogene Mädchen wünscht die Rettung des Geliebten vor dem ewigen Tod und ist deshalb um seine religiöse Einstellung besorgt. Auf alle ihre konkreten Fragen nach Glaube an Gott, nach Kirchgang und Sakramenten weicht Faust ins Unbestimmte aus und ergeht sich in enthusiastischer Rhetorik mit sich steigernder Fragesatzkette, die den „Allumfasser“, den „Allerhalter“ schließlich in die Seligkeit des eigenen Gefühls verwandelt, wofür er „Glück! Herz! Liebe! Gott!“ als austauschbare und doch immer unzureichende Namen zur Auswahl stellt. Gretchen versucht ihm zwar zu folgen, erkennt aber am Ende die Unvereinbarkeit von Faustens pantheistischem Bekenntnis und ihrem eigenen Glauben:
Steht aber doch immer schief darum;
Denn du hast kein Christenthum.53
Faust kann darauf nichts mehr erwidern und verlegt sich bei der anschließenden Kritik Gretchens an Mephistopheles und an Fausts Partnerschaft mit diesem Gesellen aufs Lügen und Beschönigen, um die Liebe Gretchens nicht zu verlieren.
Der Dichter hat mit dem einfachen und sicheren Glauben Gretchens und mit ihrer daraus entspringenden Sorge um das Seelenheil ihres Geliebten erneut die ganze Liebenswürdigkeit dieses Mädchens gestaltet. Faust hingegen erscheint als einer, der nicht nur den ihm gestellten Fragen ausweicht, sondern mit der Suada seines Bekenntnisses die Geliebte beeindrucken und damit verführen will, was ihm ja auch am Ende des Gesprächs mit der Verabredung für die kommende Nacht gelingt.54
Hier findet also nirgends eine Säkularisation des Christlichen statt, vielmehr arbeitet die ganze Szene das einfache, unverstellte Christentum Gretchens und den überschwenglichen Pantheismus Faustens als scharfe Gegensätze heraus und wertet die eine Seite als selbstlos, sicher und gefühlswahr, die andere als egozentrisch, unverbindlich und zweideutig. Das ist umso bemerkenswerter, als das Bekenntnis des Faust im Religionsgespräch „Grundüberzeugungen der Geniezeit“55 und also auch des jungen Goethe formuliert. Das aber hindert diesen als Dichter nicht, in poetischer Distanz ein nach altem Brauch christgläubiges Gemüt durch und durch positiv zu zeichnen und dagegen den eigenen modernen Pantheismus als eine zwielichtige und fragwürdige Haltung erscheinen zu lassen.
Dieser religiöse Gegensatz zwischen Faust und Gretchen bleibt aber in dieser Tragödie nicht Gegenstand eines bloßen Gesprächs; er gewinnt existenzielle Bedeutung bei ihrer nächsten und zugleich letzten Begegnung – im Kerker56. Fausts verzweifelte Versuche, die Geliebte aus der Haft und vor dem Tod zu retten, scheitern endgültig, als Mephistopheles in der Tür erscheint und zur Eile mahnt. Der im Wahnsinn hellsichtige Blick des Mädchens erkennt untrüglich den Bösen:
Was will der an dem heiligen Ort?
Er will mich!57
Warum nennt sie den Kerker einen „heiligen Ort“? Weil sie inzwischen über die Todesangst hinweg zu einer elementaren Bereitschaft gefunden hat, ihr Schicksal anzunehmen, für ihre Schuld zu büßen und das irdische Gericht für das göttliche zu nehmen:
Gericht Gottes! Dir hab’ ich mich übergeben!
[...]
Dein bin ich, Vater! Rette mich!
Ihr Engel! Ihr heiligen Schaaren,
Lagert euch umher, mich zu bewahren!58
Abwehr des Teufels durch Selbstüberantwortung an das rettende Gericht des Vaters und durch Anruf der schützenden Engel – mit diesem entschlossenen Schritt begibt sich Gretchen wieder ganz in die ihr vertraute religiöse Welt, die allein sie vor dem ewigen Verderben bewahren kann. Faust hingegen, vor dem es Gretchen am Ende graut, erscheint als der schlechthin Ohnmächtige, sie zu retten, und mehr denn je als der dem Teufel Verfallene, den dieser mit einem brutalen „Her zu mir!“ von der Geliebten zu sich herüberreißt.
Mit Gott, Engel und Teufel gewinnt diese letzte Szene des Ersten Teils der Tragödie eine religiöse Dimension von barockem Ausmaß. So übernimmt Mephistos Urteil über Gretchen: „Sie ist gerichtet!“59 eine Tradition aus dem frühen Welttheater, das noch im Puppenspiel Doktor Johannes Faust bis ins 18. Jahrhundert lebendig ist. Während aber dort dem Richterspruch „judicatus es“ alsbald ein „damnatus es“ folgt 60, entgegnet in Goethes Drama die „Stimme von oben“: „Ist gerettet!“61 – ein bestätigendes Zeugnis des Himmels, dass Gretchens Buße angenommen ist. Zudem ist diese „Stimme“ das einzige Zeichen „von oben“, das in das irdische Geschehen dieser Tragödie eingreift. Es ist sowohl eine kurze Erinnerung an die höhere Ebene des „Prologs im Himmel“ als auch ein verheißungsvoller Vorklang auf die „Bergschluchten“-Szene, den Schluss also der gesamten Faust-Dichtung, wo Gretchen im Aufgang zum Himmel als die gerettete Büßerin erscheint.
Über diese „Bergschluchten“-Szene62, mit der Faust II schließt und mit der auch wir unsere Beispielreihe abschließen wollen, hat Goethe zu Eckermann am 6. Juni 1831 bemerkt: „Übrigens werden Sie zugeben, daß der Schluß, wo es mit der geretteten Seele nach oben geht, sehr schwer zu machen war und daß ich, bei so übersinnlichen, kaum zu ahnenden Dingen, mich sehr leicht im Vagen hätte verlieren können, wenn ich nicht meinen poetischen Intentionen durch die scharf umrissenen christlich-kirchlichen Figuren und Vorstellungen eine wohltätig beschränkende Form und Festigkeit gegeben hätte.“63 Mit den „christlich-kirchlichen Figuren“ meint Goethe heilige Anachoreten und Büßerinnen aus biblischer und frühchristlicher Zeit, die zusammen mit Engeln verschiedenen Grades in hierarchischer Ordnung im Aufblick zur Mater gloriosa als dem Mittel- und Höhepunkt dieses eher katholischen als protestantischen Himmels gruppiert sind. Die „christlich-kirchlichen Vorstellungen“ hingegen werden in dieser Szene nicht unverändert übernommen. Schon die Botschaft der Engel über das endliche Schicksal Faustens, dessen „Unsterbliches“64 sie tragen, weicht vom Bild des christlichen Heilswegs ab:
Gerettet ist das edle Glied
Der Geisterwelt vom Bösen,
„Wer immer strebend sich bemüht
Den können wir erlösen.“
Und hat an ihm die Liebe gar
Von oben Theil genommen,
Begegnet ihm die selige Schaar
Mit herzlichem Willkommen.65
Nicht Glaube und gute Werke, sondern Streben und Sich-Bemühen, eine rastlose Tätigkeit werden als Bedingung genannt, wie sie ja schon der Herr im „Prolog im Himmel“ von Faust gefordert hatte.66 Zwar hat dieser solche Bedingung sein Leben lang erfüllt, sich dabei aber immer wieder in tiefe Schuld verstrickt. Dennoch findet jetzt kein Gericht Gottes über Faust statt, wie es Goethe ursprünglich in einem Epilog im Himmel (als Gegenstück zum „Prolog“) mit Christus als Richter geplant hatte.67 Vielmehr sprechen die Engel von der „Liebe von oben“ als der entscheidenden Erlösungskraft. Vollends aber weicht die Art und Weise, wie Faust die „Liebe von oben“ zuteil wird, von christlicher Heilsvorstellung ab. Denn weder der Herr noch Christus schenken ihm Gnade und Verzeihung, sondern die Mater gloriosa, die vom Doctor Marianus mit angerufen, ja angebetet wird.
Jungfrau, Mutter, Königin,
Göttin, bleibe gnädig! 68
Als Mittlerin dieses Gnadenakts aber fungiert Gretchen, die hier als „Una Poenitentium, sonst Gretchen genannt“69 im Kreis berühmter Büßerinnen des Neuen Testaments erscheint und von diesen in ihrer Fürbitte für Faust unterstützt wird:
Neige, neige,
Du Ohnegleiche,
Du Strahlenreiche,
Dein Antlitz gnädig meinem Glück.
Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte
Er kommt zurück.70
Mit der Kontrafaktur ihres frühen Hilferufs zur Mater dolorosa lässt Gretchen ihre eigene Umwandlung von der Verzweifelten zur Geretteten erkennen, ihr ganzes Glück ist die Rückkehr des Geliebten, ihr einziger Wunsch sein Aufstieg „zu höhern Sphären“.
Wenn hier Maria die Stelle der Dreifaltigkeit einnimmt und als Himmelskönigin vergöttlicht wird, soll sie die gnadenhafte göttliche Liebe unter weiblicher Form, als das „Ewig-Weibliche“ verkörpern. Und wenn Gretchen daran mitwirken darf, Faustens Unsterbliches zu „höhern Sphären“ emporzuführen und so zu neuem Leben „umzuarten“, hat auch ihre menschliche Liebe teil an der göttlichen. Solche Heiligung des Irdischen ist hier Goethes „poetische Intention“, christlichen Himmel und christliche Gedanken als Bilder für die eigene Humanitätsidee zu gewinnen. Darin Blasphemisches zu sehen, wäre ein Missverständnis. Goethe wollte durch die scharfen Umrisse der kirchlichen Figuren und Vorstellungen nur eine einigermaßen bühnengerechte Anschaulichkeit der an sich unbeschreibbaren Vorgänge erreichen. In einem Punkt freilich hat er die Festigkeit des christlichen Himmels bewusst verschmäht. Denn während Dante im „Paradiso“ einen klar begrenzten, neunfach gegliederten Sphärenhimmel durchwandert, um am Ende in der höchsten Höhe inmitten der wiederum neun Chöre der Engel das Licht der Dreifaltigkeit zu erblicken, steigt der Weg des erlösten Faust über die Bergschluchten hinauf immer weiter ins Unendliche und Unabsehbare, so dass er am Schluss des Dramas keine Erfüllung findet, sondern der Prozess seiner Vervollkommnung erst beginnt und wohl nie ein Ende finden wird71 – ein Bild für die unsterbliche und sich nur immer steigernde Existenz der entelechischen Monade, zugleich ein Bild für die Unerforschlichkeit und Unerreichbarkeit des Göttlichen, in dessen unendlichen Räumen „wir verschweben, wir verschwinden“, wie es der sinnverwandte Schluss des Divan-Gedichts Höheres und Höchstes verkündet.72
***
Blicken wir am Ende auf unser vielschichtiges Thema zurück, so können wir festhalten: Goethes Verhältnis zum Christentum und seine Auseinandersetzung mit ihm sind nur vor dem Hintergrund der auch für das religiöse Denken radikalen Umbruchzeit der Aufklärung verständlich, die bis in die Theologie hinein den Glauben an die übernatürliche Offenbarung Gottes aufgegeben und an seine Stelle eine neue Vernunftreligion gesetzt hat. In diesem Rahmen ist die religiöse Entwicklung des jungen Goethe durch einen allmählichen, sich in Stufen vollziehenden Abschied vom kirchlich gebundenen Christentum und eine damit korrespondierende Entscheidung für eine persönliche Variante des zeitgenössischen Pantheismus gekennzeichnet. Aus diesem Blickwinkel der eigenen Religion beurteilt Goethe in Selbstzeugnissen verschiedener Art (Briefen, Gesprächen, Spruchliteratur) das Christentum seiner Zeit teils positiv, teils kritisch, ja mitunter polemisch, namentlich in der klassischen Epoche seiner mittleren Jahre. Im Alter dagegen öffnet er sich wieder einer metaphysischen Anschauung der Welt, ja bekennt sich im Sittlichen zum Monotheismus.
Eine vom persönlichen Urteil Goethes unabhängige Gestalt gewinnt das Christentum in seinen Dichtungen. Entweder bewahrt Goethe hier dem Christentum seine ursprüngliche Kontur, etwa als Kontrast zum pantheistischen Bekenntnis (Faust I), oder er verwertet säkularisierend die christliche Bild- und Gedankenwelt als anschauliche Symbolik seiner Humanitätsidee (Lehrjahre, Wanderjahre, Faust II). Immer aber bleiben in Goethes poetischen Werken die Erscheinungsformen christlichen Glaubens und Lebens unangetastet, verschont von jedem Sarkasmus und jeder Ironie. Vielmehr empfindet der Dichter Goethe das Christentum stets als hohes Kulturerbe von noch immer lebendigem Wert, unentbehrlich auch und gerade für die Gestaltung seines eigenen Werkes.