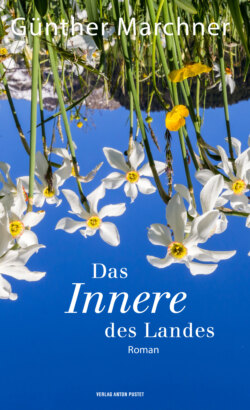Читать книгу Das Innere des Landes - Günther Marchner - Страница 7
Das Haus
ОглавлениеNach einem langen Flug und einer kurzen Nacht erscheint John der Aufwand absurd. Apathisch und verloren blickt er aus dem Zugfenster und muss noch einmal daran denken, wie er der Agentur mitgeteilt hatte, dass er spontan anreisen werde, nämlich schon in ein paar Tagen – tatsächlich, es ist sicher das Vernünftigste. Aber die Flugkosten, ist das nicht doch ein bisschen viel Aufwand? – Aber wie stellen Sie sich vor, soll ich das sonst klären? Sie haben es mir ja selbst geraten.
Die Landschaft ist er nicht gewohnt, so kleinteilig und ein wenig zu schön erscheint sie ihm, einfach zu perfekt, während seine Gedanken an zu Hause durch seinen Kopf kreisen, bis er in dieser Stadt einfährt, wo er vorläufig stoppen und umsteigen wird. Er war mit dem Zug aus München gekommen. Irgendwo muss die Grenze gewesen sein, als er Wiesen, Flüsse, Bäche, Straßen, Häuser passierte. Aber wo war diese Linie? Als er die Landschaft mit übermüdeten Augen zur Kenntnis nimmt, erscheint ihm alles fremd, er fühlt sich merkwürdig deplatziert. Ein skurriler Ausflug. Zweifel schleichen sich heran.
Was soll ich mit diesem alten Haus, in einer Gegend, die sie verlassen hat, über die sie, wenn überhaupt, nur schlecht geredet hat, zu der ich keinen Bezug habe?
Sogar Kaufinteressenten hatte es gegeben, so seine Mutter damals. Aber dann ist die Großmutter gestorben, dann der Unfall der Eltern, und nun die Erbschaft, die ihm ein Notar vor wenigen Wochen erklärt hatte. Bei nächster Gelegenheit einfach verkaufen, dachte er noch.
Dann hatte er nicht mehr daran gedacht. Bis zum Anruf.
John ist mit etwas konfrontiert, das er schwer greifen kann, womit er nicht das Geringste zu tun hat.
Auf dem Bahnhof überlegt er die Weiterreise. Er entscheidet sich dafür, kein Leihauto zu nehmen. Er hatte gehört, man könne gut mit dem Zug fahren und die Landschaft betrachten. Warum eigentlich nicht? Er denkt, dass er sich Zeit lassen kann, dass er genug Zeit hat, es zieht ihn nicht zurück. Er beschließt, die Sache langsam anzugehen, sich Zeit zu nehmen für Bus und Zug, für die Gegend. Vielleicht war er in den letzten Jahren ohnehin zu schnell gewesen, zu hastig, zu eingespannt. Vielleicht hatte er auf diese Weise vieles übersehen, nicht mehr wahrgenommen.
Hat er wieder zu viel vor? Lass dir Zeit, lass los, hör zu, schau hin und warte, was kommt.
Er erkundigt sich am Schalter, wie er wohl ins Ausseerland kommen würde. Es scheint komplizierter zu sein, als er sich das vorstellt.
Also, Sie fahren mit dem nächsten Zug, oder besser, dem übernächsten, dann steigen Sie um, sagt der Mann am Schalter. Dann warten Sie auf den Anschlusszug ins Salzkammergut. Und dann …
Und dann?
Ja, dann, meint er zögernd, dann gibt es leider nur folgende …
Der Mann am Schalter schaut auf den PC und sucht …
So lange?
Ja, es sind ausschließlich Regionalzüge, die bleiben fast alle überall stehen.
Als er die Gegend Stück für Stück, von Bahnhof zu Bahnhof durchquert, denkt er an alles andere als an diese besondere Landschaft, auf die fortwährend von irgendjemandem hingewiesen wird, wenn er umsitzende Fahrgäste sprechen hört. Hier der Traunsee, zuerst von der Gmundner Seite, dann von Altmünster und Traunkirchen aus gesehen – ah, der Traunsee, schau –, dann von der dunkleren Ebenseer Seite. Dann dieser Hallstättersee – schau, der Hallstättersee –, wo asiatische Frauen und Männer an einem winzigen Bahnhof entzückt aus dem Zug springen und zur Fähre laufen. So eng, so dunkel, so spektakulär. Berge, die sich vom romantischen Anblick aus der Ferne zu steinigen Monstern in unmittelbarer Nähe verwandeln, manchmal erhaben, manchmal bedrohlich, lästig, steinig.
Was tun all die Leute hier?
Wie soll er sich das vorstellen, was in diesen Gegenden vor über 60 Jahren geschehen sein mochte, aus der seine Großmutter ausgewandert ist? Es fällt ihm schwer, sich ein Bild davon zu machen, was in all diesen Postkartenlandschaften alles möglich gewesen war. Aber er hatte davon gelesen.
Während die Ansichten an ihm vorbeiziehen, denkt er an seine Frau, seine Lage, seine Anreise, seine Flucht. Er ist müde, die Tageszeit stimmt irgendwie nicht. Sein Körper will schlafen.
Als er aussteigt und am Bahnhof herumschlurft, herumsteht und herumwartet. Ein schattiger Platz, hohe Gesimse, gelbe Wände eines altehrwürdig erhaltenen Gebäudes, aus einer anderen Zeit gefallen. Weiße Aufschriften auf eisenbahndunkelblauem Hintergrund. Eine kühle Dunkelheit legt sich vom steilen Berghang auf den Wald knapp über der Böschung oberhalb des Bahnhofs, mit mehreren nebeneinanderliegenden Schienen, mit einer Lok, die im Hintergrund wartet, mit roten Kontakt- und Signallichtern und einem knarrenden Lautsprecher mit blecherner Durchsage.
Er hatte sich dieses Haus noch gar nicht vorgestellt, vielleicht ein Holzhaus, ein sogenanntes Alpinhaus, er wird sehen. Am Bahnhof telefoniert er mit der Agentur, weil er eine Unterkunft braucht. Er hatte gar nicht daran gedacht, die Agentur auch nicht. Er bittet den Mitarbeiter, sich darum zu kümmern.
Aber Sie haben ja ein Haus.
Schon, aber ich weiß nicht, in welchem Zustand.
Wenn Sie meinen. Wir besorgen ihnen ein Zimmer, fürs Erste.
Dann fragt er am Bahnhof, wie er zum See komme.
Mit dem Bus? Der fährt erst in einer Stunde.
Da kann ich ja zu Fuß gehen, nein, mit dem Taxi. Gibt es hier ein Taxi?
Er gibt auf, als er einen verständnislosen Blick erntet. Dann hängt er sich seine beiden Rucksäcke um, geht einfach los und streckt den Daumen hinaus. Die meisten deuten ihm einen Vogel, bis plötzlich doch jemand anhält.
Den möchte ich kennenlernen, der hier autostoppt, meint der Fahrer. Sie sind wohl nicht von hier?
Nein, wirklich nicht.
Wo müssen Sie hin? Aha! Das trifft sich gut. Ich nehm Sie mit.
Der Mann lacht und lässt ihn nach einer Viertelstunde irgendwo in der Ortsmitte aussteigen.
Die Häuser fallen ihm auf, die Fassaden, viel Holz, Veranden, kleine Fenster, Geschnitztes, Blumen, die schöne Lage. Aber er muss alles erfragen, ihnen alles aus der Nase ziehen, bis er findet, was er sucht, bei der örtlichen Bank, die gleichzeitig das Immobilienbüro beherbergt. Dort trifft er auf seine Kontaktperson, mit der er bereits am Flughafen und zuvor telefoniert hatte.
Die scheinen überrascht zu sein, dass er plötzlich vor ihnen steht. Er, dem sie lange Zeit vergeblich nachgelaufen waren. Nun braucht er sie. Ein wenig hilflos stehen sie sich gegenüber.
Hier bin ich!
Aha. Sie sprechen gut Deutsch.
Ich bin damit aufgewachsen, zumindest zu Hause bei der Familie.
Hatten Sie einen schönen Flug? Was, Sie waren noch nie hier in unserer schönen Gegend, die doch alle kennen?
Ich bin müde.
Diese Person, die ihm den Hausschlüssel aushändigt, irritiert John, eine merkwürdige Mischung aus Bürokrat und Makler, schmierig servil und gleichzeitig gar nicht dienstleistungsorientiert, wie ihm scheint.
Ach so, Sie wissen ja gar nicht, wo das Haus steht. Ich bringe sie hin.
Das könne warten, meint John. Er müsse sich ausruhen, schlafen, zuerst brauche er die Unterkunft, er melde sich dann in der Früh.
Es sei gerade noch Frühsaison, meint ein junger Kollege, perfekt frisiert und in steifer Tracht gekleidet. Es gebe noch freie Zimmer. Im Hotel ganz in der Nähe sei eines für ihn reserviert, mit Option auf Verlängerung.
John checkt ein. Ein alter Kasten, offensichtlich vor Kurzem renoviert. Er setzt sich in die Lobby mit Bar und Seeblick. Sein Blick auf die Getränkekarte bleibt auf dem großen Braunen hängen, er schmunzelt und bestellt das Getränk. Der Kaffee, serviert in einer Porzellantasse und mit einem kleinen Glas Wasser, schmeckt ihm ausgezeichnet, das ist er nicht gewohnt, vor allem nicht die Intensität, daher bestellt er noch ein großes Glas Wasser dazu. Er stöbert in ein paar Tageszeitungen, er muss sich an deutsche Texte wieder gewöhnen, aber es fällt ihm nicht so schwer. Die Rezeptionistin scheint ihn zu beobachten, er lächelt ihr zu, sie lächelt zurück, professionell.
Ja, er sei gut angekommen, sagte er am Telefon seiner Frau, sie hatte nach einigen Versuchen dann doch abgehoben, er wollte ihr unbedingt Nachricht geben, ein Signal der Verbundenheit, die Verbindung möchte er aufrecht erhalten, irgendwie, obwohl er gerade das Gegenteil tut. Er werde sich jetzt einmal ausruhen und morgen Vormittag das Haus aufsuchen, teilt er ihr mit.
Als er am nächsten Morgen, noch müde und unausgeglichen wegen des Zeitunterschieds, ein ausführliches Frühstück zu genießen versucht, erreicht ein Anruf der Agentur die Hotelrezeption. Man werde einen Mitarbeiter zu ihm schicken, nach dem Frühstück.
Sie fahren auf einer schmalen Straße aus dem Ortszentrum hinaus bis unterhalb des Waldrandes und parken an einem Zaun. Dahinter befinden sich ein verwildeter Garten mit Sträuchern, ein altes Haus mit sonnseitig braungebranntem Holz, grauer Wetterseite und kleinen Fenstern. Zum Ensemble gehören auch ein Schuppen, ein kleiner leerer Stall, ausgewachsene Obstbäume und ein von Betonstreifen eingefasstes und zugewachsenes Gemüsebeet. Hinter dem Haus sieht er eine Wiese, die in einen Hang übergeht, der bis zum Waldrand reicht. Am oberen Rand der Wiese steht eine Hütte, dahinter ein Weg, zwischen Wald und Hütte durchführend.
Ein Knusperhaus mit Lärchenfassade, stellt John fest, als er das Haus betritt. Ein Gebäude ohne Zentralheizung. Es sei nur im Sommer zum Aushalten, heißt es, und der dauert nicht so lange. Im Winter geht es nur, wenn man ständig da ist und wenn man die kleinen Öfen kräftig einheizt, vor allem auch, damit die Wasserleitungen nicht zufrieren und platzen. Die bisherigen Vermieter waren meistens nur im Sommer da, zwischendurch auch an Wochenenden und dann rund um Weihnachten auch. Den Rest der Zeit war das Wasser abgedreht. Ein paar kleine Investitionen hatten die langjährigen Mieter auch getätigt, aber schon vor Jahrzehnten. Aber während dieses Rests der darauffolgenden Jahre habe der Zahn der Zeit am Haus genagt, vieles sei renovierungsbedürftig und entspreche nicht mehr den Standards.
Es sei schwer zu vermieten, meint der Mitarbeiter des Immobilienbüros. Da müssten Sie investieren, oder Sie verkaufen es einfach, wie es ist. Vielleicht haben Sie Glück. Es gäbe ja immer wieder Liebhaber, für die Geld gar keine Rolle spiele, gerade hier in dieser Gegend. Da kaufen manche Leute gerne einmal eine Baustelle für teures Geld, allein wegen des Platzes und wegen der Atmosphäre der alten Bausubstanz.
Also, wenn Sie mich fragen: Am besten, Sie verkaufen das Haus so rasch wie möglich. Es gibt ja durchaus Interessenten. Aber die wollen nicht das Haus, sondern den Platz. Soll ich …?
John winkt ab.
Ich frage Sie eben nicht. Also lassen Sie mich jetzt damit in Ruhe!
Der Mitarbeiter übergibt ihm den Schlüssel. Er räumt die beiden Rucksäcke aus dem Auto, stellt sie an den Gartenzaun und verschwindet. John betritt das Vorhaus. Eine steile Stiege führt in den ersten Stock hinauf, nach dem Eingang links geht es in eine Küche mit einem alten Eisenherd, daneben befindet sich ein kleiner E-Herd. Überall kleine Fenster mit tiefen Fensterstöcken. Von der Küche führt eine Hintertüre in eine Stube, danach noch eine in ein Zimmer, dahinter befindet sich ein Bad, das die Mieter auf eigene Kosten eingebaut haben. Geradeaus geht es zur Waschküche mit Hinterausgang.
Noch zu Hause hatte er bereits ein Telefonat mit den früheren Mietern geführt, um einen Eindruck zu erhalten, was auf ihn zukommt. Sie hätten gar keinen schriftlichen Mietvertrag gehabt, so der Sohn der Familie. Alles sei mündlich vereinbart und geregelt gewesen, auf freundschaftlicher Basis. Stellen Sie sich das vor! Sie wollten das Verhältnis irgendwann einmal formalisieren, auf eine bessere rechtliche Basis stellen, aber seine Großmutter war daran nicht interessiert. Sie wollten einen schriftlichen Vertrag, nicht nur eine mündliche Vereinbarung, auch wenn diese sehr kostengünstig war. Sie hätten zwar weiterhin Interesse gehabt, das Haus zu nutzen, aber da wären größere Reparaturen und Investitionen zu machen gewesen. Das konnten und wollten sie nicht leisten. Die inzwischen gefährlichen Stromleitungen, das Bad und andere Dinge seien zu erneuern. In den Wänden und unter den Böden hätten sich Mäuse breit gemacht, die nagen alles an und hinterlassen einen Saustall. Insgesamt sei es halt ungemütlich und unbequem geworden. Und sie konnten die Kosten dafür natürlich nicht übernehmen. Sie überlegten deshalb, das Haus sogar zu kaufen, aber seine Großmutter wollte das nicht, was sie nicht verstanden hätten. Als sie gestorben war, hatten sie nichts in der Hand, außer der nachweisbaren Tatsache einer mündlichen Vereinbarung und einer langjährigen Nutzung. Nun hätten sie jedoch etwas anderes gesucht, denn er und seine anderen Geschwister wollten nicht mehr so weitermachen, das wäre schlussendlich entscheidend gewesen. Abschließend hatte der Sohn der Familie John noch auf einige Dinge im Haus hingewiesen, auf Räume, auf Einrichtungen, auf Mängel, damit er sich orientieren könne.
John schaut sich in allen Räumen um, bis er das Zimmer mit dem bezogenen Bett findet, leicht angestaubt. Die Räume sind modrig und stickig, schon längere Zeit war hier nicht mehr gelüftet worden. Er öffnet alle Fenster. In einem Kasten findet er Bettwäsche auf Vorrat. Auf dem Dachboden, den er durch eine schmale Öffnung betritt, hält er es nicht lange aus, dicke Luft hängt unter dem Dach. Eine Staubschicht bedeckt den Boden, die Truhen, Kisten und Stühle.
In der Küche nimmt er sich einen Stuhl, setzt sich an ein Fenster und denkt nach. Wie kommt er an Lebensmittel? Würde er nicht ein Fahrzeug brauchen? Zunächst will er sich im Ort umsehen, um sich zu orientieren und um sich zu versorgen. Er leert seine beiden Rucksäcke und macht sich zu Fuß auf den Weg. Eine Frau, die am Gartenzaun steht, winkt ihm zu, überrascht und neugierig blickend. Leute grüßen ihn, obwohl sie ihn nicht kennen, er grüßt zurück, obwohl er das gar nicht will, aber es er tut es einfach. Er findet ein Geschäft und beschafft sich das Notwendigste, später möchte er in einem dieser Wirtshäuser essen. Dann sucht er Holz, das er schließlich in einem Schuppen findet, mehrere Stapel aufgeschichteter Holzscheiter, staubtrocken.
Am Abend sitzt er mit dem Rücken an der Wand stumm am Ecktisch eines Wirtshaussaals und studiert die Einrichtung, die Menschen, die Speisekarte. Niemand interessiert sich für ihn. Die Leute von hier sind Leute gewöhnt, die nicht von hier sind. Niemand schaut ihn an.
Für die weitere Klärung des Hauszustandes schickt ihm das Immobilienbüro einen Handwerker vorbei, den sie schon Tage zuvor engagiert hatten, damit er sich auch wirklich Zeit nimmt. Der Handwerker geht durch das Haus, prüft Wände, Installationen, alle Räume, er lächelt.
Wenn ich Ihnen etwas sagen darf: Die Bausubstanz ist vielleicht in Ordnung, bis auf ein paar Teile. Aber das alles auf Stand zu bringen und zu reparieren, bedeutet mehr Aufwand und mehr Kosten als ein Neubau. Man muss alle Leitungen überprüfen, wahrscheinlich muss man sie herausreißen und erneuern. Es braucht sicherlich eine Zentralheizung, und die Wasserleitungen gehören ebenfalls erneuert.
Die Dämmung?
Na ja. Der Handwerker klopft an den Außenwänden und verdreht die Augen.
Aber das Wichtigste ist das Dach, vor allem das Dach. Hier gäbe es ein paar undichte Stellen. Das wäre dringend.
Und die Mäuse?
Die Mäuse? Fallen stellen, Löcher zumachen, hier haben sich ganze Familien einquartiert.
Den Handwerker scheint die Sache nicht wirklich zu interessieren. Eine richtige Renovierung ist zu viel Arbeit.
Wer zahlt so etwas? Sie vielleicht?
Darauf will er sich gar nicht einlassen.
John bedankt sich und vereinbart mit ihm einen weiteren Termin, um vorhandene Geräte und noch verwendbare Materialien zu sichten. Der Garten ist ausgewachsen und überwuchert. John versucht das hohe und gelblich-braune Gras mit einer alten stumpfen Sense zu mähen, die er im Schuppen findet. Er ist ungeschickt, er kann das nicht, die Wiese sieht danach eher angenagt als gemäht aus. Den Rest erledigt er mit einem in seiner Not vom Handwerker geliehenen Rasenmäher.
Er weiß gar nicht, wo er anfangen soll, und dann noch diese Einschätzungen des Handwerkers. Er könnte allfällige Reparaturen auch als Investition betrachten, so dieser zum Abschluss seines ersten Besuchs. Wenn er das Haus wieder in Schuss bringe, könne er es auch für einen entsprechend besseren Preis verkaufen.
Er könne sich dies aber derzeit nicht vorstellen, er habe keine Zeit dafür, so John. Er möchte es einfach loswerden, sollen sich andere darum bemühen.
Am einfachsten wäre es natürlich, so der Handwerker, Sie verkaufen es, wie es ist. Oder sie reißen es ab und bauen neu drauf. Alles andere ist Liebhaberei und Plage, außer du bist ein Liebhaber und hast Zeit und Geld dafür.
John befindet sich angesichts seiner Umstände nicht in der Stimmung für spontane Kontakte. Er ist darauf gebürstet, die ganze Sache möglichst rasch hinter sich zu bringen. Aber nun steht dieses illustre dürre Weibsbild an seinem Gartenzaun, wippt den Kopf hin und her wie ein neugieriger Vogel und grüßt ihn. Er kann diese Frau auf den ersten Blick nicht einordnen. Ist sie eine Einheimische? Eine Touristin, die sich zufällig hierher verirrt hat? Erst später wird er merken, dass mehrere dieser hybriden Wesen diese Gegend bevölkern. Wie sieht sie denn eigentlich aus? Ist sie von dieser Welt oder ist sie eine Fee, eine Seehexe, eine Zauberin, eine übriggebliebene Prinzessin, die elfenhaft, aber mit festem Schuhwerk und hoch aufgestecktem Haar vor seinem Gartenzaun steht?
Was wollen Sie von mir?
Ich? Ich möchte Sie begrüßen. Sie sind im Grunde mein Nachbar, zumindest wenn Sie da sind.
Nachbar?
Sie deutet nach hinten, auf ein Holzhaus, aber hier gibt es ohnehin nur Holzhäuser oder Häuser aus Holz, spätestens ab dem ersten Stockwerk.
Ich wohne hier, lacht sie, als John sie befremdet und abweisend ansieht, wodurch sie sich allerdings nicht aus der Ruhe bringen lässt.
Ich bin kein Nachbar, sondern nur der Eigentümer dieses leicht heruntergekommenen Hauses, das ich verkaufen werde.
Natürlich.
Woher er komme, fragt sie ihn, und er gibt ihr die übliche Auskunft.
Sie sprechen sehr gut Deutsch!
Meine Großmutter sprach es mit meiner Mutter und mit mir. Und meine Mutter mit mir auch. Es kann nicht schaden, meinten sie. Ich bin mit der englischen und der deutschen Sprache gleichzeitig aufgewachsen. Wenn ich das Haus verlassen habe, habe ich einfach die Sprache gewechselt.
Ihre Großmutter?
Ja, sie stammt ja von hier, ihr gehörte dieses Haus.
Ich dachte immer, das Haus gehört den Leuten, die über viele Jahre ständig hier waren. Zumindest haben die immer so getan, als würde es ihnen gehören. Warum ist sie ausgewandert?
Das ist eine lange Geschichte, es ist besser, wir fangen gar nicht damit an. Außerdem weiß ich nicht viel darüber.
Schade, ich wüsste gerne mehr darüber. Ich bin von Natur aus neugierig.
Da haben Sie mit mir Pech. Ich bin gar nicht neugierig, schon gar nicht auf das hier alles!
Was meinen Sie damit? Das hier alles?
Na ja, diese Hütte, die nur Arbeit machen wird, das merke ich jetzt schon. Und diese Gegend, die mich nicht interessiert, auch wenn es hier schön ist, aber es langweilt mich. Ich kann mit der herausgeputzten Bilderbuchlandschaft nichts anfangen.
Sie kennen diese Gegend ja gar nicht, Sie waren ja noch nie hier.
Ich kenne die spärlichen Erzählungen meiner Großmutter, das reicht mir. John erinnert sich an die Wehmut seiner Großmutter, die jedoch vor allem von ihrem Stolz überlagert war, es auf dem neuen Kontinent geschafft zu haben.
Welche Erzählungen?
Gegenfrage: Sind Sie von hier? Bei Ihnen tu ich mir schwer sie zuzuordnen.
Ich bin von hier, aber nur zur Hälfte, zur anderen Hälfte nicht.
Oh Gott, wie meinen Sie denn das?
Wissen Sie was, ich lad Sie zu einem Kaffee in mein Salettl ein.
Ihr Salettl?
Das ist ein bisschen wie eine verbaute Terrasse, halt geschützter, wegen des kälteren und feuchteren Klimas. So kann man auch in den Bergen draußen sitzen. Das entspannt Sie vielleicht.
Eigentlich sollten der Mitarbeiter der Agentur und der Handwerker noch einmal kommen. Ich warte schon eine Stunde auf diese Leute.
Warten Sie einen Moment!
Sie schreibt einen Zettel und heftet ihn an sein Gartentor:
„Ich bin gegenüber bei Frau Gruber.“
Gruber?
Ich bin die Frau Gruber. Außerdem können Sie von meinem Platz aus hinüberschauen. Sie haben alles im Blick, falls jemand kommt.
Das ist ja beruhigend, machen das alle?
Er betritt ihren Garten. Im Salettl setzt er sich in einen der Korbstühle und versucht, sich zu entspannen, so wie sie es ihm vorgeschlagen hatte.
Na gut, erzählen Sie schon, schlägt John ihr vor. Was ist das für eine Gegend?
Was hat Ihnen denn Ihre Großmutter erzählt?
Ach wissen Sie, das lassen wir jetzt. Erzählen Sie doch etwas über die Gegend. Ich weiß ja gar nichts darüber.
Diese Gegend? Wie Sie sehen, handelt es sich um eine Dreifaltigkeit aus Bergen, Wäldern und Seen.
Werden Sie mir nicht religiös, Sie sehen gar nicht so aus.
Wenn ich diesen See sehe, mit der Felswand dahinter und allem rundherum, dann werde ich schon ein bisschen spirituell. Da glaube ich an die Natur, an die Geister der Natur und an die Menschen, die sich in der Natur bewegen wie kleine Ameisen. Aber ich denke, Sie meinen nicht die Landschaft, wenn Sie von der Gegend sprechen, sondern mehr die Leute, oder?
Meine Großmutter ist wohl nicht weggezogen, weil die Lansdschaft so schön war, sonst wär sie wohl geblieben.
Da kommen Sie zu einem wichtigen Punkt. Viele Leute aus den Städten sind hierher gezogen, weil sie es hier besonders schön fanden. Es hat sich entwickelt. Aus Gründen der Erholung und der Gesundheit. Aus Liebe zu den Bergen, die man in dieser Gegend leichter erreichen konnte, nämlich mit dem Zug. Aber auch deshalb, weil andere auch schon da waren, oft wichtige und einflussreiche Leute, deren Nähe man gesucht hat. Da wollte man eben auch dabei sein, im Sommer. Das war so Mode, damals.
Damals?
Ja, damals im alten Kaiserreich.
John muss lachen.
Das ist aber schon lange her.
Na ja, aber es ist immer noch präsent. Sie werden sehen. Wer es sich leisten konnte, damals, Adelige und reiche Bürger konnten das, die hielten sich in diesen Kurgebieten in den Sommerferien auf. Sie waren entspannt, sie hatten Zeit, sie konnten reden und flanieren, manche waren kreativ. Menschen komponierten, schrieben und verkehrten über Briefwechsel. Über Briefe, die man sich zwischen den verschiedenen Kurorten quer durch Europa gegenseitig zusandte, so wie man es heute per Mobiltelefone tut, nur langsamer und intensiver. Die Bürger zogen in Bauernhäuser, die sie mieteten, manchmal auch kauften. Oder sie errichteten Villen. Manche dieser Gebäude liegen versteckt, oft zugewachsen von verwunschenen Gärten. Oder sie zogen in diese schnuckeligen Häuschen mit Salettl, wie dieses hier.
Und die Leute von hier?
Die Leute von hier? Sie meinen richtige Einheimische, die immer schon hier waren? Aber das weiß man nicht so genau. Die Leute lebten – früher, damals – irgendwie vom Salz und von allem rundherum. Heute spielt das nur noch eine geringe Rolle. Aber im Mittelalter, als das im großen Stil begonnen hatte, da war Salz das Salz des Lebens.
Salz des Lebens?
Dann erzählt ihm die Nachbarin ein bisschen vom Salz des Lebens. Dass es ohne dieses Salz keine haltbaren Lebensmittel geben konnte. Dass die Herren des Landes das Bergrecht und das Salzmonopol besaßen. Dass das Salz im Mittelalter und noch Jahrhunderte später eine Quelle des Reichtums war. Dass es nicht nur um das Salz alleine ging, sondern dass irgendwie alle rundherum davon lebten. Nicht nur die Bergleute, die Stollen schlugen, Wasser einleiteten und die Sole herauspumpten. Nicht nur die Leute im Salzsud und die Pfannmeister, die daraus Salz produzierten. Nicht nur die Leute, die das Brennholz schlägerten, die Holzwirtschaft organisierten und das Holz aufbereiteten. Auch die Fuhrleute, die Salz in alle Gebiete transportierten, in die Städte mit Niederlagsrechten, oder schwarz über die Almen, und als Gegenware alles Mögliche zurückbrachten. Oder Gewerbe, die notwendig waren, damit das Salinensystem überhaupt funktionierte: Zimmerer, Tischler, Sägewerker, Sattler, Wagner, Wegmacher, Schmiede, Wirtsleute oder Herbergsbetreiber. Nicht zu vergessen die Bauern, die ihre Überschüsse zur Versorgung der Salinen bereitzustellen hatten. Die meisten Salinenarbeiter waren ebenfalls kleine Bauern. Sie hatten jeweils ihre Tiere, ihre Gärten zur Selbstversorgung, ihre Alm- und Holzrechte. Sie waren nicht reich. Aber sie waren auch nicht arm. Es handelte sich um eine beständige Welt, mit mehr Kontinuität und weniger Unsicherheit als anderswo. Die Leute wurden ja gebraucht. Ja, die Saline brauchte sie.
Ich hoffe, ich red Ihnen nicht zu viel, bitte bremsen Sie mich.
Woher wissen Sie das alles?
Ich stamme väterlicherseits aus einer sehr alten Familie in der Gegend, die Vorfahren waren Kaufleute und gehörten zu den Hallingern, so zumindest der Familienmythos. Man tut halt so und legt viel Wert auf diese Wurzeln. Aber ich glaube, dass es sich mehr um eine Einbildung handelt als um ein nachweisbares Faktum. Diese Hallinger hatten mit Salzaufbereitung und dem Salzhandel zu tun. Sie waren reich, auch einflussreich. Irgendwann hab ich mich mit dieser Geschichte befasst.
Wieso wird um diese Gegend so ein Hype gemacht? Ich begreife das nicht.
Ja, ein Tamtam. Die Landschaft hat sich zur Mode, zur Marke entwickelt. Es trieft vor lauter Klischees. Es hat mit der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Identität, nach dem Besonderen und Originellen zu tun. Und gerade hier wird das in besonderem Maße zelebriert. Sie wissen doch, wir sind alle so zerrissen, in jeder Hinsicht. Aber es gibt natürlich mehrere derartige Gegenden, die an ihren eigenen Klischees ersticken, besser, vielleicht wegen der Seen, darin ersaufen.
Allerdings gibt es hier tatsächlich viel Eigensinniges, viele Spinner und Eigenbrötler, einen verbreiteten Widerstand gegen die unhinterfragte Übernahme alles Neuen, einen beinahe unschuldigen Konservativismus, einen Stolz auf das besondere Eigene, auch wenn es manchmal lächerlich wirkt.
Diese Gegend ist für mich eine gemeinsame Erfindung aus Einheimischen und Zugewanderten, die sie zu Tode lieben. Eine merkwürdige Mischung aus bürgerlicher Urbanität und wüster Ländlichkeit, aus spielerischer Landromantik und grauenhaftem Traditionalismus.
Oh, oh, oh.
Lachen Sie nicht. Ich bin ja selber so eine Mischung. Oder egal: Lachen Sie doch einfach!