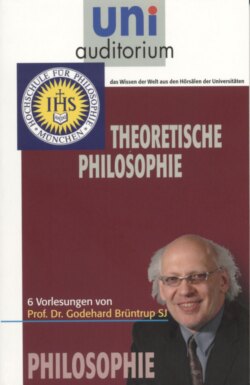Читать книгу Theoretische Philosophie - Godehard Brüntrup - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.6 Kant
ОглавлениеSchauen wir kurz auf Kant. Kant macht zwei Unterscheidungen. Die erste haben wir bereits kennen gelernt: „a priori“ und „a posteriori“. Was wir a priori erkennen, erkennen wir ohne Zuhilfenahme der sinnlichen Anschauung. Etwa wenn wir Algebra betreiben oder bestimmte mathematische Dinge, die wir uns nicht direkt sinnlich vorstellen können. Was wir a posteriori erkennen, ist das, was wir aus der sinnlichen Erfahrung bekommen. Etwa wie viele Seiten dieses Taschenbuch zählt.
Das ist die eine Unterscheidung. A priori, a posteriori. Dann macht Kant eine andere Unterscheidung: „analytisch“ und „synthetisch“. Ein Satz ist analytisch, wenn das Prädikat im Subjekt enthalten ist. Also zum Beispiel: Junggesellen sind unverheiratete junge Männer. Ein Satz ist synthetisch, wenn das Prädikat im Subjekt nicht enthalten ist. Wenn uns also das Prädikat etwas Neues sagt, was aus dem Begriff des Subjektes noch nicht hervorgeht. Wenn ich Ihnen zum Beispiel sage: „Das Haus in der Kaulbachstraße 31 ist gelb“, so geht aus dem Begriff des Hauses nicht der Begriff der Gelbheit hervor. Da erfahren Sie wirklich etwas Neues, was im Begriff des Hauses nicht enthalten ist. Oder „des Hauses in der Kaulbachstraße 31“. Selbst in diesem weiteren Begriff ist die Idee der Gelbheit nicht enthalten.
Nun sagt Kant, dass metaphysische Wahrheiten notwendige Wahrheiten sein müssen und von daher nicht aus der Erfahrung stammen können, sondern rein a priori aus der reinen Begriffsanalyse kommen müssen. Sie sollen uns aber neue Informationen liefern, die wir bisher nicht hatten, sollen also synthetisch sein. Und nun sagt Kant, dass solche Synthesis a priori, Neues hinzulernen ohne Hinzunahme der Sinneserkenntnis, für uns Menschen nicht möglich ist.
Für Kant stammt das Material der Erkenntnis aus der sinnlichen Anschauung in Raum und Zeit. Es gibt keine intellektuelle Anschauung. Die Konsequenz ist, dass es keine Synthesis a priori gibt. Keine synthetischen apriorischen Aussagen mit der Ausnahme von ganz wenigen, die er als solche anerkennt, wie zum Beispiel: der Raum ist unendlich.
Jetzt kann man dazu einige kritische Fragen stellen. In der Philosophie des 20. Jahrhunderts wurde die ganze Unterscheidung analytisch / synthetisch hinterfragt. Wann kann man wirklich sagen, ein Satz ist analytisch, ohne damit zu behaupten, dass man eigentlich nur rein psychologisch eine Denkgewohnheit oder etwas, was uns im Rahmen dessen, was wir empirisch gewohnt sind, als unausweichlich erscheint. Ist tatsächlich der Satz, Junggesellen sind junge unverheiratete Männer, analytisch? Ist der Satz, Raben sind schwarz, analytisch? Oder könnte es auch weiße Raben geben?
Die Diskussion in der Philosophie des 20. Jahrhunderts hat ergeben, dass die Grenze zwischen analytisch und synthetisch, die ja so wichtig ist für die Kantische Grenzziehung, mit der er die Metaphysik abgrenzen will in dem Bereich des Unerlaubten, so nicht durchzuhalten und zu ziehen ist. Auch Kants Idee, dass man notwendige Wahrheiten nur a priori erkennen kann, wurde im 20. Jahrhundert angegriffen. Zum Beispiel wurde argumentiert, dass empirisch gefundene Identitätssätze, wie „Wasser ist identisch mit H2O“, notwendige Wahrheiten ausdrücken. Da hätten wir eine notwendige Wahrheit, weil eine solche Identitätsaussage immer eine notwendige Wahrheit entdeckt, aber empirisch durch Erfahrung und nicht durch Begriffsanalyse.
Und schließlich, wenn wir in der Mathematik durch analytische Sätze Erkenntnis gewinnen können - und Kant wollte ja die Mathematik nicht ablehnen - wenn wir also in der Mathematik durch Erkenntnis, die a priori ist und oft analytisch, wirklich interessante Erkenntnisse gewinnen können, warum kann dasselbe nicht für die Metaphysik gelten? Warum muss die Metaphysik in jedem Falle synthetisch sein?
Warum kann sie nicht analog vieler mathematischer Wahrheiten interessante analytische Begriffsanalysen enthalten?
Das sind einige kritische Anfragen an Kant, die darauf hinauslaufen, dass die Grenze zwischen der Metaphysik einerseits und den Naturwissenschaften andererseits so nicht notwendigerweise gezogen werden kann.
Ich will Ihnen das noch einmal konkret an einem Beispiel verdeutlichen. Schauen Sie auf die moderne theoretische Physik. Das, was Kant für eine synthetisch apriorische Aussage, eine der wenigen hielt, nämlich dass der Raum unendlich ist, hält die moderne Physik nicht mehr für wahr. Das war aber für Kant eine notwendige Wahrheit.
Heute spricht die Physik von Singularitäten, also punktförmigen Zuständen, in denen die Gravitation unendlich ist, z.B. das Zentrum eines schwarzen Loches, als ein mathematisches Konstrukt jenseits jeglicher sinnlichen Vorstellbarkeit. Nach Kant wäre so etwas, was wir uns in keiner Weise mehr in Raum und Zeit vorstellen können, gar nicht im Rahmen und in den Grenzen der Vernunft denkbar. Und damit auch nicht der Urknall, und damit letztlich auch nicht, wie ich Ihnen vorgestellt habe, die Quantentheorie, die weit über das begrifflich Anschauliche hinausgeht, geschweige denn so etwas wie die vieldimensionale Stringtheorie in der Physik.
Alle diese florierenden Wissenschaftszweige würden, wenn man die Kantische Kritik und die Kantischen Grenzziehungen ernst nehmen würde, all diese florierenden Wissenschaftszweige würden unter das Verdikt der Metaphysik fallen und außerhalb der Grenzen der menschlichen Vernunft liegen. Offensichtlich ist man hier mit der Kritik über das Ziel hinausgeschossen, so dass der Wissenschaftsbetrieb, wie es sich entwickelt hat, sowohl in der Philosophie als auch in den Naturwissenschaften, sich um diese Kantischen Grenzziehungen nicht gekümmert hat.