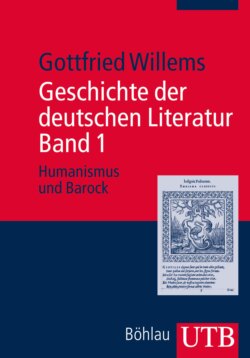Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 1 - Gottfried Willems - Страница 7
Vorwort
ОглавлениеEin Leitfaden, kein Handbuch
Wer heute Literaturwissenschaft studiert, dem kann es passieren, daß er sein Fach nurmehr als einen Flickenteppich von Spezialgebieten erlebt. Die intensive Spezialisierung und methodische Diversifikation der Forschung hat dazu geführt, daß er der Literaturgeschichte sowohl in der Lehre als auch in der Fachliteratur nur noch in mehr oder weniger eng bemessenen Ausschnitten begegnet. Es bleibt dem Zufall überlassen, auf welche Weise daraus im Laufe des Studiums ein Gesamtbild der geschichtlichen Entwicklung zusammenwächst, ja ob es überhaupt dazu kommt. Hierin liegt ein Problem, das die Wissenschaft nicht sich selbst überlassen darf. Denn wer ein Fach wie Literaturwissenschaft studiert, der geht im allgemeinen auf Zusammenhang aus; der will sich einen weiteren Horizont erwerben, in dem er die Literatur und all das, wovon sie handelt und was sie und ihre Leser bewegt, verarbeiten kann – wie ja überhaupt der Beitrag der Geistes- und Kulturwissenschaften weniger im Verfügbarmachen eines praxisrelevanten Spezialwissens als vielmehr in der Erarbeitung von weiteren Horizonten des individuellen und gesellschaftlichen Handelns besteht, im Skizzieren von Landkarten, die es den Menschen erlauben, sich mit mehr Übersicht in der kulturellen Landschaft und der geschichtlich-gesellschaftlichen Welt zu bewegen.
Hier soll nun versucht werden, dem Studierenden in einer Reihe von fünf Einführungen – Band 1: 16. und 17. Jahrhundert (Humanismus und Barock), Band 2: 18. Jahrhundert (Aufklärung), Band 3: Vom 18. zum 19. Jahrhundert (Goethezeit, Klassik und Romantik), Band 4: 19. Jahrhundert (Vormärz und Realismus), Band 5: Vom 19. zum 20. Jahrhundert (Moderne) – einen Leitfaden an die Hand zu geben, der es ihm ermöglicht, die Geschichte der Neueren Deutschen Literatur im Zusammenhang kennenzulernen und sich ein Gesamtbild der Entwicklung zu erarbeiten. Ziel ist es, ihm all das an Kenntnissen und Fähigkeiten nahezubringen, dessen er als ein heutiger Leser bedarf, um bei einem unbekannten literarischen Text sogleich einige
[<< 9] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe
Anknüpfungspunkte zu finden, von denen aus er ihn sich erschließen kann. Die Bände sind so gestaltet, daß jeder einzelne auch für sich verständlich ist und als Einführung in die Literatur einer Großepoche dienen kann. Dabei haben sich thematische Überschneidungen nicht ganz vermeiden lassen. Es wird sich bei den Repliken aber hoffentlich um Themen handeln, die eine Wiederholung vertragen, sei es weil sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder weil sie über der Behandlung in je anderen historischen Kontexten an Profil gewinnen.
Die Arbeit an einem solchen Leitfaden begriff die Literaturwissenschaft lange Zeit als ihre vornehmste Aufgabe. Sie suchte ihr vor allem mit Literaturgeschichten zu entsprechen, in denen sie ihr Wissen zusammentrug. Gerade das Geschäft des Schreibens von Literaturgeschichten ist in den letzten Jahrzehnten aber ins Stocken geraten, aus nur allzu verständlichen Gründen. Die klassische Literaturgeschichte hatte den Anspruch der Vollständigkeit; es sollten in ihr alle wichtigen Epochen, literarischen Bewegungen, Autoren und Werke zur Geltung kommen. Dieser Anspruch läßt sich jedoch in Zeiten der Spezialisierung und methodischen Diversifikation kaum noch in einem überschaubaren Rahmen einlösen, jedenfalls nicht auf dem inzwischen erreichten wissenschaftlichen Niveau.
So ist man denn weithin dazu übergegangen, die Literaturgeschichte in kleine und kleinste thematische Einheiten zu zerlegen, deren Darstellung auf Spezialisten zu verteilen und die so entstehenden Beiträge in vielbändigen Sammelwerken zusammenzutragen. Dabei mußte aber gerade das, was der Leser in einer Literaturgeschichte zunächst und vor allem sucht, der rote Faden, die kontinuierliche Erschließung eines weitgespannten Entwicklungszusammenhangs, auf der Strecke bleiben. Ja die Gattung Literaturgeschichte nahm darüber einen ganz anderen Charakter an; an die Stelle eines Buchs für die zusammenhängende Lektüre trat das Nachschlagewerk, das nur noch punktuell, im Blick auf diese oder jene besondere Fragestellung konsultiert wird. An solchen Nachschlagewerken ist freilich kein Mangel; gerade in den letzten Jahrzehnten sind eine ganze Reihe von Lexika und Handbüchern entstanden, die für jede erdenkliche Nachfrage Auskunft bereithalten. Was fehlt und von den Studierenden zunehmend vermißt wird, sind Arbeiten, die sich explizit und in einem überschaubaren Rahmen am Anspinnen eines roten Fadens versuchen.
[<< 10]
Hierbei ist freilich eine Gefahr zu bannen, der ein solcher Versuch nur allzu leicht erliegen kann: das Bestreben, den Umfang überschaubar zu halten, darf nicht dazu führen, daß literaturgeschichtliche Entwicklungen, Autoren und Werke jeweils nur mit einigen wenigen allgemeinen Wendungen charakterisiert werden, die so weit über den Texten schweben, daß sie sich kaum für eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen aktivieren lassen, zumal sich dabei leicht eine Tendenz zu Allgemeinplätzen durchsetzen kann, die, wo sie nicht überhaupt von nichtssagender Allgemeinheit bleiben, vielfach fragwürdig gewordene Bestände der älteren Literaturgeschichtsschreibung transportieren. Denn daß sich die Forschung in so hohem Maße spezialisiert und dabei immer wieder die großen literaturgeschichtlichen Zusammenhänge beiseite gesetzt hat, läßt den, der denn doch einmal auf sie zu sprechen kommt, nur allzu leicht auf Konstrukte der älteren Literaturgeschichtsschreibung zurückgreifen, die zu gängiger Münze geworden sind, die im Licht der neueren Forschung jedoch kaum mehr standhalten. Das letzte, was man einem Studierenden antun dürfte, der nach einer Einführung in den Entwicklungszusammenhang der deutschen Literatur fragt, wäre aber wohl, ihn in ein Beinhaus ausrangierter Allgemeinplätze zu führen.
So soll hier ein anderer Weg gewählt werden, der von einem Sich-entlang-Hangeln an Allgemeinplätzen ebensoweit entfernt wäre wie von dem Sich-Verlieren in Spezialgebieten. Die Voraussetzung dafür ist der Verzicht auf Vollständigkeit, was Namen, Werke, Gattungen und literarische Bewegungen anbelangt, die Konzentration auf einige wenige thematische Schwerpunkte und auf eine überschaubare Zahl von Autoren und Werken, und zwar vor allem auf solche, von denen aus sich die Schwerpunktthemen auf exemplarische Weise entwickeln lassen. Ihnen soll hier der Platz eingeräumt werden, dessen es bedarf, um sie auf dem heute geforderten Niveau zu behandeln und der Komplexität der Probleme und der literarisch-ästhetischen Strukturen nicht mehr als nötig schuldig zu bleiben.
Dabei soll besonders auf ein enges Ineinandergreifen von Problementwicklung und Textanalyse geachtet werden; was an Problemen von allgemeiner Bedeutung verhandelt wird, soll sich nach Möglichkeit von Textbefunden her ergeben, wie umgekehrt das, was an Thesen dargestellt wird, von den Texten her plausibel werden soll. Denn
[<< 11]
nur so wird der Leser wirklich eingeführt werden; nur so kann er ein tieferes Verständnis für die Texte entwickeln und die Wissensbestände, die vor ihm ausgebreitet werden, so aufnehmen, daß er sie selbständig zum Einsatz bringen kann. Die literarischen Texte und die sprachliche Wirklichkeit einer Epoche sollen so oft und so einläßlich wie möglich selbst zu Wort kommen, damit sich der Leser mit ihnen vertraut machen und ein Gespür für sie entwickeln kann. Ohnehin wird die Beschäftigung mit der Literaturgeschichte nur durch die unmittelbare Begegnung mit der Literatur selbst interessant und aufschlußreich. So soll denn diese Reihe von Einführungen weniger den Charakter eines Handbuchs oder eines Notaggregats zum Anpauken von Basiswissen als den eines Lesebuchs haben, das zum Einlesen in die Literaturgeschichte einlädt und dabei nach und nach einen weiteren Horizont des Verstehens und ein Gefühl für die Texte entstehen läßt.
Der rote Faden:der Weg der Literatur in die Moderne
Bei solchem Vorgehen ist natürlich alles daran gelegen, nach welchen Gesichtspunkten die thematischen Schwerpunkte gesetzt und die Beispiele ausgewählt werden. Es müssen Gesichtspunkte sein, von denen aus sich die literaturgeschichtlichen Entwicklungen sowohl in der Tiefe als auch in der Breite erschließen lassen. Welche Frage könnte hier aber weiter tragen als die, von der her sich die Beschäftigung mit der Geschichte überhaupt begründet, als die Frage, wie geworden ist, was heute ist; unter welchen Umständen, auf welche Weise, aus welchen Gründen und aus welchen Motiven heraus sich das herangebildet hat, was wir heute an gesellschaftlichen Verhältnissen, an kulturellem Leben und an Literatur vor uns haben. Denn der Blick in die Geschichte ist immer ein Blick von heute aus, und überdies einer, der auch wieder im Heute ankommen will, wie sehr die Vertiefung in die Vergangenheit, das antiquarische Interesse zwischenzeitlich auch zum Selbstzweck werden mag. Wie dieser Blick von den Verhältnissen der Gegenwart seinen Ausgang nimmt, durch sie motiviert und konditioniert ist, so zielt er letztlich auf ein besseres, umfassenderes und schärferes Bild von ihnen. Für die Geschichtsschreibung ist die Gegenwart nun einmal das telos der Geschichte – eine methodische Einsicht, die keineswegs mit dem Bekenntnis zu einem teleologischen Geschichtsbild verwechselt werden darf, die unbeschadet dessen gilt, wie man über Fragen der Teleologie denkt.
[<< 12]
So soll denn die Geschichte der Neueren Deutschen Literatur hier aufgerollt werden, indem dem Weg der Literatur in die Moderne nachgegangen wird. Und zwar soll dies so geschehen, daß überall gezielt nach den Triebkräften, Formen und Problemen der Modernisierung gefragt wird, wie sie die moderne Sozial- und Kulturgeschichte herausgearbeitet hat. Nur ein solches bewußtes Fragen, das sich nicht einfach der Vorstellung überläßt, alles, was sich in der Neuzeit an Entwicklungen zeige, werde schon irgendwie unterwegs zur Moderne sein, kann dazu führen, daß am Ende wirklich so etwas wie ein roter Faden kenntlich wird.
Triebkräfte und Formen der Modernisierung – damit sind hier vor allem die folgenden sozial- und kulturgeschichtlichen Phänomene gemeint: 1. die Verwissenschaftlichung von Welt- und Menschenbild durch die moderne Wissenschaft und die Umgestaltung der Lebensformen in ihrem Sinne, bis hin zu den verschiedenen technisch-industriellen Revolutionen, 2. die Säkularisation als fortschreitende Lösung von den Dogmen, Normen und Ritualen der Religion, 3. die Entwicklung neuer Formen von physischer, kommunikativer, weltanschaulicher und sozialer Mobilität, 4. die Individualisierung, die zunehmende Fokussierung auf das Individuum, und 5. die Entwicklung der pluralistischen Gesellschaft als einer Gesellschaft, die einem Pluralismus von Weltanschauungen und Lebensformen Raum gibt. Daß alle diese Entwicklungen von fundamentaler Bedeutung für die Literatur sind, so sehr, daß sich ohne ihre Würdigung deren Geschichte nicht schreiben läßt, liegt auf der Hand. Die Literatur ist sowohl aktiv an ihnen beteiligt, hat sowohl nach Kräften geholfen, sie mit voranzutreiben, als sie durch diese auch selbst eine Umgestaltung erfahren hat, die geradezu ihren Charakter als Literatur verändert hat. Insofern läßt sich ihre Geschichte wohl nur von jenen Entwicklungen aus begreifen.
Der Weg in die Moderne ist aber nicht nur der Weg eines einsinnig vor sich hin prozessierenden Fortschritts gewesen; er ist nicht minder durch Probleme gekennzeichnet, die allererst solcher Fortschritt in die Welt gebracht hat, und auch die Probleme der Modernisierung haben in der Geschichte der Literatur tiefe Spuren hinterlassen. Die Verwissenschaftlichung der Welt und die dadurch mögliche Mobilisierung aller natürlichen und kulturellen Ressourcen ließ mancherorts einen totalitären Machbarkeitswahn, einen Totalitarismus entstehen. In
[<< 13]
Verbindung mit der Säkularisation führte der Siegeszug der Wissenschaft in eine weltanschauliche Unruhe hinein, die vielfach als problematisch erlebt wurde, insofern sie die verschiedensten Formen von Materialismus, Skeptizismus und Nihilismus aus sich entließ. Die neuen Formen der Mobilität wurden von den Menschen immer wieder als eine Art „Entwurzelung“, als Herausgerissenwerden aus einem Gefüge von Lebensformen erfahren, das Sicherheit und Orientierung verbürgte. Der Pluralismus stellte sich als „Verlust der Einheit“ oder „Verlust der Mitte“ dar, und in Verbindung mit der Individualisierung als „Atomisierung“ der Gesellschaft. Und die immer stärkere Fokussierung auf das Individuum führte mancherorts zu einer Art Selbstaufhebung der Individualisierung in einer radikalen Problematisierung des Ichs, die allerlei plurale Ich-Konzeptionen auf den Weg brachte.
Schließlich gehören zum Weg der Literatur in die Moderne auch die vielen Ersatzreligionen hinzu, die im Zuge der Modernisierung entstanden sind, jene quasi-religiösen Weltanschauungen, die es den Menschen erlauben sollten, sich auf dem Boden einer säkularisierten Kultur mit der Modernisierung und ihren problematischen Seiten ins Benehmen zu setzen. Hier ist zunächst der Glaube an den Fortschritt selbst zu nennen, wie er sich in den Formen des Glaubens an die Geschichte (Historizismus) und des Glaubens an die Wissenschaft (Szientismus) realisiert hat, sodann der Glaube an die Natur (Pantheismus), die „Kunstreligion“ (Ästhetizismus) und die „Humanitätsreligion“, schließlich die „Nationalreligion“ und die anderen politischen Ersatzreligionen als Sonderformen des Historizismus sowie der Glaube an das Leben (Vitalismus) als eine Weiterentwicklung des Pantheismus, bei der das säkularisatorische Moment stärker zur Geltung kommt. Diese Ersatzreligionen gehören neben der Entwicklung der modernen Wissenschaften zu den wichtigsten ideengeschichtlichen Voraussetzungen der literarischen Entwicklung, sei es daß die Literatur unbewußt von ihnen beeinflußt worden ist, sich bewußt in ihren Dienst gestellt oder kritisch an ihnen abgearbeitet hat.
Damit sind bereits die wichtigsten der thematischen Schwerpunkte benannt, die das Rückgrat dieses Leitfadens durch die Geschichte der neueren deutschen Literatur bilden sollen. Was dabei an Autoren und Werken zur Sprache kommt, soll vor allem so ausgewählt werden, daß sich diese Schwerpunktthemen an ihnen exemplarisch entwickeln und
[<< 14]
diskutieren lassen. Allerdings soll bei ihrer Auswahl auch auf ihren Stellenwert im Kanon der Überlieferung geachtet werden; denn von einer Einführung wird zunächst und vor allem erwartet, und zu Recht erwartet, daß man sich in ihr mit dem Kanon vertraut machen kann.
Leitfragen
So soll denn in jedem der fünf Bände die Darstellung der jeweiligen Großepoche von den folgenden Leitfragen aus aufgerollt werden: 1. Welches Bild haben wir heute von ihr? Was von ihr und ihrer Literatur hat sich im kulturellen Gedächtnis erhalten, und auf welche Weise, unter welchen Vorzeichen? 2. Was sind seinerzeit die prägenden kulturgeschichtlichen Entwicklungen gewesen, und was die entscheidenden ideengeschichtlichen Bewegungen, wie sie sich in der Literatur wiederfinden? Und 3. wie haben sich von diesen Voraussetzungen her der soziokulturelle Stellenwert und die Auffassungen von Literatur, das literarische Leben und die Literatur selbst verändert? Wenn dabei dem kultur- und ideengeschichtlichen Wandel und dem literarischen Leben verhältnismäßig viel Platz eingeräumt wird, so wird damit auch der Entwicklung Rechnung getragen, die die literaturwissenschaftliche Forschung in den letzten Jahrzehnten genommen hat, dem, was man ihre kulturwissenschaftliche Wende genannt hat. Und auch hier soll versucht werden, die zeitgenössischen Quellen so oft wie möglich selbst sprechen zu lassen; der Leser soll nicht nur sozialgeschichtliche Großthesen von heute zu hören bekommen, sondern mit der Vorstellungswelt und den Realitäten der Epoche selbst Fühlung aufnehmen können.
Revision der Literaturgeschichte
Schließlich zielt dieser Versuch einer Rekonstruktion der Literaturgeschichte am Leitfaden der Geschichte der Modernisierung nicht nur darauf, den Studierenden eine erste Orientierung an die Hand zu geben, die dem heutigen Stand der Wissenschaft genügt. Es verbindet sich mit ihr auch die Hoffnung, der Wissenschaft selbst Impulse geben und Beiträge zu einer Revision der literaturgeschichtlichen Bestände leisten zu können. Wenn so weite literaturgeschichtliche Zusammenhänge ins Auge gefaßt werden wie hier, dann kann es nicht ausbleiben, daß einige der Probleme neuerlich in den Blick treten, die nur allzu gerne an den Grenzen zwischen den etablierten Spezialgebieten, insbesondere in den Übergangszonen zwischen den Epochen liegengelassen werden, und gerade ihnen soll besondere Aufmerksamkeit zuteil werden.
[<< 15]
Spezialisierung und methodische Diversifikation bedeuten ja nicht nur einen Gewinn, sondern immer auch einen Verlust. Sie schaffen die Möglichkeit, sich bestimmten Gegenständen intensiver zuzuwenden, indem sie ausblenden, was an ihnen eigentlich nur in weiteren literarhistorischen Kontexten kenntlich werden kann. So kommt es, daß dort, wo innerhalb eines Spezialgebiets zur Profilierung des jeweiligen Gegenstands dann doch einmal auf Gegenstände anderer Spezialgebiete Bezug genommen, etwa des literarhistorischen Vorher und Nachher gedacht wird, immer wieder auf Vorstellungen zurückgegriffen wird, die in diesen anderen Spezialgebieten schon längst in Frage gestellt worden sind – die bereits erwähnten Allgemeinplätze, in denen ältere Stufen der Literaturgeschichtsschreibung konserviert sind. Und das mindert natürlich den Ertrag der Spezialforschung empfindlich, ja stellt ihn gelegentlich überhaupt in Frage.
So ist zum Beispiel dort, wo von der Literatur des Sturm und Drang, der Klassik oder der Romantik gehandelt wird, vielfach nach wie vor an zentraler Stelle von der „Überwindung der Aufklärung“ die Rede, so wie es sich in der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts – aus mehr als problematischen Gründen – eingebürgert hat; dabei wird Aufklärung mit Rationalismus oder Logozentrismus gleichgesetzt. Ob es um den Sturm und Drang, die Klassik oder die Romantik geht – immerzu soll der angebliche Rationalismus der Aufklärung überwunden werden. Dabei hat die internationale Aufklärungsforschung schon vor Jahrzehnten – in Deutschland spätestens seit Cassirer, oder jedenfalls doch seit Kondylis – klargestellt, daß die Literatur der Aufklärung des 18. Jahrhunderts dem Rationalismus, wie er aus der frühen Neuzeit auf sie gekommen ist, prinzipiell kritisch gegenübersteht und statt dessen an einer „Rehabilitation der Sinnlichkeit“ arbeitet, auf Sensualismus und Sentimentalismus setzt.
Wo der nicht auf die Aufklärung spezialisierte Sturm-und-Drang-, Klassik- oder Romantikforscher auf die Literatur der Aufklärung blickt, fällt ihm dann natürlich nur in die Augen, was sich da allenfalls noch an Restbeständen eines älteren Rationalismus findet. Freilich, wie soll er diese Bestände als Restbestände erkennen können, wenn er den Rationalismus der frühen Neuzeit, insbesondere den Neustoizismus des Humanismus nicht kennt, jenen Neustoizismus, der die Literatur bis hin zum Barock prägt und für die Aufklärung dann zu der Folie
[<< 16]
wird, vor der sie sich mit Neuem, Andersartigem profiliert. Und wie soll er, wo er den vernunftkritischen Grundimpuls der Aufklärung und seine Entfaltung in Sensualismus und Sentimentalismus nicht erfaßt hat, erkennen können, in welchem Maße noch die Literatur von Sturm und Drang und Klassik von ihm getragen ist. Ohne Kenntnis des Humanismus kein rechtes Verständnis des Barock, ohne Kenntnis des Barock kein rechtes Verständnis der Aufklärung, ohne Kenntnis der Aufklärung kein rechtes Verständnis des Sturm und Drang, der Klassik und Romantik – und so immer weiter bis zur Gegenwart.
Und nicht nur die Kenntnis des Vorher, auch die des Nachher ist für das Verständnis der Literatur einer Epoche unentbehrlich. Wer sich nicht von dem historischen Prozeß Rechenschaft gibt, in dem im 19. Jahrhundert die Literatur der Zeit um 1800 zum klassischen Höhepunkt der deutschen Nationalliteratur stilisiert worden ist, der wird immer durch die trübe Brille der Klassik-Doktrin mit ihren Begriffen von Nation, Politikflucht, Griechenseligkeit und klassischer Formkunst im Zeichen des Schönen auf diese Literatur blicken müssen. Erst in weiteren Zusammenhängen, wie sie hier in den Blick genommen werden, wird eine Auseinandersetzung möglich, die aus dem Bann der ebenso schiefen wie abgedroschenen Vorstellung heraustritt, die Literatur um 1800 habe die Aufklärung überwinden wollen, um eine nationale deutsche Klassik zu schaffen.
Dabei kann gerade der Zugriff über die Sozial- und Kulturgeschichte der Modernisierung gute Dienste tun, wird es von ihm aus doch möglich, wesentlich Züge der Literatur der „Goethezeit“ als moderne Züge zu fassen, nämlich zu zeigen, daß sie sich weniger an einem zeitlos-klassischen Ideal der Schönheit als vielmehr an dem abgearbeitet hat, was hier an Problemen der Modernisierung benannt worden ist – wohlgemerkt: an den Problemen der Modernisierung, nicht an denen der Aufklärung! – also an den problematischen Zügen der Verwissenschaftlichung der Welt, der Säkularisation, des Materialismus, Skeptizismus und Nihilismus, der neuen Mobilität, des neuen Pluralismus und Individualismus, auch und gerade dort, wo sie die aktuelle Politik flieht und nach Griechenland schaut. Überhaupt wird es von ihm aus möglich, der primitiven Opposition klassische Formkunst – politisches Engagement zu entkommen, wie sie seit jeher nicht nur den Blick auf die Klassik, sondern auch den auf
[<< 17]
den Vormärz und auf spätere Epochen verstellt hat. In diesem Sinne soll die vorliegende Reihe von Einführungen nicht nur der Rekonstruktion, sondern auch der Revision der Literaturgeschichte dienen, einer kritischen Überprüfung der Begriffe, mit denen die Wissenschaft Literatur kennzeichnet, wo sie diese historisch verortet und in einen Epochenzusammenhang rückt.
Hauptlinien der Entwicklung
So verbindet sich mit diesem Versuch, die Geschichte der neueren deutschen Literatur am Leitfaden der Geschichte der Modernisierung zu erkunden, die Hoffnung, einige weitgespannte Entwicklungslinien aufzeigen zu können, von denen aus sich auch die historisch fernsten Epochen den Fragen, Interessen und Verstehensmöglichkeiten der Gegenwart erschließen und sich die Literaturen der berührten Epochen, der früheren und der späteren, immer wieder wechselseitig kommentieren und erhellen.
Eine erste dieser Entwicklungslinien wird, wie angedeutet, die Geschichte der Verwissenschaftlichung der Welt sein, wie sie bis heute dank der Akademisierung des Wissens und der Bildung, dank Arbeitsteilung und moderner Technik alle Bereiche des individuellen und gesellschaftlichen Lebens erfaßt und durchdrungen hat. Schon der Humanismus geht auf eine solche Verwissenschaftlichung aus, aber auf der Basis eines anderen als des modernen Wissenschaftsbegriffs – den hat er selbst erst allmählich aus sich hervorgebracht – so daß „Kunst und Wissenschaft“ hier noch eine fraglose Einheit bilden können. Als die moderne Wissenschaft dann in der Zeit der Aufklärung Gestalt annimmt, zerbricht diese Einheit, und die Kunst sucht die Autonomie gegenüber der Wissenschaft. Seither ist das Verhältnis der Literatur zur Wissenschaft ein ambivalentes; bald sucht sie den Anschluß an sie wie noch in der frühen Aufklärung oder dann im Naturalismus und gelegentlich in der Neuen Sachlichkeit, bald geht sie zu ihr auf Distanz und setzt sich kritisch mit ihren Folgen auseinander wie im Symbolismus, und bald betreibt sie beides zugleich wie in bestimmten Phasen von Klassik, Romantik, Realismus und Moderne.
Als eine zweite Entwicklungslinie soll die Geschichte der Säkularisation und der mit ihr verbundenen zunehmenden weltanschaulichen Unruhe verfolgt werden. Wenn sich die Literatur bis zum Barock mit der größten Selbstverständlichkeit auf den Boden der christlichen Religion stellte, wobei freilich stets die Frage war, im Sinne welcher Konfession,
[<< 18]
so ist sie seit der Aufklärung auch hier auf Autonomie ausgegangen, um sich in verschiedenen Ersatzreligionen eine andere Grundlage zu schaffen. In Aufklärung und Klassik sind das vor allem der Pantheismus und die „Humanitätsreligion“, in der Romantik zunächst die „Kunstreligion“ und dann die „Nationalreligion“, im Vormärz darüber hinaus auch der Historizismus. Im Realismus hat es die Literatur dann mit allen diesen Ersatzreligionen gleichzeitig und in wechselnden Mischungen probiert, im Naturalismus vor allem mit dem Szientismus und im Symbolismus wieder mehr mit der „Kunstreligion“, dem Ästhetizismus. Erst in der Moderne des 20. Jahrhunderts haben sich verstärkt areligiöse, atheistische oder agnostische Positionen zu Wort gemeldet, wobei diese vielfach dem Vitalismus verpflichtet blieben.
Als eine dritte Entwicklungslinie soll die zunehmende Mobilität von Menschen und Meinungen, Informationen und Dingen ins Auge gefaßt werden; dabei soll insbesondere auf die Phänomene der sozialen Mobilität eingegangen werden. Wenn sich der Mensch in der frühen Neuzeit weithin noch an einen bestimmten Ort in der Ständegesellschaft, an eine bestimmte Region und Religion und an die von ihnen her gegebenen Traditionen und Konventionen gebunden sah, so lockerten sich seit dem 18. Jahrhundert alle diese Bindungen, um im 19. Jahrhundert, in der Zeit der industriellen Revolution, der Landflucht und der großen Auswanderungen auf eine Weise in Bewegung zu geraten, die zugleich jede erdenkliche Form von Karriere und von sozialem Absturz möglich werden ließ.
Die Literatur hat diesen Prozeß mit der größten Aufmerksamkeit verfolgt, nicht nur weil ihr von ihm aus immer wieder neuer Erzählstoff zuwuchs. Sie erblickte in ihm ebensowohl einen Prozeß der Befreiung, der der Individualisierung die nötigen Spielräume verschaffte, wie einen Prozeß der „Entwurzelung“, der die Menschen in äußere Unsicherheit und innere Haltlosigkeit stieß, so daß sie nun verstärkt nach den Wurzeln des Menschen fragte, etwa nach Geschichte, Nation und Heimat. Wenn sie hier im Namen der Selbstverwirklichung des Individuums an der weiteren Verflüssigung von Traditionen und Konventionen arbeitete, so vertiefte sie sich dort in die Problematik des „flexiblen Menschen“ (R. Sennett) und suchte in dem unausgesetzten Vorsichhinprozessieren der Modernisierung Räume der „Entwicklungsfremdheit“ (G. Benn) zu eröffnen.
[<< 19]
Eine vierte Entwicklungslinie, die hier verfolgt werden soll und die für die Literatur von besonders großer Bedeutung ist, ist die Geschichte der Individualisierung. Sie beginnt mit der Individualisierung des Gottesbezugs in den Kirchen der Reformation und insbesondere in den neuen Sekten, etwa im Pietismus, um in Zeiten der Aufklärung zum ureigensten Anliegen der Literatur zu werden. Wenn die Literatur zuvor in allen Belangen auf das Typische ausgegangen war, so vertiefte sie sich nun mehr und mehr in das Originelle, Singuläre und in die Selbstverhältnisse des Individuums. Dabei gewann die Dimension des Unbewußten immer größere Bedeutung für ihr Menschenbild, im 18. Jahrhundert zunächst vor allem in Gestalt der Kräfte des „Es“, der naturgegebenen Instinkte, im 19. Jahrhundert dann zunehmend auch in Form der Kräfte des „Man“, der verinnerlichten Normen einer Gesellschaft.
Die zunehmende Aufmerksamkeit auf das Unbewußte führte an der Schwelle zur Moderne des 20. Jahrhunderts in Verbindung mit dem Einfluß, den die moderne wissenschaftliche Psychologie in dem szientistisch gestimmten Raum des Naturalismus entfaltete, schließlich zu einer Krise der Ichbegriffe, zur Vorstellung vom „unrettbaren Ich“ (H. Bahr), mit unabsehbaren Folgen für die Literatur. Seither dominieren plurale Ich-Konzepte, die das Bewußtsein unter dem Einfluß des „Es“ und des „Man“ wissen, die Darstellung des Menschen. Das gilt jedenfalls für die Kunstliteratur; die Unterhaltungsliteratur arbeitet weiter mit der überkommenen Charakterpsychologie und wird wohl bis ans Ende aller Tage dabei bleiben.
Eine letzte, fünfte Entwicklungslinie, von der aus die Geschichte der neueren Literatur erschlossen werden soll, ist der Weg zur pluralistischen Gesellschaft. Er beginnt mit der Reformation, mit der Konfessionalisierung von Kultur und Gesellschaft. Vor dem Hintergrund der Idee der Einheit der Christenheit wird er zunächst freilich immer nur als ein Mißstand begriffen, als eben der Mißstand, als die stete Quelle von Konflikten, die er für die frühmoderne Gesellschaft in der Tat auch ist. Erst der Natur- und Toleranzdiskurs der Aufklärung eröffnet die Möglichkeit, in einem Pluralismus der Religionen, Weltanschauungen und Lebensstile eine Bereicherung des gesellschaftlich-kulturellen Lebens zu erblicken, wenn nicht gar die Grundform einer wahrhaft modernen Gesellschaft.
[<< 20]
Aus der Wendung der Romantik zum Nationalismus entspringt dann allerdings ein kultur- und zivilisationskritischer Diskurs, der im Laufe des 19. Jahrhunderts in Deutschland immer mehr die Oberhand gewinnt und für den solcher Pluralismus vor allem den „Verlust der Einheit“ oder „Verlust der Mitte“ bedeutet. Hier erscheint er als die innerste Quelle einer Entwicklung, über der sich die Gesellschaft von einer organischen Menschengemeinschaft in ein Gefüge von Institutionen, eine bürokratische Maschine verwandelt und das Individuum jeder Möglichkeit beraubt wird, sich innerlich zu ihr und zu den anderen Individuen ins Verhältnis zu setzen. Von diesem Nicht-fertig-Werden mit dem Pluralismus der modernen Gesellschaft bezieht die Literatur seit der Jahrhundertwende wesentlich die Energien, die sie mit der Überlieferung brechen, die überkommenen Formen sprengen und nach neuen, andersartigen Möglichkeiten der Darstellung Ausschau halten lassen; es begründet jenen „modernen Antimodernismus“, der die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts beherrscht. Ob die zweite Jahrhunderthälfte hier mit dem Schritt in eine Postmoderne einen Wandel hat bringen können, wird sich wohl erst in Zukunft klären.
Komparatistischer Zugriff
Daß am Leitfaden dieser Entwicklungslinien in die Geschichte der neueren deutschen Literatur eingeführt werden soll, hat zur Folge, daß hier nicht nur die deutschen Verhältnisse und deutsche Quellen in den Blick genommen werden können. Der Weg in die Moderne ist ja ein Weg, den die Deutschen und ihre Kultur mit anderen europäischen Nationen teilen, den sie mit ihnen gemeinsam und in ständigem Austausch mit ihnen gegangen sind, so daß er kaum verständlich werden könnte, wenn man sich auf Deutsches beschränken wollte. So soll zumindest an einigen neuralgischen Punkten der Entwicklung komparatistisch verfahren und der Einwirkung der Kultur und Literatur dieser anderen Nationen Rechnung getragen werden. Das betrifft zunächst den Humanismus, der ein gemeineuropäisches Phänomen war, wie er sich ja auch vor allem des Neulateinischen als gemeineuropäischer lingua franca bediente. Die wesentlichen Impulse der Aufklärung kommen aus England bzw. Schottland und aus Frankreich nach Deutschland. Die Französische Revolution und ihre Folgen lassen die deutsche Literatur seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bis weit ins 19. Jahrhundert hinein immer wieder nach Paris schauen. Und auch die ersten Impulse eines Modernismus im engeren Sinne hat die
[<< 21]
deutsche Literatur mit Symbolismus und Naturalismus aus Frankreich empfangen, um von ihnen aus in den Raum einer internationalen Moderne einzutreten. Dem ist die gebührende Beachtung zu schenken.
Belegpraxis
Zum Schluß noch ein Wort zur Belegpraxis. Jedem, der mit der Forschungslandschaft vertraut ist, ist klar, daß bei einer Arbeit wie dieser, den Üblichkeiten der Wissenschaft gemäß, eigentlich bei jedem Absatz, ja fast bei jedem Satz eine seitenlange Diskussion zu führen wäre, in der die vorgetragenen Thesen mit der Forschungslage abgeglichen würden. Das kann aber natürlich nicht geschehen; es hätte den Erstickungstod des Unternehmens zur Folge. So sollen hier in den Anmerkungen vor allem die Zitate nachgewiesen werden; dabei soll auf möglichst leicht erreichbare Ausgaben zurückgegriffen werden. Darüber hinaus sollen lediglich einige besonders ergiebige, rasch weiterführende Anschlüsse an die Forschungsdiskussion benannt werden. Was sich in Handbüchern und Lexika nachschlagen läßt, bleibt ohne Nachweis.
[<< 22]