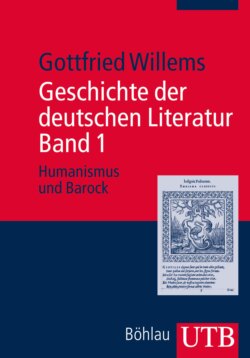Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur. Band 1 - Gottfried Willems - Страница 8
1 Einleitung 1.1 Die Literatur der frühen Neuzeit im kulturellen Gedächtnis
ОглавлениеNeuere Deutsche Literatur
Wer sich für ein Studium der Germanistik und hier wiederum für den Schwerpunkt Neuere Deutsche Literatur entscheidet, der wird dabei kaum schon an die Literatur der frühen Neuzeit denken. Sein Interesse wird durch die Begegnung mit der Literatur anderer Epochen geweckt worden sein, mit Werken vor allem der Gegenwartsliteratur und der Klassischen Moderne, vielleicht auch des 19. Jahrhunderts, der Klassik oder der Romantik, allenfalls noch des 18. Jahrhunderts. Es wird jedoch nicht lange dauern, bis er bemerkt, daß die Wissenschaft die Geschichte der Neueren Literatur bereits um 1500 beginnen läßt und daß dies gute Gründe hat; daß sein Bild von der Neueren Literatur historisch unterbelichtet und sein Zugriff auf die Werke späterer Epochen in manchem unsicher bleiben würde, wenn er sich nicht auch mit der Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts vertraut machen wollte, wie sie ihm unter Epochenbegriffen wie Renaissance und Humanismus, Reformation, Gegenreformation und Barock entgegentritt.
Eckpfeiler des kulturellen Gedächtnisses
Freilich wird er zunächst noch kaum eine Vorstellung davon haben, was er von der Beschäftigung mit ihr für sich und seine literarischen Interessen zu erwarten hat. Denn nur wenig hat sich von ihr im kulturellen Gedächtnis erhalten, ist im literarischen Leben der Gegenwart präsent. Der eine oder andere hat vielleicht schon einmal gehört, daß Martin Luther in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Bibel ins Deutsche übersetzt und damit eine deutsche Hoch- und Literatursprache auf den Weg gebracht habe, oder daß Martin Opitz in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine Literaturreform durchgeführt habe, die eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung zur Klassik, zu Lessing, Goethe und Schiller, Hölderlin und Kleist gewesen sei, doch wo trifft man schon einmal auf einen Text von Luther und
[<< 23] Seitenzahl der gedruckten Ausgabe
Opitz selbst? Kirchgänger haben wohl noch immer einige geistliche Lieder von Luther im Ohr – „Ein feste Burg ist unser Gott“, „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ – oder auch Lieder von Paul Gerhard und einigen anderen ansonsten wenig bekannten Dichtern des Barock – „O Haupt, voll Blut und Wunden“, „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ – doch wer besucht noch regelmäßig einen Gottesdienst?
Wer sich für die deutsche Geschichte interessiert oder wer gerne in die Oper geht, mag schon einmal auf Hans Sachs und die Meistersänger von Nürnberg gestoßen sein; das bedeutet freilich im allgemeinen nicht, daß er auch einem ihrer Meisterlieder begegnet wäre. Immerhin hat sich mancherorts die Erinnerung an einige der sogenannten „Volksbücher“ erhalten, insbesondere an „Schwankromane“ wie die von Till Eulenspiegel und von den Schildbürgern; man kennt deren Geschichten allerdings eher durch moderne Bearbeitungen als durch die Lektüre der Originaltexte. Und natürlich ist „Barocklyrik“, sind Gedichte von Paul Fleming, Andreas Gryphius oder Christian Hofmann von Hofmannswaldau noch immer ein Gegenstand des Deutschunterrichts; man darf aber wohl bezweifeln, daß sie bei einer größeren Zahl von Schülern einen bleibenden Eindruck hinterlassen, daß sie für sie mehr sind als einer unter vielen befremdlichen Schulstoffen. Einzig Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen und sein Roman „Der Abentheuerliche Simplicissimus“ scheinen besser in Erinnerung geblieben zu sein, und überdies unter Vorzeichen, die auch einen Leser von heute eine interessante Lektüre erwarten lassen: da soll man Einblick in die Welt des Dreißigjährigen Kriegs erhalten, und zwar auf eine durchaus spannende, unterhaltsame Weise, ja es soll noch nicht einmal an deftigen Szenen fehlen! Der Rest ist vergessen, scheint allenfalls noch für eine hochspezialisierte Literaturwissenschaft von Interesse zu sein.
Die frühe Neuzeit als Zeit des Übergangs
Daß sich nur so wenig von der Literatur der frühen Neuzeit im kulturellen Gedächtnis erhalten hat, ist auch ein Werk der Germanistik – ausgerechnet der Germanistik, von der man doch anderes erwarten möchte. Aber sie hat nicht nur ihr Teil zu der altehrwürdigen Tradition der Vernachlässigung der frühen Neuzeit beigetragen, sondern sich eine zeitlang auch noch alle Mühe gegeben, diese auf den Boden einer wohlbegründeten Theorie zu stellen. Wenn man eine der Literaturgeschichten zur Hand nimmt, mit denen sie sich im
[<< 24]
19. Jahrhundert ihren Platz unter den akademischen Wissenschaften erobert hat und in den kulturellen Hausrat der Deutschen eingegangen ist, etwa die „Geschichte der deutschen Litteratur“ (1883) von Wilhelm Scherer, dann sieht man auf den ersten Blick, daß sich ihr Interesse zunächst auf zwei Epochen konzentriert hat: auf die „Deutsche Klassik“ der Zeit um 1800, also auf die Entwicklung von Lessing bis zu Goethe und Schiller, und auf die „mittelhochdeutsche Klassik“, auf die Jahre um 1200, die Zeit von Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg. In diesen beiden Epochen sollte die deutsche Literatur nach ihrer Vorstellung ihr Bestes gegeben haben; sie galten ihr als die „Blütezeiten“ dessen, was sie die „deutsche Nationalliteratur“ nannte.
Demgemäß wollte sie in den Jahrhunderten zwischen den beiden „Klassiken“, dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit, nicht mehr als eine Übergangszeit erblicken. Das Spätmittelalter war für sie die Zeit des Abstiegs vom Gipfel der ersten Blüte, eine Periode unaufhörlichen Niedergangs und Verfalls, und die frühe Neuzeit die Phase des allmählichen Wiederaufstiegs zu neuerlichen Höhen, Jahre heftiger Kämpfe und immer neuer Anläufe zu einer Dichtung von Rang. Was dabei an Literatur entstand, galt ihr insgesamt als wenig bedeutend, als gedanklich unreif und ästhetisch unvollkommen; es interessierte sie im Grunde nur aus historischen Gründen, nämlich um an ihm den Prozeß von Niedergang und Wiederaufstieg zu demonstrieren.
Dieses Bild vom Entwicklungsgang der deutschen Literatur verdankt sich wesentlich den Interessen und Wertungen der Bewegung, die an der Wiege der Germanistik stand: der Romantik; genauer: der politischen Romantik, der Nationalromantik, wie sie um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aus der Verbindung der frühromantischen Hochschätzung der schöpferischen Phantasie mit dem nationalen Gedanken, mit der Forderung nach „deutscher Eigenart“ in allen Belangen der Kultur erwuchs. Denn es war sie, die zuerst die Zeit seit dem ersten Auftreten Goethes zur „Morgenröte“ einer „klassischen deutschen Nationalliteratur“ ausrief und die zugleich die Aufmerksamkeit auf die Literatur des Mittelalters lenkte, in der sie den Inbegriff und das Vorbild aller wahrhaft romantischen Poesie erblickte. Hier wie dort sollte es sich um Werke handeln, in denen sowohl die Potentiale der schöpferischen Phantasie in jeder Richtung ausgespielt würden,
[<< 25]
als sie auch mit jeder Faser „deutsche Eigenart“ bezeugen würden und die insofern eben als „klassischer“ Ausdruck der Möglichkeiten einer deutschen Dichtung zu gelten hätten.
Von solchen Vorstellungen aus konnte man aber der Literatur der frühen Neuzeit nur wenig abgewinnen. Diese hatte sich nämlich ganz im Bann der beiden Bewegungen entwickelt, die im 16. Jahrhundert nach und nach dem gesamten kulturellen Leben ihren Stempel aufdrückten: der Renaissance, der Wiederentdeckung und Neuerschließung der Kultur der alten Griechen und Römer durch den Humanismus, und der Reformation und Gegenreformation, des Versuchs einer neuerlichen, besonders intensiven und konsequenten Durchdringung aller Bereiche des Lebens mit den Dogmen und Normen der christlichen Religion. Und das hatte für die Literatur bedeutet, daß sie sich zugleich auf den Weg der „imitatio veterum“, der „Nachahmung der Alten“ begeben und in den Dienst des religiösen Lebens gestellt hatte. Mit anderen Worten: die schöpferische Phantasie hatte sich an das antike und das christliche Erbe gebunden, sie hatte sich selbst dogmatisch-normative Ketten angelegt. Und überdies hatte sie sich dabei von den deutschen Lebensverhältnissen, von „deutscher Art und Kunst“ entfernt, und damit von den Wurzeln, die ihr allein originäre Kraft und Authentizität hätten verleihen können; sie hatte die Kultur der Griechen und Römer gesucht und darüber ihre angestammte Basis aufgegeben. So stellte es sich jedenfalls der Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts dar.
Neue Ansätze der Forschung
Natürlich hat sich die Germanistik inzwischen längst vom Standpunkt der Nationalromantik gelöst. Die Frage nach der „deutschen Eigenart“ ist, nachdem sie kritisch auf ihre problematischen ideologischen Grundlagen hin durchleuchtet worden ist, weithin durch andere Erkenntnisinteressen ersetzt worden. Und auch die Begriffe von Kreativität haben sich gewandelt, auf eine Weise, die der modernen Wissenschaft sehr viel differenziertere Blicke auf das Verhältnis von schöpferischer Phantasie und kulturellem Erbe erlauben als der alten Literaturgeschichtsschreibung. Und so hat sich die Germanistik inzwischen denn auch an einer Wiedergutmachung gegenüber der Literatur der frühen Neuzeit versucht. Das gilt vor allem für die Literatur des 17. Jahrhunderts, die Literatur des Barock. In zwei großen Anläufen – einem ersten in den zwanziger Jahren, einem zweiten in den
[<< 26]
sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts – entstand eine Barockforschung, die alles Erdenkliche unternahm, um den spezifischen Qualitäten der Barockliteratur auf die Spur zu kommen. Dabei spielte gerade die Frage nach dem Verhältnis von „Nachahmung und Schöpfung im Barock“ (G. Weydt)1 eine zentrale Rolle.
So groß die Erfolge dieser Barockforschung aber auch waren und so wichtig sie für die Entwicklung der Neugermanistik wurden – denn um der Literatur der frühen Neuzeit nahekommen zu können, mußte das methodische Instrumentarium der Literaturwissenschaft energisch erweitert werden, mußte eine kulturwissenschaftliche Wende vollzogen und der Blick über die Literatur hinaus auf den gesamten kulturgeschichtlichen Kontext ausgeweitet werden – sie konnte den einmal angerichteten Schaden nicht wieder beheben. Von ihren Entdeckungen ist kaum etwas in das Bewußtsein des breiten Lesepublikums eingedrungen; die deutsche Literatur der frühen Neuzeit ist weiterhin ein blinder Fleck im kulturellen Gedächtnis geblieben.
Moderne und frühneuzeitliche Literatur
Man kann dies auch daraus ersehen, daß sie nur selten von der Literatur des 20. Jahrhunderts rezipiert worden ist, die doch ansonsten einen regen Dialog mit allen möglichen Epochen unterhalten hat, und daß den Werken, die so entstanden, noch seltener ein Erfolg beschieden war. Recht eigentlich bekannt geworden ist im Grunde nur die „Mutter Courage“ (1941) von Bertolt Brecht, die Bearbeitung eines Romans von Grimmelshausen für das Theater. Schon „Das Treffen in Telgte“ (1979) von Günter Grass, ein Erzählung, in der eine Zusammenkunft der wichtigsten Dichter des Barock imaginiert wird, gehört zu den weniger erfolgreichen Werken des Autors. Und in der Gegenwartsliteratur findet man allenfalls noch bei dem einen oder anderen Lyriker Spuren frühneuzeitlicher deutscher Dichtung, etwa bei Sarah Kirsch oder bei Durs Grünbein.2 Bezeichnend ist auch, daß sich viele von denen, die ein Studium der Germanistik hinter sich gebracht haben, im hohen Mittelalter besser auskennen als in der frühen Neuzeit, deren Literatur ihnen doch eigentlich aufgrund der
[<< 27]
größeren zeitlichen Nähe leichter zugänglich sein sollte. Offenbar haben selbst hier die Präferenzen der nationalromantischen Literaturgeschichtsschreibung ihre prägende Kraft behalten.
Probleme für den modernen Leser
Wo aber von der Literatur einer Epoche so wenig im kulturellen Leben der Gegenwart präsent ist, da liegt der Verdacht nahe, daß man nichts Wesentliches verpassen würde, wenn man um sie einen Bogen machte. Diesem Verdacht wird man um so lieber Nahrung geben, als man bei der ersten Annäherung an die Textwelt der frühen Neuzeit feststellen muß, daß sie es einem modernen Leser nicht gerade leicht macht, ja daß sie ihm ein besonderes Maß an Leserfleiß, an Neugier, Konzentration und Ausdauer abverlangt. Die Probleme beginnen bereits mit der Sprache, in der sie auf den Leser zukommt, einem deutlich veralteten, in manchem fast unverständlich gewordenen Deutsch irgendwo zwischen Mittel- und Neuhochdeutsch, dem sogenannten Frühneuhochdeutsch. Nur von sehr wenigen Texten gibt es eine modernisierte, an unser Neuhochdeutsch angeglichene Fassung, etwa vom „Till Eulenspiegel“, von den „Schildbürgern“ und vom „Simplicissimus“; bei allem anderen ist man auf das frühneuhochdeutsche Original angewiesen – ein sicheres Indiz dafür, daß es vom heutigen Lesepublikum nicht mehr angerührt wird. Da bekommt man es dann mit befremdlichen Formen der Orthographie und Interpunktion zu tun, mit einer komplizierten, am Lateinischen geschulten Syntax und mit Wörtern, deren Semantik man sich immer wieder mit Hilfe des Grimmschen Wörterbuchs 3 erschließen muß.
Die Probleme mit der Sprache gehen aber noch weiter. Wer tiefer in die Welt der frühneuzeitlichen Literatur eindringen will, sieht sich früher oder später genötigt, es auch mit der neulateinischen Literatur aufzunehmen; so nennt man die lateinische Literatur seit dem 15. Jahrhundert. Denn die Entwicklung der deutschsprachigen Literatur wird vielfach nur vor dem Hintergrund dessen verständlich, was seinerzeit im Raum dieser neulateinischen Literatur geschah. Die Elite der Gebildeten – Theologen und humanistische Gelehrte – verständigte sich und schrieb in lateinischer Sprache, und die deutschsprachige
[<< 28]
Literatur zehrte von dem, was hier an Texten entstand, was etwa die Humanisten bei ihrem Studium der antiken Kultur der Literatur an neuen Möglichkeiten erschlossen. So muß jede vertiefte Untersuchung eines Stoffs oder Motivs, einer Gattung, einer Stilfigur oder eines anderen Aspekts der Form, ja der Konzepte von Kunst und Literatur überhaupt irgendwann auch die Schwelle zum Lateinischen überschreiten; denn von den neulateinischen Texten ist noch weniger in unser modernes Deutsch übertragen worden als von den frühneuhochdeutschen.
Und weitere Hürden sind bei der Annäherung an die Literatur der frühen Neuzeit zu meistern. Die Autoren schrieben für ein Publikum, dessen Welt- und Menschenbild wesentlich durch die christliche Religion und das Erbe der Antike geprägt war und das insofern in einem Maße mit den Geschichten, Lehren, Bildern und sprachlichen Wendungen der Bibel, mit den Viten der Heiligen und den Dogmen und Normen der christlichen Theologie sowie mit den Mythen, den Götter- und Heldengeschichten der Griechen und Römer, mit deren Geschichte, Wissenschaft, Kunst und Literatur vertraut war, das einem Leser von heute in der Regel nicht mehr gegeben ist. Will er dem Gerechtigkeit widerfahren lassen, was die Texte davon in sich aufgenommen haben, und will er sich keine der Anspielungen, der direkten und indirekten Verweise entgehen lassen, die in dieser untergegangenen Bildungswelt gründen, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich in deren Wissensbestände einzuarbeiten.
Hinzu kommt, daß sich die Literatur der frühen Neuzeit auf Lebensformen bezieht und von Lebensformen spricht, die sich deutlich von dem unterscheiden, was ein heutiger Leser gewohnt ist. Denn natürlich sah der Alltag der Menschen in einer Welt, die noch nichts vom Fortschritt, von moderner Wissenschaft, technisch-industrieller Produktionsweise, demokratischer Bürgergesellschaft und bürokratischem Rechts- und Sozialstaat wußte, die in allem auf Tradition und Religion setzte, in ständische Hierarchien gegliedert war und von Landwirtschaft und Handwerk lebte, in vielem anders aus als heute. Auch damit muß sich der Leser erst vertraut machen.
Eine Literatur ohne bleibende Bedeutung?
Wo aber bereits im Vorfeld der Auseinandersetzung mit dem literarischen Text so viel an Vor- und Nebenarbeiten zu leisten ist, da kann die Frage nicht ausbleiben, ob sich der Einsatz wirklich lohne,
[<< 29]
und sie wird sich hier um so energischer zu Wort melden, als das kulturelle Gedächtnis nur so wenig von lohnenden Gegenständen weiß. Vielleicht hat die nationalromantische Literaturgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts ja doch nicht ganz Unrecht gehabt, wenn sie die frühe Neuzeit als eine bloße Übergangszeit behandelte. Vielleicht war ja etwas an der Kultur dieser Epoche – die Prädominanz der Theologie, die Fixierung auf das Erbe der Antike – das keine bleibenden Leistungen zuließ, das das Entstehen einer Kunst verhinderte, die einen Menschen von heute noch immer unmittelbar ansprechen und nachhaltig beschäftigen könnte. Das wäre doch immerhin möglich.4
Die Kunst der Renaissance
Der böse Verdacht verfliegt jedoch mit einem Schlag, sobald man über den Tellerrand der deutschen Literatur hinaussieht und die Literatur anderer europäischer Nationen mit ins Auge faßt, und er löst sich vollends in nichts auf, wenn man auch an andere Künste denkt, etwa an die Bildende Kunst. Von allem, was aus fernen Zeiten auf die heutige Menschheit gekommen ist, ist wohl nur wenig in der Kultur der Gegenwart so präsent wie die Kunst der Renaissance; das gilt selbst für die populäre Kultur. Von den italienischen Künstlern Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael und von dem deutschen Albrecht Dürer hat jeder halbwegs gebildete Zeitgenosse schon einmal etwas gehört. Werke wie die „Mona Lisa“ und das „Abendmahl“ von Leonardo, der „David“ und die Fresken der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo, die „Sixtinische Madonna“ von Raffael, die „Betenden Hände“, der „Hase“ und die „Apokalyptischen Reiter“ von Dürer haben einen so hohen Wiedererkennungswert, daß sogar die Werbung von ihnen Gebrauch macht. Kaum weniger bekannt sind einige Künstler des Barock wie die Niederländer Rembrandt und Rubens.
Bedeutende Bauwerke der Renaissance wie der Petersdom in Rom und solche des Barock wie das Königsschloß in Versailles sind beliebte Touristenziele und werden jedes Jahr von Hunderttausenden besucht. Wenn ein Museum eine Ausstellung der Werke von Mantegna oder Giorgione, Tizian oder Caravaggio zustande bringt, wird es von einem begeisterten Publikum überlaufen. Niemand, der Kunstgeschichte
[<< 30]
studiert oder sich überhaupt für Kunst interessiert, kommt an der frühen Neuzeit vorbei; die Vertrautheit mit ihrer Kunst ist die Basis für alles andere. An der Kultur der frühen Neuzeit, an dem, was sie den Menschen an geistigem Rüstzeug mitgab und an kreativen Möglichkeiten eröffnete, kann es also nicht liegen, wenn die deutsche Literatur jener Jahre im kulturellen Gedächtnis nur noch ein Schattendasein fristet.
Die frühneuzeitliche Literatur anderer Nationen
Dieser Befund bestätigt sich bei einem Blick auf die Literatur anderer europäischer Nationen, etwa auf die der Italiener, Spanier und Franzosen, der Engländer und Niederländer. Was hier jeweils für die klassische Phase der Literaturgeschichte, für die „Blütezeit“, das „Goldene Zeitalter“ der Nationalliteratur gehalten wird, ist nämlich durch die Bank bereits in der frühen Neuzeit angesiedelt, und man kann nicht erkennen, daß das dem literarische Leben zum Nachteil gereicht hätte – im Gegenteil: für jede dieser Literaturen ist das Gespräch mit den großen Autoren der frühen Neuzeit bis heute eine Quelle ihres spezifischen Reichtums.
Bei den Italienern läßt man die „Blütezeit“ mit Dante (1265 –1321), Petrarca (1304 –1374) und Boccaccio (1313 –1375) sogar schon im Spätmittelalter beginnen, um sie in der frühen Neuzeit mit Ariost (1474 –1533) und Tasso (1544 –1595) lediglich ausklingen zu lassen. Die Spanier erblicken ihr „Siglo d’oro“ in der Zeit von Cervantes (1547 –1616), Lope de Vega (1562 –1635) und Calderón (1600 –1681), die Engländer ihr „Golden Age“ im Umkreis von Shakespeare (1564 –1616), die Franzosen haben ihr „Grand Siècle“ in der Zeit von Corneille (1606 –1684), Molière (1622 –1673) und Racine (1639 –1699), und die Niederländer ihr „Golden Eeuw“ in der ihres Joost van den Vondel (1587 –1679). Es versteht sich von selbst, daß die solchermaßen zu Klassikern ausgerufenen Autoren im kulturellen Gedächtnis dieser Nationen eine prominente Rolle spielen und daß ihre Werke bis auf den heutigen Tag bei ihnen ein zentraler Gegenstand des Interesses sind.
Frühneuzeitliche Klassiker der Weltliteratur
Sie alle sind übrigens früher oder später auch in Deutschland gelesen worden, und sie sind hier vielfach so intensiv rezipiert worden, daß sie in der deutschsprachigen Literatur tiefe Spuren hinterlassen haben. Ja einige von ihnen haben stärker auf spätere Generationen gewirkt und sind im literarischen Leben der Gegenwart präsenter als die meisten deutschen Autoren der frühen Neuzeit. Das gilt vor allem
[<< 31]
für William Shakespeare, einen Engländer, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts – noch nicht im 17. Jahrhundert, erst in der Zeit von Aufklärung und Romantik – geradezu eine postume Adoption durch die Deutschen über sich ergehen lassen mußte und der seither zu einem nicht wegzudenkenden Bezugspunkt der deutschen Literatur geworden ist.5 Aber nicht nur in Deutschland ist Shakespeare bis heute einer der meistgelesenen und meistaufgeführten Theaterautoren – er ist es weltweit. Wo immer man sich für Theater interessiert, da hat man auch schon einmal etwas von „Romeo und Julia“ und „Hamlet“ gehört, von „Macbeth“ und „Othello“, „Julius Caesar“, „Richard III.“ und „Heinrich V.“, dem „Kaufmann von Venedig“, „Der Widerspenstigen Zähmung“ und dem „Sommernachtstraum“.
Wie präsent das Oeuvre Shakespeares im kulturellen Leben der Gegenwart ist, ist nicht zuletzt daraus zu ersehen, daß es öfter verfilmt worden ist als das jedes anderen Autors der Weltliteratur. Fast jedes Jahr bringt mehrere neue Verfilmungen, und sie finden vielfach selbst dann ihr Publikum, wenn sie – wie „Heinrich V.“ von Kenneth Branagh – im Kostüm der Shakespeare-Zeit daherkommen und sich an die hochpoetischen, mit humanistischem Bildungsgut vollgepfropften Originaldialoge halten. Und natürlich ist auch das produktive Gespräch der Literatur mit Shakespeare bis heute nicht abgerissen, auch und gerade dort nicht, wo sie sich entschieden modernen Konzepten verschrieben hat. Hier sei nur an die „Hamletmaschine“ (1978) von Heiner Müller sowie an den „Park“ (1983) von Botho Strauß erinnert, wo noch einmal die Elfenwelt des „Sommernachtstraums“ beschworen wird.
Shakespeare ist wohl das beste Beispiel dafür, daß auch die frühe Neuzeit zu literarischen Werken fähig war, die das Publikum bis heute in ihren Bann zu ziehen vermögen, daß auch ihre Kultur über gedankliche und ästhetische Ressourcen verfügte, die eine Literatur entstehen ließen, die den Menschen bis heute etwas zu sagen hat. Shakespeare ist freilich eine einzigartige Erscheinung, und so lassen sich ihm nur
[<< 32]
wenige Autoren an die Seite stellen, die auf ähnlich eindrucksvolle Weise für die Bildungswelt der frühen Neuzeit zeugen. Doch es gibt sie, und es gibt genug von ihnen, um den Befund zu verallgemeinern. Da ist zunächst an Cervantes – mit vollständigem Namen: Miguel de Cervantes Saavedra – und seinen Roman „Don Quijote“ (1605 –1616) zu denken, und sodann an Molière – mit bürgerlichem Namen Jean-Baptiste Poquelin – und dessen Theater, an Komödien wie „Der Arzt wider Willen“ (1667), „Der Misanthrop“ (1667), „Tartuffe“ (1669), „Der Bürger als Edelmann“ (1672), „Der eingebildete Kranke“ (1673) und „Der Geizige“ (1682). Wie die Werke von Shakespeare finden auch sie bis heute auf direktem Wege zu einem breiten Publikum.
Und ein weiterer Autor kann hier noch genannt werden, der zwar nicht ganz so bekannt ist, weil sein Werk nicht der Kernzone der Literatur angehört, der jedoch gerade von der modernen Literatur als Gesprächspartner besonders ernst genommen worden ist: Michel de Montaigne (1533 –1592). Seine „Essais“ (1580 –1595), kurze Aufsätze über die verschiedensten Gegenstände des Interesses, gelten als erstes Beispiel der Gattung „Essay“ und Muster der essayistischen Schreibweise, also eines literarischen Phänomens, das gerne für typisch modern gehalten wird. In ihnen will man erstmals die Stimme des modernen Individuums vernehmen, wie es sich als Selbstdenker durch die Welt bewegt, selbst den ehrwürdigsten Traditionen und der Wissenschaft mit Skepsis begegnet und in allem auf die eigene Erfahrung und die eigene Einsicht setzt.
Moderne Züge?
Shakespeare, Cervantes, Molière, Montaigne – diesen Namen läßt sich aus deutscher Sicht allenfalls der von Grimmelshausen an die Seite stellen. Denn er ist der einzige, der eine vergleichbare Präsenz im literarischen Leben der Gegenwart hat, und auch das nur mit Abstrichen. Literarhistoriker neigen dazu, an den Werken der genannten Autoren um solcher Präsenz willen bereits moderne Züge zu entdecken, so als hätten diese etwas von den Lebensverhältnissen, den Interessen und Vorstellungen des modernen Menschen vorausgeahnt; und manche berufen sich dabei immer noch auf das, was eine Genieästhetik, die freilich inzwischen in die Jahre gekommen ist und weniger der Wissenschaft als der wundersamen Welt des populären Künstlerkitschs angehört, „die antizipatorische Kraft der Kunst“ nennt.
Doch niemand kann in die Zukunft schauen, auch kein Dichter. Ein Shakespeare war genauso ein Kind seiner Zeit wie jeder andere
[<< 33]
unter seinen schreibenden Zeitgenossen, war ebenso in die Lebens- und Vorstellungswelt seiner Epoche eingeschlossen wie sie und verfügte nicht über besondere, vom Himmel der Inspiration gefallene seherische Gaben – wie sollte er auch! Bei dem, was sein Werk vor anderen auszeichnet und was es die große historische Distanz bis heute scheinbar mühelos hat überwinden lassen, kann es sich nur um besondere gedankliche und ästhetische Qualitäten handeln, um Qualitäten, wie sie aus der Fähigkeit eines Autors erwachsen, schärfer und rücksichtsloser als andere in die Welt und auf die Mitmenschen zu blicken und die Möglichkeiten seiner Zeit energischer zu ergreifen und konsequenter und einfallsreicher zu nutzen als sie.
Zwei weitere Momente kommen hinzu, die dem modernen Leser die Annäherung an die genannten Autoren erleichtern. Zum einen sind sie in Fragen der Religion zurückhaltender als viele ihrer Zeitgenossen, sind sie nicht so penetrant fromm und so ängstlich um theologische Korrektheit bemüht wie diese, was heute vom Leser im allgemeinen mit dem Gefühl der Monotonie quittiert wird: was auch an Geschichten, Gefühlen und Gedanken vor ihm ausgebreitet werden mag – am Ende steht der immer gleiche Sturz in den immer gleichen Abgrund des Glaubens. Von solcher Diskretion kann bei Grimmelshausen allerdings nicht die Rede sein; bei ihm sind religiöse Fragen allgegenwärtig. Dafür kommt sein Werk dem modernen Leser an anderer Stelle entgegen: es verlangt ihm nicht so viel an humanistischer Bildung ab wie das anderer frühneuzeitlicher Autoren, ist nicht in gleichem Maße mit dem gelehrten Wissen der Zeit durchdrungen; davon wird noch zu reden sein.
Und zum andern sind die Werke dieser Autoren dank ihrer ununterbrochenen Präsenz über die Jahrhunderte hin dem modernen Leser am besten erschlossen. Jede Generation hat sie im Licht der jeweils neu aufkommenden Interessen gedeutet und damit ihr Teil dazu beigetragen, daß sie an den Horizont der Gegenwart herangeführt wurden. Wer heute Shakespeare liest, der kann dabei von dem Bild profitieren, das sich Aufklärung, Klassik und Romantik, Vormärz und Realismus von ihm gemacht haben; denn durch sie sind seine Texte nach und nach mit den meisten der Fragen und Gesichtspunkte in Berührung gebracht worden, die einen Menschen von heute bei der Lektüre leiten mögen.
[<< 34]
Die Macht des kulturellen Gedächtnisses
Es gibt in der frühen Neuzeit also doch eine ganze Reihe von Autoren und Werken, die bestens in Erinnerung geblieben sind, die unter dem Vorzeichen großer historischer und ästhetischer Bedeutung auf uns gekommen sind, und überdies auf eine Weise, durch die uns der Zugang zu ihnen leicht gemacht wird. Die Stellung im Haushalt des kulturellen Gedächtnisses und die Zugänglichkeit für den heutigen Leser sind freilich nicht alles. Das kulturelle Gedächtnis ist kein Gottesgericht, und was dem Leser im ersten Zugriff Mühe bereitet, muß deshalb nicht immer schon irrelevant und uninteressant sein; ja ist es nicht vielfach gerade das wenig Beachtete und halb schon Vergessene, das Sperrige, Beschwerliche und Befremdliche, was uns am ehesten dazu verhilft, neue Erfahrungen zu machen und neue Einsichten zu gewinnen?
Hier hatte allerdings zunächst die Frage nach dem kulturellen Gedächtnis 6 und den Problemen des Zugangs zur Literatur im Vordergrund zu stehen, denn mit ihr beginnt die Arbeit der Literaturgeschichtsschreibung. Was immer sie anpackt, kommt als ein Gegenstand auf sie zu, dem das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft bereits seinen Stempel aufgedrückt hat, den es mit bestimmten Erwartungen, bestimmten Vorstellungen und Wertungen versehen, ja geradezu imprägniert hat. Es ist überall mit am Werk, wo sich Menschen der Literatur zuwenden, in den Räumen ihrer kulturellen Sozialisation – im Elternhaus, in der Schule, im Freundeskreis – genauso wie in denen des öffentlichen Lebens und der medialen Kommunikation, die Wissenschaft nicht ausgenommen. So bekommt in Deutschland jedes Kind früher oder später mit, daß es einen Goethe und einen Schiller gegeben hat und daß diese etwas geschaffen haben, das heute noch von vielen für bedeutsam gehalten wird, wenn es vielleicht auch schon etwas angestaubt sein mag, und das wird in dieser oder jener Form einen Einfluß auf seinen Umgang mit Literatur haben. Und wenn man von einer bestimmten kulturgeschichtlichen Erscheinung nur wenig oder gar nichts zu hören bekommt, so wie von weiten Teilen der frühneuzeitlichen Literatur, dann begründet auch dies eine
[<< 35]
Erwartung, nämlich eine Art „Null-Erwartung“, und auch solche „Null-Erwartung“ hat Folgen.
Literaturwissenschaft und kulturelles Gedächtnis
Das kulturelle Gedächtnis bezeichnet den Wissens-Fond, um nicht zu sagen: den Bodensatz des literarischen Lebens, und so hat es die Literaturwissenschaft zunächst mit ihm aufzunehmen. Seine Kenntnis allein erlaubt es ihr, sich gezielt auf die Problemfelder einzustellen, um deren Bearbeitung willen sie von der Gesellschaft unterhalten wird: auf die Aufgabe, das literarische Leben zu fördern, indem sie ihm ein Mehr an Wissen zuführt und damit seinen Horizont und seinen Aktionsradius erweitert – ein Unternehmen, mit dem sich letztlich die Hoffnung verbindet, daß die Horizonte des individuellen und gesellschaftlichen Lebens so überhaupt erweitert werden könnten, daß sich neue Optionen des Denkens und Handelns eröffnen oder vergessene Optionen neuerlich bewußt werden würden.
Das erste, was die Literarwissenschaft bei der Annäherung an eine Epoche zu tun hat, ist also, die Bestände des kulturellen Gedächtnisses zu sichten und sich von ihrem Einfluß Rechenschaft zu geben, so wie hier geschehen. Sie kann sich weder damit begnügen, diese Bestände einfach zu übernehmen, noch sie pauschal in Frage zu stellen; vielmehr muß sie versuchen, sie kritisch auf die Vorstellungen und Wertungen hin zu durchleuchten, die ihnen zugrunde liegen, die Voraussetzungen aufzuzeigen, unter denen sie sich gebildet, und die Folgen, die sie gezeitigt haben. Nur so kann ja jenes Mehr an Wissen entstehen, um dessen Gewinnung es zu tun ist.
Dabei rückt eben das, was der kollektiven Erinnerung entfallen ist, was sie als etwas Beschwerliches und Befremdliches beiseite gesetzt und für überholt erklärt, ja um seiner Unbehaglichkeit willen womöglich verdrängt hat, in den Mittelpunkt des Interesses. Es geht nun gerade um das Vergessene, Verdrängte und Befremdliche, und es geht selbst dort darum, wo man sich die Lieblingskinder des kulturellen Gedächtnisses, die Klassiker vornimmt. Denn anders als die Protagonisten des literarischen Lebens kann es sich ein Literarhistoriker, der die Aufgabe seines Fachs ernst nimmt, nicht mit einem aufklärerischen Cervantes, einem romantischen Shakespeare oder einem realistischen Grimmelshausen bequem machen, muß er es auch und gerade bei solchen kanonischen Autoren mit dem aufnehmen, was von einem heutigen Leser an
[<< 36]
ihren Werken im ersten Anlauf als irritierend und beschwerlich empfunden werden mag.
Das Spannungsfeld von Identität und Alterität
Dem Leser kann dies letztlich nur recht sein. Die Literarhistorie kommt damit nämlich einem Verlangen entgegen, das in jeder Lektüre mit am Werk ist, ja das geradezu einen Grundimpuls des Lesens bezeichnet. Denn warum greifen wir zu einem Buch? Doch weil wir einmal etwas anderes hören wollen; weil wir über die Lebens- und Vorstellungswelt, an die wir gewöhnt sind, hinausgehen und uns mit Möglichkeiten des menschlichen Daseins konfrontieren wollen, die nicht die unseren sind, die uns insofern zunächst fremd sind und vielleicht sogar auf Dauer fremd bleiben. Freilich verbindet sich damit die Hoffnung, über solcher Lektüre auch etwas für die eigene Lebens- und Vorstellungswelt zu gewinnen, zu erleben, daß die eigenen Selbstverhältnisse zugleich sicherer und offener werden und das eigene Leben und Denken sowohl eine Bereicherung erfahren als auch klarere Konturen annehmen.
Die moderne Literaturwissenschaft verhandelt diese beiden Aspekte des Lesens gerne unter dem Titel „Identität und Alterität“. Lesend gehen wir sowohl auf Momente aus, mit denen wir uns identifizieren können, als auch auf solche, die uns als ein „alter“, ein Anderes, Unbekanntes, Fremdes entgegentreten. Genauer betrachtet, handelt es sich um einen Prozeß dialektischer Wechselwirkung. In der Konfrontation mit Alterität konstituiert sich Identität, und im Innewerden von Identität wird Alterität allererst zu Alterität. Dies ist aber eben als ein Prozeß zu verstehen und nicht als ein einmaliger Akt mit einem unverrückbaren Resultat. Denn die Begegnung mit dem Fremden kann auch dazu führen, daß wir in einen produktiven Dialog mit ihm eintreten und es uns unter diesem oder jenem Aspekt zueigen machen. Damit aber geraten beide Seiten gleichzeitig in Bewegung: Fremdes hört auf, fremd zu sein, und die Identität wird eine andere – was nichts anderes heißt, als daß Momente, mit denen man sich bis dato identifiziert hat, nun selbst zu etwas Fremdem werden.
Jede Lektüre vollzieht sich in einem Spannungsfeld von Identität und Alterität, Lesergewohnheit und Leserneugier, und je mehr ein Text der Neugier an Alterität, an Unbekanntem, Ungewöhnlichem, Befremdlichem zu bieten hat, desto mehr kann im Leser bei der Auseinandersetzung mit ihm in Bewegung geraten, desto besser sind die
[<< 37]
Aussichten auf eine spannende und ergiebige Leseerfahrung. Wenn das aber richtig ist, dann muß uns gerade eine Literatur wie die der frühen Neuzeit, die uns wegen ihrer großen historischen Distanz inzwischen in vielem fremd geworden ist, eben weil sie uns fremd geworden ist, besonders viel zu sagen haben. Freilich wird man sich den Schatz an Leseerfahrungen, den sie für uns bereithält, nur in dem Maße erschließen können, in dem man es bewußt und gezielt mit diesem fremd Gewordenen aufnimmt, in dem man sich bei der Lektüre nicht mit bequemen Möglichkeiten der Identifikation zufrieden gibt und alles andere einfach überliest.