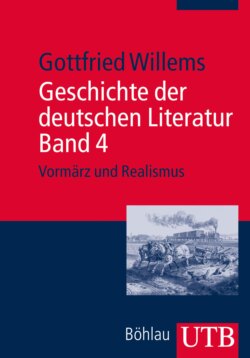Читать книгу Geschichte der deutschen Literatur Band 4 - Gottfried Willems - Страница 9
1.3 Modernisierung im 19. Jahrhundert
ОглавлениеDer Glaube an den Fortschritt
Wenn man die geschichtlich-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Literatur des 19. Jahrhunderts entstanden ist, auf eine kurze Formel bringen wollte, so könnte man sagen: die Welt wird modern, sie wird nun ein für allemal, auf unumkehrbare Weise modern. Zwar nimmt sich das meiste von dem, was aus dem 19. Jahrhundert auf uns gekommen ist – Stadtlandschaften, Gebäude, Möbel und andere Gegenstände des täglichen Gebrauchs, Bilder und die Menschen und Dinge, die in ihnen dargestellt sind – in unseren Augen inzwischen reichlich altmodisch aus, trägt es für uns deutlich das Gepräge des Überholten. Doch wissen wir zugleich, daß es dem, was uns selbst zur Zeit gerade als modern gilt, nicht anders ergehen wird; daß man auch darauf binnen kurzem als auf etwas Veraltetes zurückblicken wird. In der modernen Welt ist es nun einmal nicht anders: jeder erlebt nur seine unmittelbare Gegenwart als modern und empfindet alles Frühere als Schnee von gestern. Vor allem an dieser Dynamik des ständigen Überholens und Überholtwerdens, genauer: an dem Bewußtsein von solcher Dynamik, an dem allgegenwärtigen Gefühl des Verfallenseins an die Geschichte erkennt man die Moderne.
Die Welt wird modern – das heißt zunächst, daß der Glaube unter den Menschen mehr und mehr an Boden gewinnt, die Gesellschaft bedürfe des Fortschritts, und daß dieser Glaube immer entschiedener ihr Handeln bestimmt; daß er sich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Geltung verschafft, von der großen Politik und dem staatlichen Verwaltungshandeln bis hin zu den Lebensformen, die den Alltag der kleinen Leute bestimmen, von der Wirtschaft und [<<13] der Arbeitswelt bis hin zu den Bezirken der Kultur im engeren Sinne, bis hin zu Bildung und Erziehung, Religion, Wissenschaft, Kunst und Literatur. In Worten Gutzkows:
Modern ist es, die Welt anzuerkennen, wie sie geworden ist, aber das Recht zu bezweifeln, ob sie so bleiben darf, wie sie ist. (GS 2, 131)
Eben in diesem Sinne wird die Welt im 19. Jahrhundert modern. Der Begriff des Fortschritts wird zu einem Schlüsselwort in allen gesellschaftlichen Diskursen.
Eine Gesellschaft ist dann eine moderne, wenn in ihr der Glaube zu einer bestimmenden Macht geworden ist, daß sie sich ständig modernisieren müsse, daß sie nur dann etwas tauge und eine Zukunft habe, wenn sie jederzeit und überall am Fortschritt arbeite. Solcher Glaube lebt aus der Überzeugung, daß alles, was der Mensch tut und macht, von Veraltung bedroht sei und deshalb immer wieder durch Neues, Besseres ersetzt werden müsse. Der Glaube an den Modernisierungsbedarf aller menschlichen Dinge ist vor allem von der Aufklärung des 18. Jahrhunderts auf den Weg gebracht worden. In der Französischen Revolution von 1789 ist dann sichtbar geworden, welche Dimensionen die Modernisierung annehmen kann und was ihre Chancen, aber auch ihre Gefahren sind. Und im 19. Jahrhundert ist die Welt schließlich in endlosen Kontroversen um das Wohl und Wehe des Fortschritts in einen Modernisierungswirbel hineingerissen worden, der sich bis heute ständig beschleunigt hat und sich offenbar immer nur weiter beschleunigen kann. So kann Gutzkow schon 1837 feststellen: „Alles ist Hebel für die Zukunft geworden (…)“ (GS 2, 119).
Fortschritt und Wissenschaft
Die wichtigste Quelle der Modernisierung ist die Wissenschaft, sind vor allem die modernen Naturwissenschaften; die Wissenschaft ist für die moderne Gesellschaft so etwas wie die zentrale Agentur des Fortschritts. Denn sie ist dank ihrer eigentümlichen Forschungslogik unausgesetzt damit beschäftigt aufzuzeigen, daß man die Dinge auch anders sehen und machen kann als bis dato üblich, und das heißt, daß sie ständig altgewohnte Vorstellungen und Praktiken für überholt erklärt und damit einen immer neuen Modernisierungsbedarf definiert. Modern ist, „(a)lles durch Rede und Schrift in Erörterung zu ziehen“ (GS 2, 146). In eben diesem Sinne ist die Wissenschaft im [<<14] 19. Jahrhundert zu einem unentbehrlichen Faktor, ja zu einem Eckpfeiler des gesellschaftlichen Lebens geworden.
Man kann das schon äußerlich daran erkennen, daß die Institutionen, die dem Erwerb und der Ausbreitung des wissenschaftlichen Wissens dienen, hier in völlig neue Dimensionen hineinwachsen, von den Universitäten bis hin zu den höheren Schulen und den anderen Einrichtungen von Forschung und Lehre. Das Wissen, mit dem sich die Gesellschaft organisiert und ihre Geschäfte betreibt, erfährt eine durchgreifende Akademisierung, ja die Gesellschaft selbst wird mehr und mehr akademisch. Immer mehr Menschen studieren, werden mit einer akademischen Ausbildung ausgestattet, um in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft mit dem neuesten Wissen der Wissenschaft für die Modernisierung tätig zu werden. Das heißt auch, daß man ohne akademische Diplome nun nicht mehr viel werden kann.
Industrielle Revolution
Der wichtigste Transformator für die Modernisierungsenergie, die durch die Wissenschaft erzeugt und freigesetzt wird, ist die Arbeitswelt, und hier wiederum besonders jener Bereich, in dem sich die Organisation der Arbeit vollzieht, die Ökonomie; diese gibt sich zu eben diesem Zweck die Form der modernen kapitalistischen Wirtschaft. So kann das von der Wissenschaft erarbeitete neue Wissen, können insbesondere die von ihr ermöglichten neuen technischen Produktionsverfahren in großem Stil umgesetzt werden. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der „industriellen Revolution“, des Übergangs zu der von der Wissenschaft ermöglichten technisch-industriellen Produktionsweise, ein Prozeß, der in der ersten Jahrhunderthälfte zunächst vor allem in England Fahrt aufgenommen hat – aus England kommen die Dampfmaschine, die Eisenbahn und viele andere Leittechniken der industriellen Revolution – um in der zweiten Jahrhunderthälfte und insbesondere in den Gründerjahren dann auch weite Teile Deutschlands zu erfassen.
Soziale Dynamik und „soziale Frage“
Die Industrialisierung erzeugt eine soziale Dynamik, die nach und nach von immer mehr Menschen Besitz ergreift. Alle Verhältnisse geraten in Bewegung, „Ruhe wird unmöglich“ (GS 2, 119). Modernisierung heißt wesentlich „Mobilmachung“, Mobilisierung der Massen. Immer mehr Menschen werden in Bewegung versetzt, werden aus ihrer gewohnten Umgebung, aus der Welt ihrer Herkunft herausgerissen, um an andere Orte und in andere soziale Zusammenhänge verpflanzt [<<15] zu werden; sie werden, wie man es seinerzeit empfunden hat, ihrer Wurzeln beraubt, erleiden eine „Entwurzelung“.
Dank der modernen Landwirtschaft mit ihrer reicheren Produktion von Lebensmitteln und dank der Segnungen der modernen wissenschaftlichen Medizin und Hygiene wächst die Bevölkerung. Dieses Wachstum ist freilich für viele und gerade für weite Teile der Landwirtschaft treibenden Landbevölkerung selbst zunächst mit Verarmung verbunden, da sich zugleich das gesamte Gefüge der Ökonomie im Sinne der kapitalistischen Geldwirtschaft verändert, und damit der Zugang zu den erwirtschafteten Gütern; es kommt zur Landflucht, wie sie die Menschen bald in die nahen Städte und bald in ferne Länder führt, etwa in die neuen amerikanischen Staaten auswandern läßt. Um die neuen Produktionsstätten, die Fabriken herum breiten sich die Städte immer weiter aus; es entsteht die moderne Großstadt. In ihr wächst ein Industrieproletariat heran, das wie die verarmte Landbevölkerung ständig um das Existenzminimum ringen muß. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Pauperismus oder, ins Politische gewendet, von der sozialen Frage.
Zugleich werden einige wenige über der Industrialisierung extrem reich, und das müssen sie auch, denn zur Finanzierung der industriellen Massenproduktion bedarf es gewaltiger Mittel, bedarf es neuer Formen der „Akkumulation von Kapital“ (Karl Marx). Es bildet sich eine neue Schicht der Gesellschaft, die Bourgeoisie, gekennzeichnet durch neue Typen von Besitzbürgertum wie den Kapitalisten, den „Entrepreneur“ – den Unternehmer –, den Industriekapitän, den Finanzjongleur und den Börsenspekulanten, Typen, die bald schon eine große gesellschaftliche Bedeutung erlangen und dementsprechend auch in die Literatur einwandern.
Der Kontrast könnte nicht größer sein: hier die neuen Superreichen – da die verarmte Landbevölkerung und das kaum weniger arme Industrieproletariat. „Durch alle unsere Verhältnisse“, konstatiert Gutzkow, „zieht sich der gewaltige sociale Riß, diese klaffende Wunde des Jahrhunderts“ (GS 2, 169). So hat die Dynamik der Modernisierung im 19. Jahrhundert unausgesetzt sozialen Sprengstoff produziert; die Kollateralschäden des Fortschritts werden unübersehbar.
Progressiv vs. konservativ
Darauf konnte und kann man auf unterschiedliche Weise reagieren. Zwei typische Wege zeichnen sich bereits zu Beginn des [<<16] 19. Jahrhunderts deutlich ab. Da sind auf der einen Seite diejenigen, die die negativen Folgen des Fortschritts durch ein Noch-Mehr an Fortschritt, durch einen besseren, tiefergreifenden, fortschrittlicheren Fortschritt überwinden wollen – der Weg der Progressiven, der sich alles in allem durchgesetzt hat und bis heute in den meisten praktischen Belangen den Kurs der Gesellschaft bestimmt. Und da sind auf der anderen Seite diejenigen, die den Fortschritt an die Kette legen, im Rückgriff auf die Tradition begrenzen, zähmen, domestizieren wollen, die ihn in altbewährte Strukturen einfangen und so eine gewisse Stabilität in den Wandel bringen wollen – der Weg der Konservativen.
Solche konservativen Gedanken haben das 19. Jahrhundert nicht weniger bewegt als der Fortschritt, weshalb man von ihm auch als von einer Zeit der „defensiven Modernisierung“ (Hans-Ulrich Wehler) gesprochen hat. Sie haben sich vor allem an den Mobilisierungseffekten der Modernisierung entzündet, an der immer weiter um sich greifenden, immer totaler werdenden Mobilmachung von Natur und Gesellschaft, über der sich die Welt in einen einzigen gewaltigen Verschiebebahnhof für Menschen und Dinge zu verwandeln schien – an eben dem, was man „Entwurzelung“ nannte. Und so ist das 19. Jahrhundert nicht nur ein Jahrhundert der Begeisterung für den Fortschritt geworden, sondern zugleich auch das Jahrhundert des Historismus, einer immer intensiveren Beschäftigung mit dem kulturellen Erbe, insbesondere mit überkommenen Modellen einer weniger mobilen, stabiler scheinenden Gesellschaftsordnung.
Nicht jeder vermag bekanntlich bei der Modernisierung gleich gut mitzuhalten. Früher oder später kommt auch der flexibelste Mensch in seinem Leben an einen Punkt, wo ihm der ständige Wandel der Lebensverhältnisse, die permanente Transformation des Wissens, der Anforderungen der Gesellschaft, der sozialen Beziehungen, der Arbeitswelt und des Alltags über den Kopf wachsen und er nicht mehr mitgehen kann und will – die anthropologische Grenze der Modernisierung. Denn zur Grundausstattung des Menschen gehört nicht nur die Neugier; er ist nicht nur „rerum novarum cupidus“, auf Neues begierig, und insofern auf Erneuerung hin angelegt. Er ist auch ein Gewohnheitstier; Gewohnheit ist, wie schon Aristoteles wußte, seine zweite Natur. Und dieses Gewohnheitstier im Menschen beginnt sich zu wehren, wenn es sich durch die Modernisierung überfordert fühlt, beginnt [<<17] zumindest von der „guten alten Zeit“ zu träumen, als von einer Zeit, in der noch weniger Bewegung in der Welt gewesen wäre, in der die Welt überhaupt noch in Ordnung gewesen wäre und man sich leichter in solche Ordnung hätte finden können.
Historismus
Und so hat das 19. Jahrhundert wie die Zukunftsvisionen des Fortschrittsglaubens, so auch den Blick zurück in die Geschichte kultiviert,1 in der Hoffnung, der Gegenwart als einem „System der Unordnung“ (GS 2, 71) entkommen und in einer besseren, weniger unruhigen, weniger konfliktgeladenen und bedrohlichen Welt ankommen zu können. Das Interesse richtete sich vor allem auf Modelle einer stabileren gesellschaftlichen Ordnung, auf Modelle, deren Wiederbelebung dazu verhelfen sollte, dem Fortschritt Zügel anzulegen und ihn auf Menschenmaß zu bringen, ihn nämlich auf das Maß an Veränderung zu reduzieren, das das Gewohnheitstier im Menschen allenfalls noch würde verkraften können. Das ist das zentrale Motiv des Historismus.
Dieser Historismus wurde zu einer Quelle immer neuer Projekte und Moden, wie er überhaupt seinerzeit die tollsten Blüten trieb. Das 19. Jahrhundert liebte das historische Kostüm. Wenn Borsig in Berlin eine neue Fabrik für Lokomotiven baute oder wenn in einer der ständig wachsenden Städte ein neuer Bahnhof errichtet wurde, dann gab man diesen Gebäuden eine Fassade, die bei einem gotischen Dom, einem Palazzo der Renaissance oder einem Lustschloß des Rokoko abgeguckt war. Die Werke des Fortschritts wurden historisch maskiert, damit sie noch irgendwie nach etwas Menschlichem, dem Menschen Gemäßen aussähen. Am deutlichsten zeigt sich dieses eigentümlich zwiespältige Verhältnis zum Fortschritt in der Architektur und der Bildenden Kunst. Da finden sich nebeneinander sämtliche Stile des alten Europa wieder, Romanik und Gotik, Renaissance und Barock, Rokoko und Klassizismus, und womöglich nicht nur nebeneinander, sondern an ein und demselben Objekt. Man denke nur an Gebäude wie den Reichstag in Berlin oder die alten Hauptbahnhöfe der großen Städte. Ein früher Vertreter dieses Historismus war der preußische Staatsbaumeister [<<18] Karl Friedrich Schinkel (1781–1841), ein Architekt, der sich sowohl auf die neuesten, fortschrittlichsten Bautechniken verstand als auch die Kunst beherrschte, einem Gebäude jedes gewünschte historische Kostüm anzumessen.