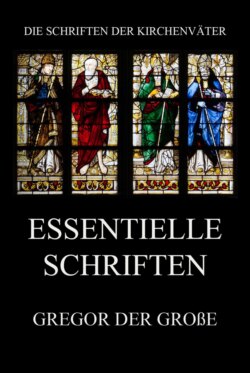Читать книгу Essentielle Schriften - Gregor der Große - Страница 5
Einleitung zu Gregor dem Grossen
ОглавлениеAllgemeine Einleitung
Als Quellen für die Lebensgeschichte des hl. Papstes Gregor des Großen dienen uns vor allem anderen seine Schriften. In vielen, vielen Personen-, Orts- und Zeitangaben bekundet sich uns Gregor als ein seiner Zeit ganz und gar verbundener Mann. Als nächste Quelle gilt Gregors von Tours, † 594 oder 595, Historia Francorum. Es folgen der Liber Pontificalis, dann Isidor von Sevilla, De vir. illustr. 40, und Ildefons von Toledo, De vir. illustr. 1. Ewald entdeckte in St. Gallen eine Biographie Gregors aus der Feder eines Mönches von Whitby in England, wahrscheinlich aus dem Jahre 713 stammend, herausgegeben von Grisar 1887 und von Gasquet 1904. Beda Venerabilis ist der nächste Autor, der uns in seiner 731 vollendeten Kirchengeschichte berichtet. Gegen Ende des Jahrhunderts, 770—780, verfaßt Paulus Diaconus auf Monte Cassino sein Leben des hl. Gregor, 1 dem ein Jahrhundert später Johannes Diaconus, ebenfalls ein Mönch von Monte Cassino, seine ausführliche Vita folgen läßt. 2
1. Rom und Italien in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts
Die Lebensjahre Gregors fallen in eine Zeit tiefen Niederganges, in eine Zeit unübersehbarer Gefahren für das weströmische Reich, für Italien und Rom, ungeheurer Gefahren auch für das Christentum, das mit dem bisherigen Bestand der Dinge unterzugehen drohte.
Nach dem Tode Amalasunthas, der Tochter Theoderichs, begann für das schon schwer heimgesuchte Italien eine lange Reihe schwerster Kriegsjahre. Justinian, der eben das Vandalenreich gestürzt und Nordafrika für Byzanz wiedergewonnen hatte, begann in Italien den Krieg gegen das Reich der Ostgoten. Sein großer Feldherr Belisar eroberte rasch Sizilien und den größten Teil Italiens, 535—540. Justinian legte dem eroberten Lande schwere Steuern auf. Steuereinnehmer, Wucherer und die Besatzung, die von Byzanz unregelmäßig ihren Sold bezog, machten sich Geld auf jede Weise. Eigentum und Leben waren nirgends mehr sicher; die Soldaten waren ja nur zu einem verschwindenden Teil Römer und Griechen, sie stammten vielmehr aus den entferntesten Gegenden des byzantinischen Reiches; es waren Schwarze, Araber, Hunnen, Perser, Gepiden, und diese alle hausten in Italien mit ungezügelten Instinkten und Leidenschaften. Darum verödete das flache Land; die Leute flohen ins Gebirge; aber Hunger und Pest zogen hinter ihnen her, so daß im Picenum allein fünfzigtausend Menschen Hungers starben. 3
Den Goten verblieb noch Pavia. Ungebeugt begannen sie unter Totila den Befreiungskrieg und entrissen den Byzantinern wieder einen großen Teil des Landes. Aber das Kriegsglück schwankte; die Kriegsheere zogen hin und her, bis Narses, verstärkt durch Langobarden und Heruler, 553 den Untergang des Ostgotenreiches besiegelte, das verwüstete Italien zu einer römischen Provinz machte und als Statthalter in den Palast Theoderichs in Ravenna einzog. Aber dem Lande war nur eine kurze Ruhe gegönnt, die nicht hinreichte, um die Wunden des Krieges heilen zu lassen. Denn die arianischen Langobarden, die ihren Fuß schon einmal auf italischen Boden gesetzt hatten, vergaßen das sonnige Land nicht. Sie brachen am Osterdienstag 568 unter ihrem König Alboin von Pannonien auf, um über die julischen Alpen in Italien einzubrechen. Der Schrecken eilte dem Heere voraus. Dem Bischof Redemptus von Ferentino erschien der hl. Märtyrer Eutychius und sagte das Ende allen Fleisches voraus. Man redete von schauerlichen Zeichen, die am Himmel erschienen, und sah feurige Schlachtreihen von Norden her kommen. 4 „Bald wütete“, erzählt Gregor selbst, „das wilde Volk der Langobarden wie ein Schwert, aus der Scheide seiner Wohnstatt gezogen, gegen unsern Nacken, und das Volk, das in unserm Lande wie eine dichte Saat dastand, wurde dahingemäht und verdorrte. Denn die Städte wurden entvölkert, die festen Plätze zerstört, Kirchen niedergebrannt, Männer- und Frauenklöster dem Erdboden gleichgemacht; die Landgüter sind verlassen, und niemand nimmt sich ihrer an; das flache Land liegt brach und ist verödet, kein Besitzer wohnt mehr dort, und wilde Tiere hausen, wo viel Volk einst wohnte.“ 5 Während der Exarch Longinus, des Narses’ Nachfolger, unbegreiflicherweise tatenlos in Ravenna saß, rückten die Langobarden immer weiter vor, nicht ohne auch ritterliche Züge an den Tag zu legen. So empfing Alboin am Piave Felix, Bischof von Treviso, und stellte ihm einen Schutzbrief für seine Kirche aus. Nach und nach wurde ganz Norditalien in Besitz genommen und Pavia 572 nach dreijähriger Belagerung zur Hauptstadt des Langobardenreiches gemacht. Alboin wurde im gleichen Jahre von eigenen Leuten in Verona meuchlings ermordet. Das gleiche Los teilte 574 sein Nachfolger Kleph, unter dem die Langobardenherrschaft weiter nach Süden vorgetragen worden war. Venedig, der Küstenstrich von der Pomündung bis Ankona mit Ravenna, Kalabrien, Neapel und Rom mit ihrer Umgebung verblieben noch dem Kaiser von Byzanz. Auch die Inseln Sizilien, Sardinien und Korsika wurden vorerst noch von den Langobarden verschont, weil sie sich nicht auf die Schiffahrt verstanden. Ihnen sagte der Apennin mehr zu, weil sie sich dort leichter halten konnten, während die schwachen griechischen Besatzungen die festen Plätze in der Ebene besser zu verteidigen wußten.
Da nach Klephs Tode kein König gewählt wurde, sondern ein Interregnum eintrat, schalteten die Herzöge, ungefähr fünfunddreißig an der Zahl, in den eroberten Gebieten nach freiem Belieben. Paulus Diaconus hat uns die Namen von sieben dieser Herzöge und ihrer Residenzen überliefert: Zaban von Pavia, Wallari von Bergamo, Alichis von Brescia, Euin von Trient, Gisulf von Friaul, Faroald von Spoleto und Zotto von Benevent. 6 Die Herrschaftgebiete der übrigen werden sich wohl ungefähr mit einzelnen Bischofsstädten und deren Gebiet gedeckt haben. 7 Jeder von ihnen suchte sein Gebiet zu vergrößern und unternahm weite Eroberungszüge. So erschien Faroald von Spoleto 579 vor den Mauern Ravennas, plünderte die reiche Hafenstadt Classis und ließ dort eine Besatzung zurück. In demselben Jahre belagerten andere Rom; die griechische Besatzung hätte die Stadt nicht zu retten vermocht, wenn nicht der neugewählte Papst Pelagius II. die Feinde zum Abzug bewogen hätte. 8 Zotto von Benevent sodann war es, der 589 das ehrwürdige Kloster Monte Cassino heimsuchte und zerstörte.
Während kleinere Feindesscharen plündernd das Land durchzogen, vollendeten andauernde Regenfälle das Unheil, indem sie eine furchtbare Überschwemmung und ein großes Sterben verursachten, 589.
Was Rom selbst mit dem Lande litt, ist einem langsamen Dahinsiechen vergleichbar. Die große Beherrscherin der Welt, die Stadt schlechthin, hatte im Laufe der letzten Jahrhunderte ein Vorrecht nach dem andern abtreten müssen: zuerst wurden Trier, Mailand und Nikomedien als Residenzen ihr gleichgesetzt; als Byzanz gegründet ward, wurde es ihr als Neu-Rom vorangesetzt. Der Charakter der politischen Weltstadt war dahingesunken, und Rom wäre wohl wie Theben, Babylon und Karthago von der Erde verschwunden, wenn es nicht von einem lebensfähigen Prinzip beseelt gewesen wäre, das ihm von neuem zu der Ehre verhalf, zu herrschen. 9Weder Alarich noch Genserich, weder Ricimer noch Totila scheinen Gebäude zerstört zu haben; sie begnügten sich mit der Wegnahme von Gold und Silber und kostbarem Hausrat, das alles in unglaublicher Menge vorhanden war. Die Stadt barg am Anfang des 5. Jahrhunderts 1790 Paläste und 46 602 Wohnhäuser. 10 So standen also noch die Tempel, die Paläste, die Theater und Fora, dehnte sich noch das Häusermeer aus, als Gregor in die Geschichte eintrat. Wie aber stand es mit der Zahl der Bewohner? Grisar schätzt sie für den Beginn des 5. Jahrhunderts auf ca. 800 000. 11 Schon das ist eine Verminderung gegenüber der glänzenden Kaiserzeit; die Zahl sank aber durch die Kriege noch viel, viel tiefer. Prokopius berichtet zu unserm Erstaunen, daß Rom nach der Einnahme durch Totila 549 noch 500 Einwohner zählte. Wenn dies auch ein bloßer Schreibfehler ist, so muß man doch annehmen, die Einwohnerzahl sei durch die Kriegsläufte, durch Tod und Flucht so gesunken, daß in einer Straße fast alle Häuser bis auf einige wenige leer standen. Öde und Verlassenheit klagte aus den Loggien und Atrien heraus. Das ist der Schauplatz, die nächste und die weitere Umgebung, in der Gregor heranwuchs, der große, heilige und starke Mann.
2. Gregors Jugend
Es ist nicht möglich, nach den bisherigen Quellen das genaue Geburtsdatum Gregors anzugeben; die Geschichtschreiber entscheiden sich für das Jahr 540. 12 Gregor ist ein Sprosse des Senatorengeschlechtes der Anicier, das beim Adel, im Staat und in der Kirche in hohem Ansehen stand und über große Reichtümer verfügte. Der Vater Gregors, Gordianus, besaß auf dem Clivus Scauri, einem Ausläufer des Mons Coelius, einen Palast und ausgedehnte Besitzungen in Sizilien. Er war Regionarius, d. h. Vorsteher eines der sieben Bezirke, in die die Stadt von der Kirche eingeteilt worden war. Die Mutter Gregors, die hl. Silvia, deren Fest am 3. November begangen wird, besaß einen Palast auf dem Aventin in der Nähe von S. Saba. Gregor hatte einen Bruder, den er nicht mit Namen nennt; er war Stadtpräfekt, als Gregor zum Papst gewählt wurde. 13 Gregor erzählt uns auch von drei Schwestern, von denen Tharsilla 14 und Ämiliana 15 als Heilige verehrt werden; Gordiana, die einige Zeit mit den Schwestern zurückgezogen lebte, heiratete später den Verwalter ihrer Güter. Auch einer Tante namens Pateria tut Gregor Erwähnung; sie lebte in ärmlichen Verhältnissen auf Sizilien und wurde von ihm unterstützt. Wir erfahren von einer Anicia Faltonia Proba, daß sie einige Zeit in Karthago unter der Leitung des hl. Augustinus ein klösterliches Leben führte. 16 Auch einen heiligen Papst hatte die gens Anicia der Kirche schon geschenkt, Felix III., der die Kirche von 483—492 regierte.
In die Kinderjahre Gregors fallen ernste Ereignisse: die mehrmalige Belagerung Roms, Hungersnot und die allmählige Verödung der Stadt. Schmerzlich vermissen wir nähere Nachrichten über die wissenschaftliche Ausbildung Gregors. Wir hören nichts mehr von Grammatiker- und Rhetorenschulen. Mit so vielem anderen waren sie in der Ungunst der Zeit verschwunden. 17 Cassiodorus faßte noch den Plan, in Rom eine theologische Hochschule zu gründen, doch der Ausbruch des Gotenkrieges vereitelte das Unternehmen. Wer nur immer von den Lehrern es vermochte, verließ Rom und begab sich nach Byzanz oder Berytus. Wir können und müssen aber annehmen, daß in den adeligen Familien noch eine große Vertrautheit mit klassischen Autoren, vor allem mit Cicero, Vergil, Seneca, Quintilian vererbt wurde. Es konnte wohl für einen Sohn aus adeliger Familie immer noch ein Lehrer gefunden werden; und naheliegend ist es, für einen Sohn aus senatorischem Geschlechte eine juristische Unterweisung anzunehmen. Mit dem Griechischen, dessen Pflege in Rom schon seit längerer Zeit aufgehört hatte, war Gregor nicht vertraut. Dennoch urteilt der Diakon Agiulf über ihn: „Litteris grammatecis dialecticisque ac rhetoricis ita est institutus, ut nulli in urbe ipsa putaretur esse secundus.“ 18
Wenn wir Gregors Schriften nach Zeugnissen seiner Jugendbildung durchsehen, finden wir einen ernsten, melancholischen Zug, der ihn hart über die literarische Bildung urteilen läßt. „Die Weisen dieser Welt“, sagt er, „legen Gewicht auf die Beredsamkeit; ihre Aussprüche haben ein schönes Gesicht, sind aber geschminkt; sie lügen, da ihnen ein wirklicher Inhalt abgeht; sie sind nur eitle Wortbildungen und mit schönen Farben überzogen.“ 19 In dem Begleitbrief zu den Moralia an Bischof Leander verachtet Gregor die infructuosae loquacitatis levitas und schreibt: „Darum wollte ich mich nicht nach der Redeweise, wie sie die weltlichen Rhetoren lehren, richten, meide, wie auch dieser Brief zeigt, weder Metacismen noch Barbarismen und beachte nicht Wortstellung und Rhythmus und den Kasus der Präpositionen; denn ich halte es für ganz und gar unwürdig, daß ich die Worte des himmlischen Orakels unter die Regeln des Donatus beugen soll.“ 20 Wir werden auf diese vielzitierte Stelle weiter unten noch zurückkommen, wenn wir von der Sprache und vom Stil Gregors sprechen müssen; es sei aber schon hier gesagt, daß Gregor mit diesen stark übertreibenden Worten nicht eigentlich die Grammatik an sich verachten will, sondern daß er seiner ernsten Auffassung Ausdruck verleiht; ihm ist die Erfassung des göttlichen Lehrinhalts und dessen deutliche Wiedergabe die Hauptsache, so daß er sich der Arbeit des Feilens und Polierens, des äußeren Aufputzes und des beabsichtigten Glanzes entheben zu müssen glaubt. Mit dieser Anschauung berührt sich die Meinung Stuhlfaths, 21 daß die Ablehnung des ciceronianischen Lateins, das zur Manier geworden war, eine gesunde Reaktion verrät. Die strenge Auffassung, das Erfassen des Kernes einer Sache unter Preisgabe der kunstvollen äußeren Form bildete sich bereits in der Seele des Knaben, da die Beschäftigung mit geistlichen Dingen, vorab mit der Heiligen Schrift und den Vätern, die in der schweren Zeit allein Trost und Halt geben konnten, die Pflege der rein formalen Geistesbildung mehr zurücktreten ließ.
Für das Gemüt des jungen Gregor blieb sicherlich die nähere Umgebung seines elterlichen Hauses nicht ohne Einfluß; sie war ja ganz dazu angetan, die ernste Sinnesrichtung zu fördern. Tiefe Melancholie herrschte ringsum; denn in der Niederung vor dem väterlichen Palaste entstand ein Sumpf, da die Aquädukte durch die Kriege Schaden litten; zur Rechten schaute das Flavische Amphitheater herüber, das zwecklos in die Lüfte ragte; vor ihm lag der Palatin mit den Kaiserpalästen, die, unbewohnt, geplündert und ausgeraubt, einen trostlosen Anblick boten; die Statuen waren umgestürzt und lagen auf dem Boden; niemand pflegte mehr die Garten- und Parkanlagen am Abhang des Palatin; zur Linken lag der Circus Maximus, in dem König Totila 549 die letzten Rennen veranstaltet hatte, verödet da und verwahrlost wie die übrigen Gebäude. Über den Circus Maximus hinweg schweifte der Blick auf den Aventin mit den vereinsamten Thermen des Caracalla; zwischen Palatin und Aventin dehnte sich in der weiten Ebene zu beiden Seiten des Tiber ein ausgestorbenes Häusermeer aus mit seinen leeren Tempeln und Theatern. Das sah der Knabe und Jüngling Tag für Tag; es bietet ihm keinen Reiz, sondern wendet seinen Geist dem Inneren und dem Ewigen zu. Darum sucht er auch den Verkehr mit älteren, erfahrenen, frommen Männern. Er erzählt selbst, daß er von Abt Konstantin von Monte Cassino, der 560 starb, die Lebensgeschichte des hl. Benedikt erfahren habe; auch mit Honoratus, dem Abt von Subiaco, verkehrt er. Wenn man bedenkt, wie anschaulich Gregor in wenigen Strichen die Örtlichkeit von Monte Cassino und Subiaco zeichnet, darf man sich fragen, ob er nicht etwa diese Männer, die zuweilen Gäste in seinem väterlichen Hause waren, in ihren Abteien besucht haben mag. Die unzähligen und treffenden Vergleiche, die er der Schiffahrt entnimmt, lassen endlich vermuten, daß Gregor mit dem Meere wohlvertraut war und wahrscheinlich öfter nach Sizilien gefahren ist, wo des Vaters Besitzungen lagen.
3. Gregor als Stadtpräfekt
Die Biographen gehen schnell über die Jugendjahre Gregors hinweg, ohne uns genaue Angaben zu hinterlassen. Wir sind nur auf Vermutungen und Schlüsse angewiesen, bis uns Gregor selbst ganz nebenbei eine wichtige Bemerkung macht. Er schreibt im Jahre 593 an Bischof Constantius von Mailand, daß er, als er noch Prätor war, eine Erklärung des Bischofs Laurentius im Dreikapitelstreit als Zeuge mitunterzeichnet habe. 22 Laurentius wurde 573 Bischof von Mailand und wird im Zusammenhang mit der Erwählung zum Bischof eine Erklärung darüber, wie er sich zu den drei Kapiteln stelle, abgegeben haben. Gregor bekleidete demnach zu diesem Zeitpunkte ein öffentliches Amt. Aber war dies die Prätur? Augustus hat die große Amtsbefugnis des Prätors an sich gerissen und ließ ihm nur noch untergeordnete Zweige des früheren Amtsbereiches. Später ging das Amt des Prätors auf den praefectus urbi über; er ist der Stellvertreter des Kaisers und im Besitz der höchsten Kriminalgerichtsbarkeit. 23 Wenn Gregor sich wirklich des Ausdrucks praetura bediente, so würde es zu seiner Bescheidenheit passen, daß er eine einfache Bezeichnung seiner Stellung wählte. Es ist aber anzunehmen, daß ein Lese- oder Schreibfehler vorliegt und mit Cod. Vat. B. überhaupt praefecturam gelesen werden muß; werden doch Prätur und Quästur überhaupt nicht mehr genannt. 24 Demgemäß nehmen fast alle neueren Gelehrten, welche das Leben Gregors behandeln, an, daß er Stadtpräfekt war. Justinian wird ihn zu dieser Würde ernannt haben, weil er einer der angesehensten Familien entstammte und neben andern empfehlenden Eigenschaften großen Reichtum besaß. Die Besitzungen der Familie lagen zum großen Teil in Sizilien, das noch dem oströmischen Reiche angehörte, und waren weder verwüstet noch gefährdet. Das aber war ein wichtiges Moment zu einer Zeit, wo bereits viele Senatorenfamilien verarmt waren.
Als Präfekt nahm Gregor die höchste Stelle in Rom ein. Es unterstand ihm die ganze Zivil- und Kriminalgerichtsbarkeit, Verwaltung und Polizei. Mit dem Papste regelte er den Einkauf und die Verteilung des Brotgetreides, mit dem magister militum traf er die Maßnahmen zur Verteidigung der Stadt. So übte sich Gregor in der Verwaltung und Rechtsprechung; so lernte er die soziale Not kennen und Mittel zur Abhilfe suchen.
Aber er fühlte sich nicht glücklich; während er im prächtigen Amtskleid durch die Stadt ritt und von dem Volke geehrt wurde, beschäftigte ihn der Gedanke, allem zu entsagen und sich von der Welt zurückzuziehen. Paulinus von Nola und Benedikt hatten es vor ihm getan; Cassiodor hat sich um 540 auf seine Besitzungen in Unteritalien zurückgezogen und das Kloster Vivarium gegründet; der Patrizier Liberius gründete ein Kloster in Kampanien. 25 Nach dem Tode seines Vaters Gordianus führte Gregor seinen Plan aus. Er scheint sich mit seiner Mutter Silvia dahin verständigt zu haben, daß sie in dem Palast auf dem Aventin, der ihr persönliches Eigentum war, Wohnung nahm, während er das väterliche Besitztum zu frommen Zwecken verwendete. Er gründete auf Sizilien sechs Klöster und verteilte an sie die dortigen Besitzungen; auch das väterliche Haus wandelte er in ein Kloster um und stattete es hinlänglich mit Gütern aus; den Rest verkaufte er, um den Erlös den Armen zu geben. Als alles das geregelt war, trat er selbst in das Kloster St. Andreas, das Kloster seines eigenen Hauses, ein, um das Jahr 574 oder 575. Auf diese Weise wollte er der Welt mit ihren Sorgen entfliehen, aber er sollte bald wieder zu ihr zurückkehren; der Schmerz darüber hat ihn niemals verlassen. Gregor läßt später seinen Freund, Bischof Leander, einen Blick in sein damaliges Seelenleben werfen, wenn er an ihn schreibt: „Es war mir schon klar, was ich bei der ewigen Liebe suchen müsse, aber die Gewohnheit ließ es nicht zu, meinen äußeren Beruf zu ändern. Während ich mich so zwang, der Welt noch dem äußeren Scheine nach zu dienen, gewannen die Verhältnisse mitten unter den weltlichen Sorgen allmählich eine solche Macht, daß ich nicht mehr bloß dem Scheine nach, sondern, was schon schwerer wiegt, auch der Seele nach in der Welt zurückgehalten wurde. Dem allem entfloh ich endlich und suchte den Port des Klosters auf, ließ alles, wie ich damals freilich irrig annahm, was der Welt gehörte, zurück und entging nackend und bloß dem Schiffbruch dieses Lebens.“ 26
4. Gregor als Mönch
Das Kloster auf dem Clivus Scauri wurde dem hl. Andreas geweiht. Die Ordensregel war die des hl. Benedictus. Der rege Verkehr Gregors mit Monte Cassino, mit Subiaco und mit Valentinian, dem Abte des lateranensischen Klosters, sowie seine unverkennbare Zuneigung zu Benedictus lassen es als sicher annehmen, daß Gregor die Regel des hl. Benedikt, den unvergleichlichen Ausdruck der Weltabgeschiedenheit, der Seelenruhe und der völligen Hingabe an Gott, befolgen wollte. 27 Die Verbindung, die Gregor so mit dem Orden einging, ist für ihn von größter Bedeutung geworden. Denn wie er im II. Buch der Dialoge der große Lobredner Benedikts wurde und den Geist Benedikts in der päpstlichen Tätigkeit entfaltete, so wurden die Klöster des hl. Benedikt die Träger der gregorianischen Tradition und die Verkündiger der Größe Gregors.
Gregor war nun einfacher Mönch in seinem früheren Palaste. Immer wieder sagt er später, daß die ersten stillen Jahre im Kloster, wo er sich ganz der Betrachtung, dem Studium der Hl. Schrift und der Väter widmen konnte, seine schönsten Jahre gewesen seien, und erzählt gern von den Brüdern, mit denen er damals zusammen lebte. Er war aber in diesen Jahren zu strenge mit sich selbst. Die Mutter sandte ihm zwar täglich in silberner Schüssel ein Gemüsegericht, und es ist nicht anzunehmen, daß dies seine einzige Nahrung war; aber er übte, wie uns die Biographen einstimmig berichten, ein so strenges Fasten, daß sich ein Magenleiden einstellte, das ihm viele Beschwerden verursachte und ihn nie mehr verließ. Vielleicht hat er auch damals schon durch Erkältungen den Grund zu einer andern schmerzlichen Krankheit, der Gicht, gelegt, über die er sich später oft beklagen muß.
Während dieser ersten Jahre des Klosterlebens war es, daß Gregor, wie uns Johannes Diaconus erzählte, einmal auf dem Sklavenmarkte englische Gefangene sah und so von Mitleid erfüllt wurde, daß er den Entschluß faßte, dieses Volk mit dem Evangelium bekannt zu machen. Er soll sein Anliegen Papst Benedikt (574—579) vorgetragen und sich entschlossen haben, selbst nach England zu gehen, da kein Missionar sich fand. Ungern habe ihn Klerus und Volk ziehen lassen; bald aber sei eine so große Unzufriedenheit wegen seines Wegganges entstanden, daß eine Abordnung Gregor nachreiste und ihn zurückholte. Ließe sich aus diesem Vorkommnis schließen, daß das Volk noch immer an dem ehemaligen Stadtpräfekten hing, so erhellt aus einer bestimmten Tatsache, welches Vertrauen ihm Papst Benedikt schenkte. Er übertrug ihm nämlich das eben erledigte Amt eines der sieben Diakone. Der Diakon aber hatte für das Wohl der ihm anvertrauten Region zu sorgen. Während die Römer sich freuten, daß Gregor auf diese Weise gleichsam wieder zu ihnen zurückkehrte, folgte dieser nur ungern dem päpstlichen Wunsche, der ihn den weltlichen Sorgen zurückgab. 28 Unerwartet schnell starb Papst Benedikt 579. Sein Nachfolger Pelagius II. erteilte Gregor die Diakonatsweihe und ernannte ihn sofort zu seinem ständigen Gesandten oder Apokrisiar beim oströmischen Kaiserhofe.
Gregor reiste, wahrscheinlich die sehr belebte Via Egnatia benützend, über Durazzo durch Epirus und Mazedonien nach Konstantinopel. Er war dabei von einer größeren Anzahl von Mönchen begleitet, und mit ihnen führte Gregor in der Hauptstadt das klösterliche Leben fort. Er konnte, sagt er, zu ihnen von den Stürmen und Wogen der weltlichen Geschäfte immer wieder wie zu einem ruhigen Gestade heimkehren und die Seele gleichsam vor Anker legen. 29 Von den Aufgaben, die Gregor am Hofe zu lösen hatte, wissen wir nur wenig; denn er hat selbst nicht viel davon erzählt, und der Briefwechsel zwischen dem Papst Pelagius und ihm ist verlorengegangen. Johannes Diaconus sagt noch, daß er im päpstlichen Archiv aufbewahrt werde, und führt zum Beweis der umfassenden Geschäftsführung Gregors einen Brief des Papstes an ihn an. 30 Die Lage des Reiches war damals gespannt. Kaiser Tiberius II. (578 bis 582) wurde vom Papste um Hilfe für Rom und Italien angegangen; aber der Kaiser vermochte trotz seines Wohlwollens keine Hilfe zu schicken, da seine Kräfte kaum hinreichten, um gegen die Perser, die unter Chosroes II. das Reich wieder ernstlich bedrohten, standzuhalten. Ihrem Andrange gelang es auch wirklich, wenige Jahrzehnte später Syrien, Kleinasien und Ägypten an sich zu reißen, Tiberius konnte nicht einmal seinem Exarchen in Ravenna beispringen, geschweige denn Rom. So rief denn der Kaiser die Franken gegen die Langobarden zu Hilfe; aber der Erfolg war, daß das Langobardenvolk sich wieder einigte; hatten während des Interregnums die Herzöge nach ihrem eigenen Willen und ohne Geschlossenheit regiert, so verlangte jetzt das Volk nach einem Könige und wählte dazu Authari, 585, der sogleich Ravenna bedrohte. Unter all den Verhandlungen, die in dieser Zeit zwischen Rom und Konstantinopel gepflogen wurden, mag Gregor die Überzeugung gewonnen haben, daß von Byzanz keine Hilfe für Italien zu erwarten sei und daß Italien selbst auf seine Rettung bedacht sein müsse. Insofern sind diese Verhandlungen für Gregors spätere Tätigkeit bedeutungsvoll geworden.
Gern zog sich Gregor von dem prunkvollen und ränkesüchtigen Hof zu seinen Mitbrüdern zurück. Dort sah er oft einen Mann, der mit ihm gleicher Gesinnung war und den ebenfalls Staatsgeschäfte nach Byzanz geführt hatten, nämlich Bischof Leander von Sevilla, der beim Hofe die Sache des zum katholischen Glauben übergetretenen Königssohns Hermenegild vertrat. Leander ersuchte Gregor, dem Kreise der ernsten Männer das Buch Job in Konferenzen zu erklären. So entstanden die 35 Bücher über das Buch Job oder die Moralia. Endlich, 585 oder 586, wurde Gregor zurückberufen und durfte wieder sein Kloster St. Andreas beziehen. Dort vollendete er die Moralia und hielt vor den Mitbrüdern Vorträge über den Pentateuch, das Buch Josue, das Buch der Richter, die Bücher der Könige, über die Propheten, über die Sprüche und das Hohelied, schrieb jedoch die Erklärungen nicht selbst nieder; ein Schüler namens Claudius machte wohl Notizen; diese fanden aber so wenig das Gefallen Gregors, daß sie nicht weiter verwendet wurden und verlorengingen.
Ob Gregor nach seiner Rückkehr von Konstantinopel Abt seines Klosters wurde, ist fraglich. Dem ersten Abte Valentio folgte Maximianus, der Gregor auch in Konstantinopel besuchte und der bis zu seiner Ernennung zum Bischof von Syrakus im Jahre 591 Abt gewesen sein muß; denn gegen Ende 590 wird in einer Urkunde für das Kloster St. Andreas Maximus oder Maximianus als Abt des Klosters genannt. 31 Papst Pelagius ernannte Gregor zu seinem Sekretär und bediente sich seiner als eines erfahrenen Ratgebers.
5. Gregor als Papst
Das Jahr 589 war ein Schreckens- und Unglücksjahr für das Reich und für Rom. Im Osten wurde das kaiserliche Heer von den Persern geschlagen. Slaven drangen in Thrazien ein, Antiochien wurde durch ein Erdbeben großenteils in Trümmer gelegt, wobei 60 000 Menschen den Tod fanden. In Italien wüteten unerhörte Regengüsse und verursachten Überschwemmungen. Die Etsch überflutete das Ufer so hoch, daß die Kirche von St. Zeno in Verona bis zum Dache unter Wasser stand. In Rom verließ der Tiber sein Bett und bedeckte das Marsfeld; zahlreiche Gebäude fielen den Fluten zum Opfer, besonders die Kornspeicher, die dem Ufer entlang standen. Zu alledem kam von Ägypten her die Beulenpest und forderte in den ohnehin schwer heimgesuchten Gegenden viele Opfer. In Rom war es nicht mehr möglich, die Toten zu beerdigen; Nacht für Nacht führte man sie wagenweise vor die Stadt und lud sie vor den Mauern ab. Unter diesem Elend wurde auch Papst Pelagius von der Krankheit ergriffen und starb am 8. Februar 590. Klerus und Volk wählten Gregor zu seinem Nachfolger. Dieser aber schrak vor dem Amte zurück und schrieb an den Kaiser, der die Wahl zu bestätigen hatte, er solle seine Zustimmung versagen. Der Stadtpräfekt Germanus hielt jedoch den Brief ohne Wissen Gregors zurück und sandte das Wahldokument zur Bestätigung nach Konstantinopel. Unterdessen versah Gregor mit dem Archipresbyter, dem Archidiakon und dem Primicerius notariorum die notwendigen Geschäfte des päpstlichen Stuhles. Da die Pest noch immer wütete, hielt Gregor in der Laterankirche eine Predigt, um das Volk zur Buße zu ermahnen, und ordnete eine große, siebenfache Bittprozession an, wie der Diakon Agilulf von Tours, der damals in Rom weilte, an seinen Bischof Gregor berichtete. 32 Am frühen Morgen des 25. April zogen sieben Prozessionen, nach Ständen getrennt, von sieben Kirchen aus nach S. Maria Maggiore auf den Esquilin, um von Gott die Abwendung der Geißel zu erflehen. Die Legende erzählt als äußeres Zeichen der Erhörung, daß man während des Bittganges nach St. Peter sah, wie über dem Grabmal Hadrians der hl. Erzengel Michael sein flammendes Schwert in die Scheide steckte. 33
Während die Pest nach und nach erlosch, wartete Gregor auf die Antwort aus Konstantinopel. Gegen Ende des Monats August traf die Bestätigung der Wahl ein. Gregor war förmlich bestürzt und dachte daran, sich der Papstweihe durch die Flucht zu entziehen. Gregor von Tours berichtet, daß Gregor während der Vorbereitung zur Flucht überrascht und nach St. Peter geführt worden sei. 34 Gregor selbst sagt in dem Begleitbrief zur Pastoralregel: „Pastoralis curae me pondera fugere delitescendo voluisse, benigna, frater carissime, atque humili intentione reprehendis. 35 Gregor gab das Widerstreben auf und wurde am 3. September 590 zum Papste konsekriert. Er habe, schreibt er gleich darauf an den Patriarchen Johannes von Konstantinopel, als ein unwürdiger und kranker Mann die Leitung des alten und stark beschädigten Schiffes übernehmen müssen. 36
Wie aber nun Gregor regierte, erregt unser Staunen und unsere Bewunderung. Er entfaltete eine Tatkraft, die an alle Bedürfnisse und Bedrängnisse der Zeit herantrat, sich aller Not annehmend, nur immer helfen und retten wollte, die alles überschaute und mit zähester Energie zu beeinflussen verstand; er war ein klarer, juristisch denkender Mann, der schnell und immer die geeigneten Wege zeigte und der die Gewohnheit besaß, die Gedanken und Entschlüsse sofort niederzuschreiben oder zu diktieren. Er blieb, als er in den Lateranpalast übersiedelte, der einfache Mönch und wollte hier, wie in Konstantinopel, das klösterliche Leben weiterführen. Er schaffte darum die weltliche Dienerschaft ab und umgab sich mit Klerikern und Brüdern. Zu seiner nächsten Umgebung zählten der Diakon Petrus, der Notar und Stenograph Aemilianus, der Defensor oder rechtskundige Verwalter Johannes, Maximianus, Bischof von Syrakus, Augustinus, Prior von St. Andreas, und unter anderen noch Claudius, nachmals Abt in Classis.
Wenn eine gedrängte Übersicht über die päpstliche Wirksamkeit Gregors gegeben werden soll, so ist wegen der vielfältigen und verschiedensten Angelegenheiten, die nebeneinander den Geist Gregors beschäftigten, eine chronologische Aufzählung weder möglich noch statthaft; darum sollen die einzelnen Gebiete für sich kurz zusammengefaßt werden.
a. Das Verhältnis zwischen dem päpstlichen Stuhl und dem Langobardenreich
Gregor war erfüllt von großem Unwillen gegen die Langobarden, weil sie ohne Unterlaß das Land beunruhigten, bald da, bald dort plündernd einfielen, mit Tod und Feuersbrunst das Volk heimsuchten. Dazu kam, daß sie Arianer waren und Rom mehr und mehr bedrohten. König Agilulf stand in Verbindung mit den süditalischen Langobarden, die von Benevent und von Spoleto her Rom einzukreisen drohten. Während so die Lage Roms immer gefahrvoller wurde, war von Ravenna keine Hilfe zu erlangen; denn der Exarch Romanus besaß kaum Macht genug, Ravenna zu halten. So mußte der Papst für sich allein auf den Schutz von Rom bedacht sein. Er suchte mit Herzog Ariulf von Spoleto, der Rom belagerte, Frieden zu schließen, fand aber unerklärlichen Widerstand beim Exarchen, der die Verhandlungen nicht bestätigte. Auch mit den tuscischen Langobarden konnte ein Friede wegen des Widerstrebens des Exarchen nicht zustandekommen. König Agilulf ging über den Po, rückte nach Süden bis gegen Rom vor und schickte sich an, die Stadt zu belagern, 593. Damals hielt Gregor die Homilien über Ezechiel. In der 6. Homilie des II. Buches bricht sein Schmerz in laute Klagen aus. „Was gibt es noch, frage ich, das einen auf dieser Welt freuen könnte? Überall sehen wir Trauer, von überall her hören wir Wehklagen. Verwüstet sind die Städte, die Schlösser zerstört; das Land ist entvölkert, verödet unsere Heimat. Kein Bauer ist mehr auf dem Felde, kaum mehr ein Einwohner in der Stadt; und dem kleinen Rest, der noch übrig ist, werden täglich neue Wunden geschlagen. Wo ist der Senat? Wo das Volk?“ 37 Gregorovius nennt diese erschütternde Homilie die Leichenrede am Grabe des alten Rom. 38 Damals soll es Gregor gelungen sein, König Agilulf durch die Macht seiner Persönlichkeit und durch sein Bitten zum Abzug zu bewegen. 39 Agilulf kehrte nach Mailand zurück. Gregor schloß mit ihm einen Waffenstillstand, aber wiederum versagte der Exarch seine Einwilligung. So dauerte der Krieg fort und griff nach Sardinien über. Unterdessen starb Romanus; sein Nachfolger Kallinicus schlug eine andere Politik ein und schloß 598 einen Waffenstillstand mit Agilulf. Gerührt dankt Gregor dem König und seiner Gemahlin Theodelinde, die sich besonders um den Frieden bemüht hatte. Die ruhige Zeit dauerte bis 601, wo der Krieg in der Lombardei neuerdings aufflammte; aber noch in einem seiner letzten Briefe kann Gregor, schon den Tod vor Augen — in summo vitae periculo atque discrimine — dem König durch Theodelinde für Wiederherstellung des Friedens danken; voll Freude schickt er für den königlichen Prinzen Adaloald, der katholisch getauft wurde, einen Kreuzpartikel und ein Evangelienbuch in kostbarem Umschlag und für die Prinzessin drei Ringe. 40 So war dem Papste noch vor seinem Lebensende ein glücklicher Erfolg der unablässigen Friedensbemühungen beschieden. 41
b. Das Verhältnis zwischen Kaisertum und Papsttum
Aus dem Gesagten geht hervor, daß damals die politische Macht Konstantinopels in Italien gering war. Je mehr sie zurücktrat, desto mehr wuchs der Einfluß des Papsttums in Rom. Als Diokletian und nach ihm Konstantin den Herrschersitz des großen Reiches nach Byzanz verlegten, als Italien nach den Ostgotenkämpfen eine Provinz Ostroms und Ravenna der Sitz des Exarchen geworden war, wird in dem freien Raum um Rom naturnotwendig eine neue Macht emporgetragen, ein neues geistig-religiöses Kaisertum. Solange die beiden Reiche dann nebeneinander bestehen, greifen sie verschiedentlich ineinander über. Der oströmische Kaiser ist der große weltliche Gesetzgeber; er beruft auch Konzilien, erläßt kirchliche Edikte, verdammt Häresien; seine Person und seine Regierung gelten als heilig. Anderseits werden dem Papste und den Bischöfen Italiens von Justinian 554 viele Befugnisse weltlicher Art übertragen: Der Papst wird neben dem Senate mit der Kontrolle der Maße und Gewichte betraut; die Bischöfe wählen gemeinsam mit den angesehensten Grundbesitzern die Statthalter der Provinzen; sie können in die Amtsbefugnisse, besonders in die richterliche Gewalt des Statthalters eingreifen. Dadurch gelangte der Papst, dem die Bischöfe unterstanden, zu großem weltlichen Einfluß. 42
Gregor bringt nie Kirche und Staat in Gegensatz zueinander, sondern immer nur die Kirche Gottes und die sündige Welt; von dieser gehen die Übergriffe aus, wenn solche bei den staatlichen Beamten oder bei den Bischöfen zutage treten. Gregor wacht gewissenhaft und peinlich darüber, daß sie vermieden werden, und hält mit Verweisen nicht zurück, wie seine Briefe bekunden; das gilt auch dem Kaiser Mauritius (582—600) gegenüber. Die Briefe des Papstes an ihn sind äußerst respektvoll gehalten; wo er es aber als seine Pflicht erkennt, so in der Angelegenheit des Exarchen Romanus oder des Patriarchen Johannes Jejunator, schlägt Gregor einen sehr strengen und ernsten Ton an.
Das Ansehen des Papstes und sein Einfluß waren auch deswegen so groß, weil er durch die Mehrung der Güter des apostolischen Stuhles einer der größten, wenn nicht der größte Grundbesitzer in Italien war. Die Kirche besaß schon vor Konstantin kleinere Liegenschaften, die allerdings in der Verfolgungszeit oft gefährdet waren. 321 gab Konstantin der Kirche das Recht, Güter zu erben, und beschenkte sie selbst. Reiche Adelsfamilien ahmten ihm nach. Bald auch ließen die traurigen Verhältnisse den Besitz von Landgütern nicht mehr so wie früher begehrenswert erscheinen. Deshalb verschenkten manche ihre Güter. Auf diese Weise gelangte der päpstliche Stuhl zu großen Besitztümern in Kampanien, Tuscien, Unter- und Oberitalien, auf Sizilien, Korsika, Sardinien, in Dalmatien und Afrika. 43 Mit staunenswerter Vielseitigkeit überwacht und leitet Gregor die Verwaltung dieser Güter, wie uns seine Briefe zeigen. 44 Er legt großes Gewicht auf regelmäßige Abrechnung, auf gerechte Behandlung der Pächter und besonders auf die Verwendung der Einkünfte. Den Armen, der hungernden Bevölkerung Roms, den Klöstern, Armenhäusern, Spitälern und kirchlichen Gebäuden sollten die Erträgnisse an Getreide, Öl, Wein, Wolle und Bauholz vor allem zugute kommen. So wurde die römische Kirche in dieser Zeit zu einem Kornspeicher, der allen offen stand, der Papst selber aber der Hausvater Christi 45 und der große Wohltäter der Armen. „Mit tausend Augen überschaut er wie ein Argus die ganze Welt“ 46 und erfährt auf vielerlei Wegen, wo irgendeine Not der Abhilfe bedarf. Unzählige Stellen der Briefe sagen uns, mit welcher Entschiedenheit, aber auch mit welcher Freigebigkeit und Feinsinnigkeit er vorging. Nur zwei Stellen seien angeführt. An Subdiakon Anthemius schreibt er 591: „Als Du von mir Abschied nahmst, und dann noch bei anderer Gelegenheit habe ich Dir aufgetragen, Dich der Armen anzunehmen und es mir mitzuteilen, wenn Du irgendwo Not wahrnimmst. Das hast Du nur in wenigen Fällen getan. Ich will aber, daß Du der Frau Pateria, meiner Tante, unverzüglich nach Empfang dieses Auftrages zum Unterhalt ihres Gesindes 40 Dukaten und 400 Scheffel Weizen anweisest, der Frau Palatina, der Witwe des Urbicus, 20 Dukaten und 300 Scheffel Weizen, und Frau Viviana, der Witwe des Felix, ebenfalls 20 Dukaten und 300 Scheffel Weizen. Die 80 Dukaten sind in die Rechnung einzusetzen.“ 47 Diakon Cyprian erhält 595 die Anweisung: „Mein Mitbruder, Bischof Zeno, benachrichtigt mich, daß die Leute in seiner Stadt Mangel leiden. Da ich ihnen helfen will, trage ich Dir auf, dem genannten Mitbruder und Bischof 1000 Scheffel Weizen oder, wenn er mehr abführen kann, bis zu 2000 Scheffel anzuweisen. Tu das sofort ohne Verzögerung.“ 48
Das waren in knappen Zügen die weltlichen, politischen und sozialen Verhältnisse, mit denen sich Gregor während seines ganzen Pontifikates befassen mußte. Es ist selbstverständlich, daß ein Mann von so festem Willen und von solcher Gewissenhaftigkeit den inneren Fragen der Kirche erst recht seine Sorgfalt zuwandte.
c. Gregor als Seelenhirte
Schon im Synodalschreiben, das er im Februar 591 an die Patriarchen von Konstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerusalem und an den Expatriarchen von Antiochien richtet, entwirft er das Bild des Hirten, das er trotz seiner Schwäche verwirklichen will. Der wahre Führer der Gläubigen muß rein sein und in der Tätigkeit den andern ein Vorbild; er muß zu schweigen verstehen und reden können; er muß mit allen mitfühlen, muß der Betrachtung ergeben sein, muß sein ein demütiger Genosse der Guten, sich aber in gerechtem Eifer gegen das Böse stellen. 49 Ausführlicher noch zeichnet er den wahren Hirten in der Pastoralregel, die er um dieselbe Zeit verfaßte. So legte Gregor in den ersten Monaten seiner Regierung das Programm für seine Hirtentätigkeit fest und führte es nachher unverbrüchlich durch.
Er begann bei sich und beim päpstlichen Hofe, indem er die Laiendienerschaft aufhob und sich nur mit Mönchen und Klerikern umgab. Er schreitet ein gegen Priester, deren Wandel nicht rein ist; er achtet darauf, daß die rechten Männer zu Bischöfen gewählt werden, und steht nicht an, einem ungeeigneten die Bestätigung zu versagen. 50 Strenge wacht er über die Amtsführung der Bischöfe, tadelt und mahnt, wenn er ungünstige Berichte über sie bestätigt findet. Im Juli 595 hielt er in Rom eine Synode, an der 23 Bischöfe aus der Umgegend, auch aus der Lombardei, und 35 Priester der Titularkirchen teilnahmen. Damals war es dem Papst vor allem um Hebung der Ordnung und Disziplin zu tun. Damit bei der Zulassung zur Weihe nicht so sehr auf eine schöne Stimme als auf einen reinen Wandel gesehen werde, ordnete die Synode an, daß der Diakon von nun an nur mehr das Evangelium zu singen habe. Für Erteilung der Weihen und für Überbringung des Palliums darf kein Entgelt erhoben werden. Der Papst tadelt, daß manche Hirten in Fällen, wo es zweifelhaft ist, ob ein Besitztum der Kirche oder Laien gehört, zu rigoros sind. Den Sklaven auf den kirchlichen Besitzungen soll es möglich sein, in ein Kloster einzutreten; sie müssen aber vorher im Laiengewand eine Probezeit durchmachen, damit der Eintritt ins Kloster nicht etwa bloß deswegen geschehe, daß sie aus dem Sklavenstande herauskommen.
Ein Hauptaugenmerk richtete Gregor auch auf die Reinhaltung und Hebung der Klosterzucht. Als Stätten der Ruhe, Zurückgezogenheit, des Gebetes und der stillen Händearbeit sollten die Klöster ihren Insassen behilflich sein, in Demut, Liebe und Gehorsam die Vereinigung mit Gott in dieser und der andern Welt zu suchen. Die damaligen verworrenen öffentlichen Zustände sind wohl auch schuld, daß einzelne schwere Übertretungen der Ordensregel vorkamen. Die eingehende und strenge Behandlung solcher Fälle zeigt, wie hoch Gregor die Ordenszucht schätzte und wie sehr ihn ihre Verletzung schmerzte. Daneben ist er in rührender Weise für das leibliche Wohl der Ordensangehörigen besorgt, läßt den Klöstern, die wegen der Zeitverhältnisse darben müssen, die Abgaben nach und unterstützt sie mit Geld, Nahrungsmitteln und Kleidern.
Aber auch dem einfachen Volke galt seine Hirtensorge. Er besuchte die Kirchen, in denen der feierliche Gottesdienst stattfand — die Stationskirchen im weiteren Sinne —, und legte das Evangelium aus, nachdem es vom Diakon feierlich gesungen worden war. In Scharen begleitete ihn das Volk zu der Stationskirche und umstand seinen Sitz. Er saß dabei wohl vor dem Altare. Zwanzig Homilien hielt er in dieser Weise; als aber sein Magenleiden heftiger wurde und er nicht mehr öffentlich sprechen konnte, diktierte er zwanzig weitere Homilien seinem Notar Aemilian und ließ sie durch ihn beim Gottesdienst verlesen.
d. Der Dreikapitelstreit
Mit Schmerzen sah Gregor, daß Bischöfe und Volk Illyriens und der östlichen Lombardei am Dreikapitelstreit festhielten und sich Rom nicht anschlossen. Papst Vigilius war nämlich 554, entgegen seiner früheren Stellungnahme, dem Beschlusse des 5. allgemeinen Konzils, das die drei Kapitel verurteilte, beigetreten. Die illyrischen Bischöfe sahen darin einen Angriff auf das Konzil von Chalzedon zugunsten der Monophysiten und schlossen sich dem Papste nicht an. Gregor, der sich schon unter seinem Vorgänger Pelagius eingehend mit der Frage befaßt hatte, suchte die Einheit wieder herzustellen und wandte sich 591 an Kaiser Mauritius um seine Mithilfe; aber gerade dieser Schritt bestärkte die Bischöfe in ihrem Widerstande. Alle, Severus von Aquileja und seine Suffragane, sowohl jene, die zum Exarchat gehörten, als jene des Langobardenreichs wandten sich gegen den Papst. Erst dem unablässigen Bemühen Gregors im brieflichen Verkehr gelang es, die Getrennten nach und nach zur Einheit mit Rom zurückzuführen oder ihnen die Rückkehr zu erleichtern. Ganz erlosch das Schisma erst etwa hundert Jahre später.
e. Die Katholiken unter der Herrschaft der arianischen Langobarden
Oft beklagt sich Gregor über die Langobarden, die in der Irrlehre des Arius verharrten und die Anhänger der katholischen Kirche mehr oder weniger verfolgten und sie in ihrem Glaubensleben beengten. So verbot König Authari, daß an Ostern die Taufe gespendet werde; 51 Bischöfe und Priester mußten fliehen; starb ein Bischof, wurde der bischöfliche Stuhl nicht mehr besetzt; Kirchen und Klöster wurden zerstört, Gregor beauftragt die Bischöfe, die noch vorhanden sind, sich um die verwaisten Diözesen anzunehmen und Priester hinzusenden; unter Umständen sollen die Diözesen zusammengelegt werden. Als der Friede endlich hergestellt war, schickte Gregor an König Agilulf einen Dankesbrief und sagte darin, wenn es nicht zum Frieden gekommen wäre, hätte das arme Landvolk, dessen Arbeit doch beiden Parteien zustatten komme, noch weiter bluten müssen. 52 Er dankt auch der Königin Theodelinde für ihr Bemühen um den Frieden und bittet sie, auf den König einzuwirken, daß er freundlicher gegen die Katholiken gesinnt werde. 53 Dieser großen katholischen Frau gebührt auch das Hauptverdienst an der allmählichen Katholisierung der arianischen Langobarden. Sie war die Tochter des Bayernherzogs Garibald I, und wurde die Gemahlin des Königs Authari. Nach dessen Tode heiratete sie den Herzog von Turin, Agilulf, der dann der Nachfolger Autharis auf dem Königsthrone wurde.
f. Die Bemühungen um die Kirche im Frankenreiche
Das Reich der Franken war zur Zeit Gregors von inneren Zerwürfnissen, Blut- und Greueltaten zerrissen. Bei den Bischöfen herrschte Simonie, der Klerus sündigte durch unerlaubten Umgang mit Frauenspersonen. Da die Tätigkeit des irischen Missionärs Columban nur wenig fruchtete, ernannte Gregor 595 den Bischof Virgilius von Arles zu seinem Legaten für Austrasien und beauftragte ihn, eine Synode einzuberufen und die Übelstände zu bekämpfen. In gleichem Sinne schrieb Gregor auch an König Childebert II. von Austrasien in Metz und an die Bischöfe Austrasiens. 54 Da die Synode nicht zustande kam, sandte Gregor 599 den Abt seines Klosters, Cyriacus, der ihm schon auf Sardinien wichtige Dienste geleistet hatte, zu Bischof Syagrius von Autun mit dem strengen Auftrage, die Synode durchzuführen 55 und jährliche Versammlungen mit den Priestern abzuhalten. 56 Auch an die Königinwitwe und Regentin Brunehild und deren Enkel, den König Theudebert von Austrasien, und an König Theoderich von Burgund wandte sich der Papst, um die Synode zustande zu bringen. 57
g. Die Bekehrung Englands
Ein großer Erfolg war Gregor in England beschieden. Dort waren die christlichen Briten von den angelsächsischen Eroberern, die sich in dem südöstlichen Teile der Insel festsetzten, nach Westen zurückgedrängt worden. Die Briten unternahmen nichts, um die noch heidnischen Eroberer dem Christentum zuzuführen, ebenso nicht die benachbarten gallischen Bischöfe. Da ging Gregor unter König Ethelbert von Kent an das Missionswerk. „Unter all seinen Bürden und Bedrängnissen scheint der Papst nie die jungen englischen Sklaven vergessen zu haben, die er einmal auf dem Forum zum Verkaufe ausgestellt sah.“ 58 595 erhält der Presbyter Candidus bei seiner Abreise nach Gallien den Auftrag, dort englische Sklaven im Alter von 17 bis 18 Jahren loszukaufen und sie zu klösterlicher Ausbildung nach Rom zu senden; 59 zweifellos, meint Dudden, 60 um sie später als Missionäre nach England zurückzusenden. Diese Art der Missionierung erschien Gregor aber bald als zu langsam. Darum gab er schon im folgenden Winter Mönchen aus seinem St. Andreas-Kloster den Auftrag, sich unter der Leitung des Augustinus über Gallien nach England zu begeben. Die Missionäre machten sich auf den Weg, schraken aber mehr und mehr vor der Schwierigkeit der Aufgabe zurück und sandten Augustin nach Rom mit der Bitte, Gregor möge ihnen den Auftrag abnehmen. Dieser aber blieb bei seinem Vorhaben, ernannte Augustin zum Abt der Mönche und schickte ihn mit Begleitschreiben an gallische Bischöfe und an die Könige Theudebert und Theoderich nach dem Frankenreiche zurück. Von da aus gingen dann die Missionäre nach England. Durch die Mitwirkung der Königin Bertha von Kent gelang das Missionswerk so glänzend, daß Gregor in unverkennbarer freudiger Erregung etwa im August 598 an Bischof Eulogius von Alexandrien schreiben konnte: „Da Du Dich bei Deinen guten Werken auch über andere freust, will ich Dir etwas von mir berichten. Das Volk der Angeln, das an einer Weltenecke draußen wohnt, verehrte bisher noch Bäume und Steine. Unterstützt durch Dein Gebet, habe ich nach Gottes Willen zu ihnen einen Mönch aus meinem Kloster zur Glaubenspredigt geschickt. Mit meiner Erlaubnis wurde er von germanischen 61 Bischöfen zum Bischof geweiht und reiste, gestärkt durch ihre ermunternden Worte, zu jenem Volke ans Ende der Welt. Und jetzt ist die Nachricht bei mir eingetroffen, daß er und seine Begleiter beim Volke durch so viele Wunder glänzen, daß sie die Apostel in ihren Wundern nachzuahmen scheinen. Am letzten Weihnachtsfeste sind, wie er meldet, mehr als 10 000 Angeln von ihm und seinen Begleitern getauft worden.“ 62 Dieselbe Freude spricht aus einem Briefe vom Herbst 600 an Augustinus: „Wer vermöchte die Freude zu schildern, die hier alle Gläubigen erfüllt hat, weil das Volk der Angeln durch Gottes Gnadenhilfe und Deine Mitarbeit vom Lichte des Glaubens durchdrungen wurde!“ 63 Der Papst gibt schließlich den Missionären in weiteren Brieten ausführliche Pastoralanweisungen, die zum großen Teil in das allgemeine Kirchenrecht übergingen, und errichtete in Kent die kirchliche Hierarchie, Augustinus wurde 604 Primas von Canterbury. Allerdings erfuhr das Missionswerk noch viele harte Rückschläge, doch das englische Volk erinnert sich zu Bedas Zeiten noch an Gregor und nennt ihn seinen Apostel.
h. Die Bischöfe Januarius von Cagliari und Maximus von Salona
Unter all den großen Regierungssorgen beschäftigten Gregor peinliche persönliche Angelegenheiten zweier Bischöfe. Auf Sardinien war der Stamm der Barbaricini noch heidnisch. Gregor wandte alle Mühe auf, um das Völklein zu bekehren, und sandte Bischof Felix sowie den Abt Cyriacus zu diesem Zweck auf die Insel. Der Papst ist ungehalten, weil christliche Grundbesitzer, ja sogar Bischöfe und der Erzbischof Januarius von Cagliari Heiden unter ihren Pächtern duldeten. Während seines ganzen Pontifikates hatte sich Gregor mit Januarius zu befassen. Er war eigentlich kein schlimmer Mann, aber in hohem Grade unklug und kopflos in seinem Vorgehen, so daß beständig Klagen gegen ihn erhoben wurden. In unerschöpflicher Geduld bittet und warnt ihn Gregor in einer Reihe von Briefen. Ungleich größere Schwierigkeiten bereitete ihm aber Maximus von Salona. Als dieser ihm Jahre 593 zur Bischofsweihe vorgeschlagen wurde, verweigerte Gregor seine Zustimmung, weil zu viele Klagen gegen ihn vorlagen. Die Bischöfe aber weihten ihn nach einem gewalttätigen Auftritt und beriefen sich auf den oströmischen Kaiser, der die Weihe des Maximus verlange. Daraufhin suspendierte der Papst Maximus und seine Konsekratoren, bis er genaue Kenntnis haben würde, ob die Weihe wirklich auf den Druck des Kaisers zurückzuführen sei. Maximus kehrte sich aber nicht an die Strafe des Papstes und fand den Schutz des Kaisers. Ein Teil des Klerus und des Volkes trat für ihn beim Papst ein, der noch immer auf Aufklärung über den Hergang der Weihe wartete. Statt derer traf die kaiserliche Forderung ein, Maximus als rechtmäßig gewählt und geweiht anzuerkennen und ihn ehrenvoll in Rom zu empfangen. Als auch die Kaiserin Konstantina sich für Maximus verwendete, erklärte Gregor, er wolle es dem Maximus nachsehen, daß er sich seinem Verbote zuwider habe weihen lassen; aber die Klagen, die gegen ihn sonst vorliegen, müßten untersucht werden, und deshalb solle Maximus nach Rom kommen. Feierlich erklärte Gregor in Briefen an Maximus, an Klerus und Volk von Salona und von Zara, daß er nicht von Haß oder Leidenschaft geleitet werde, wenn er eine gerichtliche Untersuchung fordere, sondern daß er auf Reinhaltung der kirchlichen Disziplin dringen müsse; es spreche gegen Maximus, daß er ungehorsamerweise sich weigere, nach Rom zu kommen. Allmählich wandten sich aber doch die Anhänger von Maximus ab, so Bischof Sabinianus von Zara, so daß Maximus endlich nach siebenjähriger Widerspenstigkeit im Jahre 599 seine Unterwerfung nach Rom meldete.
i. Spanien
In Spanien trat nach dem Tode des arianischen Westgotenkönigs Leovigild, 586, dessen Sohn und Nachfolger Rekkared mit dem ganzen Volke zur katholischen Kirche über. Gregor verfolgte die Wandlung mit um so größerer Freude, als der hl. Leander, Erzbischof von Sevilla, sein Freund war. Es ist aber leicht erklärlich, daß noch manche Übelstände auftauchten. So mußte Gregor 603 den Defensor Johannes auf die kleine Insel Cabrera bei Majorca schicken, weil die Mönche eines dortigen Klosters übel hausten. Von da weg hatte sich Johannes an das Festland zu begeben, wo noch ein Landstreifen der byzantinischen Herrschaft unterstand. Dort waren der Bischof Januarius von Malaga und ein Bischof Stephanus, dessen Diözese uns unbekannt ist, auf Betreiben des kaiserlichen Statthalters von einer Bischofssynode abgesetzt worden. Der Defensor erhielt von Gregor genaueste Anweisung mit, die uns in Ep. lib. XIII 45, Migne P. L. LXXVII 1294 ff. erhalten ist und uns Einblick in das Gerichtsverfahren gibt. Es wird angegeben, wie die Wahrheit erforscht werden soll; es sind die Normen des römischen Rechts angeführt, die in Frage kommen; und schließlich ist der Entwurf des Urteils beigefügt für den Fall, daß die Unschuld des Bischofs erwiesen würde. Die Bischöfe, die Januarius zu Unrecht absetzten, sollten zur Buße auf einige Zeit in ein Kloster verwiesen werden; der Nachfolger auf dem Bischofstuhl in Malaga soll entfernt werden und Januarius wieder in sein Bistum zurückkehren.
k. Die Donatisten in Afrika
Als Belisar den arianischen Vandalen die Herrschaft in Afrika abnahm, blieb dort die arianische Irrlehre doch bestehen. Ihre Anhänger hatten das Bestreben, die Katholiken auf jede Weise zu belästigen, Sekten aber zu begünstigen. Dazu gehörten die schismatischen Donatisten, die ebenfalls die Katholiken zu unterdrücken suchten. Sie erlahmten aber nach und nach in ihrem Widerstand, besonders weil die Führung fehlte. Es wurden nämlich zu Vorstehern der Kirchenprovinzen nicht die tüchtigsten und würdigsten Bischöfe gewählt, sondern die Bischöfe rückten entweder nach dem Alter oder nach dem Rang ihres Bistumssitzes in die Würde eines Metropoliten auf. Dagegen griff nun Gregor mit aller Energie ein. Schon im ersten Jahre seines Pontifikates ordnete er an, daß die Bischöfe ihren Metropoliten dem Verdienste und der Würdigkeit nach wählen sollen, daß der Gewählte in seiner Bischofsstadt zu residieren hat und daß keine donatistischen Bischöfe zu Metropoliten gewählt werden dürfen. 64 Eine mächtige Stütze fand Gregor an dem numidischen Bischof Columbus, an Erzbischof Dominicus von Karthago und an dem Exarchen Gennadius, der ebenfalls in Karthago seinen Sitz hatte. Dem unablässigen Bemühen Gregors gelang es, den Sieg über die Donatisten zu erringen. In der zweiten Hälfte seiner Regierung geschieht ihrer nicht mehr Erwähnung, und sie gehören der Geschichte an, nachdem sie 300 Jahre lang großes Unheil über die afrikanische Kirche gebracht hatten. l. Der Papst und die Juden Es hielten sich damals Juden im ganzen Reiche auf, so in den Städten Afrikas, Siziliens, Sardiniens, Italiens, in Gallien und Spanien. Sie lebten vom Handel, zum Teil auch vom Ackerbau wie in Spanien. Die kaiserlichen Gesetze gestatteten ihnen die Niederlassung innerhalb des Reiches, legten ihnen aber neben starker Besteuerung vielerlei Einschränkungen auf. So waren sie z. B. von den Militär- und Zivilstellen ausgeschlossen, durften mit Christen keine Ehen eingehen und nicht mit christlichen Sklaven Handel treiben. Sie waren nicht beliebt und darum oft Verfolgungen ausgesetzt. Einige Bischöfe und die Frankenkönige zwangen Juden mit Gewalt, daß sie sich taufen ließen.
Oft nahmen Juden die Aufmerksamkeit Gregors im Vertrauen auf seinen Gerechtigkeitssinn und auf seine Macht in Anspruch, und so erhalten wir dankenswerter Weise Einblick in mancherlei Einzelheiten. Es seien nur drei Fälle angeführt, Gregor schreibt 591 an die Bischöfe von Arles und Marseille, daß sich italische Juden, die Geschäfte halber öfter nach Südfrankreich kämen, bei ihm beschwert haben. Es seien nämlich dort viele Juden zur Taufe gezwungen worden. Die Absicht sei ja löblich und entspringe der Liebe zum Herrn; aber es sei zu fürchten, daß diese Absicht zu nichts Gutem führe, wenn nicht die Belehrung durch die Hl. Schrift die Wandlung bewirke; wenn einer gezwungen und nicht durch Belehrung zur Taufe komme und dann in den früheren Unglauben zurückfalle, so werde es für ihn um so schlimmer sein. 65 In Terracina wurde den Juden die Synagoge genommen, weil sie so nahe bei der Kirche stand, daß durch den jüdischen Gesang der Gottesdienst gestört wurde. Gregor schreibt an die Bischöfe Bacauda und Agnellus, sie sollen den Fall untersuchen. Wenn wirklich der Gottesdienst gestört werde, sei den Juden innerhalb der Stadtmauern ein anderer Raum, wo sie ihre Zeremonien begehen und wo dann keine Klagen mehr entstehen können, zur Verfügung zu stellen; es soll ihnen nicht erschwert werden, zu leben, wie es ihnen die römischen Gesetze gestatten; christliche Sklaven dürften sie aber nicht halten. 66 Die Juden kauften oft Sklaven in Gallien und brachten sie in Italien auf den Markt. Da sich darunter auch Christen befanden, trat Bischof Fortunatus von Neapel dagegen auf. Der Jude Basilius wurde beim Papste vorstellig und brachte vor, daß sie oft von Richtern beauftragt würden, Sklaven einzukaufen; und so könne es vorkommen, daß auch Christen darunter seien. Gregor weist Fortunatus an, der Sache seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Wenn wieder ein solches Sklavenschiff nach Neapel komme und Christen dabei wären, sollen sie entweder zu den Auftraggebern gebracht oder innerhalb vierzig Tagen christlichen Käufern überlassen werden. 67
m. Gregor und die Liturgie
Johannes Diaconus berichtet von Gregor: „Alsdann veranstaltete er im Hause des Herrn, wie der weise Salomon, wegen der Eindringlichkeit eines schönen Gesanges mit großem Fleiße eine Sammlung der Antiphonen für den Gesang. Auch gründete er einen Sängerchor, der heute noch in der römischen Kirche nach denselben Bestimmungen singt.“ 68 Weiter sagt Johannes Diaconus, Gregor habe das Buch des Gelasius über die Feier der hl. Messe neu redigiert, habe Änderungen im Kanon getroffen und die Stationsgottesdienste geregelt. 69 Gregor gilt von da ab als der große Restaurator des Gesanges, der nach ihm benannt ist. Vergeblich suchen wir nähere Angaben darüber bei Gregor selbst oder bei seinen Zeitgenossen. Der liber Pontificalis sagt darüber nur: „Hic augmentavit in praedicationem canonis, diesque nostros in tua pace disponas, et cetera.“ 70 Johann Georg Eckhart (1664—1730) setzt Zweifel in die Berechtigung der bisherigen Tradition, 71 und Gallicioli greift sie ziemlich heftig an, 72 während andere für sie eintreten. Der Vorgang wiederholte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Fr. Aug. Gevaert 73 gegen, Dom Germain Morin, 74 Dom Cagin 75 u. a. für die Tradition eintraten. Adalbert Ebner, der über diese Meinungsverschiedenheiten berichtet, kommt zu dem Schlusse, daß das Übergewicht der positiven Beweisgründe auf selten der Tradition * für * Gregor liege. 76 Als ein Hauptbeweismoment kann er ein Elfenbein-Diptychon von Monza in die Waagschale werfen, das von Gregor der Königin Theodelinde übersendet wurde. Auf ihm ist der Anfang einer Hexameterreihe, die das Lob Gregors als Liturgikers verkündet, in Schriftzeichen eingegraben, die auf jene Zeit zurückgehen. P. Coelestin Vivell vermutet, daß ein Musik-Traktat Gregors existierte und verlorengegangen sei. 77 Die Schwierigkeiten dürften ihre Lösung darin finden, daß Gregor wahrscheinlich noch als Mönch das Antiphonarium zusammenstellte und den Gesang reformierte. Da es damals noch keine solche Einheit in liturgischen Dingen gab wie heute und jede Kirche ihre Eigenheiten besaß, dachte Gregor bei seiner Arbeit nur an sein Kloster, an seine Kirche. Von da hinweg ging sie mit ihm in die lateranische Basilika und nach St. Peter, um dann später mit seinem Ruhme, besonders durch die Bemühungen Karls des Großen, durch das ganze Abendland sich zu verbreiten. 78 Sicher ist, daß Gregor das Kyrie eleison, wie es jetzt in der hl. Messe gebetet wird, anordnete, daß er die Anfügung des Alleluja nach dem Graduale regelte, die Worte Diesque nostros in tua pace disponas in das „Hanc igitur“ einfügte und dem Pater noster die jetzige Stelle zuteilte. Die Namensbeifügung „atque Andrea“ im Embolismus wird fast allgemein auf Gregor, den ehemaligen Abt von St. Andreas, zurückgeführt.
6. Gregor als Schriftsteller
Dadurch, daß Gregor ganz in sich gesammelt war und vom Verlangen, andern zu nützen, die Früchte seines Nachdenkens in klare Formen faßte, ist er der fruchtbare Schriftsteller geworden.
Sein erstes und größtes Werk ist die * Erklärung des Buches Job, Expositio in librum B. Job, * kurz * Moralia * genannt. Vers für Vers behandelnd, entweder historisch und allegorisch oder nach dem historischen, allegorischen und moralischen Sinn, geht Gregor in die verborgensten Tiefen des Seelenlebens ein, so daß diese 35 Bücher als das große Pastoral- und Moralhandbuch des Mittelalters bezeichnet werden können, das die weiteste Verbreitung fand. Das Werk wurde immer wieder exzerpiert, schon von Notker Labeo ins Deutsche und im 14. Jahrhundert von Zanobi da Strata ins Italienische übersetzt.
Ihm steht zeitlich und inhaltlich am nächsten die * Regula pastoralis, * welche Gregor bald nach Antritt seines Hirtenamtes verfaßte. Über ihre Bedeutung siehe die Einleitung zur Übersetzung dieses Werkes.
Als Erklärer der Hl. Schrift hielt Gregor * 22 Homilien über das Buch Ezechiel. * Die ernsten Gesichte der Propheten und die Ereignisse in Italien verliehen Gregor eine eindringliche Sprache. Er begann mit diesen Homilien 593 und kam bis Ezech. 4, 8. Als Agilulf gegen Rom vordrang, brach er ab, um dann später noch zehn Homilien über Ezech. 40, 1—48 zu halten. Im Jahre 601 sah er sie noch einmal durch und gab ein Exemplar in das päpstliche Archiv.
Von den * Evangelien-Homilien * hielt der Papst zwanzig selbst; zwanzig diktierte er und ließ sie vorlesen. Er legte großes Gewicht darauf, daß keine fehlerhaften Nachschriften von ihnen verbreitet wurden. In dem Begleitbrief zu den Evangelien-Homilien an Bischof Secundinus von Taormina sagt Gregor, die einen habe er seinem Notar diktiert und von ihm vorlesen lassen, die andern habe er selbst gesprochen, und während des Vortrages seien sie nachgeschrieben worden. Manche seien nun so auf die Homilien versessen gewesen, daß sie die Überprüfung der Nachschrift nicht mehr abwarteten, sondern sie sofort mit sich nahmen, wie Hungrige, die nicht warten können, bis die Speise gargekocht ist. 79 Auch von diesen Homilien ließ er den Originaltext in zwei Bänden im päpstlichen Archiv aufbewahren. Wenn Gregor auch in den Homilien sich oft der allegorisierenden Erklärung bediente, so wandte er sich doch vielfach ganz konkreten Dingen zu und redete in so eindringlicher und ansprechender Weise, daß das Volk in Scharen herbeiströmte, um ihn zu hören, und ihn den Goldmund nannte. Man sagte auch, der Hl. Geist sei ihm sichtbar genaht und habe ihm beim Schreiben die heiligen Gedanken eingegeben. Bemerkenswert für die Geschichte der Predigt ist, daß Gregor zuerst häufigen Gebrauch von Erzählungen macht, die er regelmäßig am Schlusse einzuflechten versteht: „denn einige werden mehr durch die Beweisführung, andere mehr durch Beispiele angezogen.“ 80 In Klosterneuburg erschien 1931 eine Übersetzung der XL Evangelienhomilien.
Von 593—594 verfaßte Gregor sein populärstes Werk, * die vier Bücher der Dialoge. * Das Nähere darüber siehe in der Einleitung dazu (Bd. II der Schriften Gregors in dieser zweiten Reihe der Kirchenväterbibliothek).
Neben den Dialogen sind die wichtigste Quelle für das Leben Gregors und für die Geschichte des ausgehenden VI. Jahrhunderts * die Briefe Gregors. * Siehe darüber die Einleitung zur Auswahl der Briefe in diesem Bande Seite 271 f.
Ob die Expositio super Cantica Canticorum, In Librum Primum Regum variarum expositionum libri VI, In septem Psalmos poenitentiae Expositio und eine Concordia quorundam testimoniorum S. Scripturae Gregor zum Autor haben, ist sehr zweifelhaft. Sie sind wahrscheinlich von Mitbrüdern oder Schülern des Papstes, als er noch Mönch war, verfaßt worden unter Benützung von Notizen, die aus Vorträgen Gregors herrührten. Auch Hymnen können Gregor nicht mit Sicherheit zugeschrieben werden.
Was die Sprache Gregors anbelangt, so ist zu seiner Zeit die Abschleifung der Sprache bereits in lebendigem Fluß gewesen, dem sich Gregor nicht mehr entziehen konnte. Als Beispiel sei angeführt, daß e für ae, i für ē gebraucht wird, wie discendere für descendere, daß ĭ in e übergeht z. B. in dolea für dolia, u in o wie cellola für cellula; im Bau der Sprache tritt de an Stelle des Genitivs, wie defensor de patrimonio, per, ex, in an Stelle des bloßen Ablativs: per tormenta, ex revelatione discere, in celeritate usw.; beim Verbum erscheint das Aktivum für das Passivum, das Aktivum wird Deponens z. B. audio te fuisse migratum; die dritte und vierte Konjugation werden verwechselt, das Verbum tollere bildet tuli, tultum usw. 81 Trotzdem bleibt die Redeweise Gregors vornehm; und es läßt sich nicht verkennen, daß er viel Ambrosius, hauptsächlich aber Augustinus gelesen hat. Er weiß es, daß sein Stil von dem der Rhetoren und Grammatiker abweicht, gibt jedoch in dem Begleitbrief der Moralia an Bischof Leander zwei triftige Gründe hierfür an. „Wer die Dinge recht betrachten will, dem wird klar, daß mir meine körperliche Gebrechlichkeit die Arbeit sehr erschwert hat. Wenn die körperliche Kraft kaum zum Reden ausreicht, kann der Geist nicht würdig genug ausdrücken, was er denkt. Ist denn nicht der Körper das Werkzeug des Herzens? Mag ein Sänger auch noch so sehr seine Kunst verstehen, so kann er doch nicht singen, wenn die Organe nicht mittun. Mag auch eine gelehrte Hand dirigieren, so kann doch das geschwächte Organ nicht singen; und es kann kein Ton auf der Sackpfeife angeblasen werden, wenn sie voller Risse ist. Wie sehr muß also meine Auslegung leiden, wenn meine schwachen Kräfte keine Anmut mehr aufkommen lassen? Suche, wenn du dieses Werk durchgehst, kein Blätterwerk von schönen Worten; denn man darf im Tempel Gottes keinen Hain anlegen 82 und eben dadurch wird denen, die Gottes Wort behandeln, alle unfruchtbare und leichtfertige Vielrederei untersagt. Wir alle wissen, daß die Ähren wenig Körner tragen, wenn die Halme gar zu viel Blätter haben. Darum wollte ich mich nicht nach der Redeweise, wie sie die weltlichen Rhetoren lehren, richten, meide, wie auch dieser Brief zeigt, nicht Metacismen noch Barbarismen und beachte nicht Wortstellung und Rhythmus und den Kasus der Präpositionen, da ich es für sehr unwürdig erachte, die Worte des himmlischen Orakels unter die Regeln des Donatus zu beugen. Das ist auch von keinem der Schriftausleger geschehen.“ 83 Diese Stelle bietet uns den Schlüssel zur gerechten Beurteilung von Gregors Stil. Gregor ist abhängig von seinem leidenden körperlichen Befinden, daher der oft ermüdende, eintönige Satzbau, besonders in der Regula Pastoralis; er vermeidet aber auch geflissentlich allen Redeschmuck, weil das heilige Wort in Einfachheit dargeboten werden muß. Er schreibt in der Sprache seiner Zeit; er will sich nicht fern ab vom Volke stellen, das ist das „Sich nicht beugen unter die Regeln des Donatus“. In den vielen Antithesen verrät er den Einfluß von Augustin her, in den tautologischen Häufungen den Verfall der Latinität. Mitunter aber wird er von der Gedankenfülle hingerissen und schreibt Partien von glänzender und überwältigender Schönheit, so z. B. in Reg. Past. III 12, wo er vom Leiden des Erlösers, oder in den Dialogen III 38, wo er vom Unglück Italiens redet.
7. Gregors Persönlichkeit
Eine gelegentliche Bemerkung Gregors 84 läßt vermuten, daß er einmal ein voller, kräftiger Mann gewesen sein muß, daß der Körper aber durch die lange Krankheit ganz mager und ausgetrocknet wurde. Oft tauchen in den Schriften Gregors Bemerkungen auf über ein Magenleiden und besonders über das Podagra, das ihn peinigt. Vom Jahre 598 an scheint er die meiste Zeit ans Bett gebunden gewesen zu sein; nur mühsam konnte er zuweilen drei Stunden außer Bettes sein, um die heiligen Geheimnisse zu feiern. Von seinem leiblichen Aussehen zeugt uns leider kein zeitgenössisches Bild, Johannes Diaconus sah in St. Andreas noch ein sehr altes Porträt Gregors und beschreibt es eingehend. Darnach war er von regelmäßiger und schöner Gestalt, sein Antlitz hatte etwas von dem länglichen Oval des Vaters und von der Rundung des mütterlichen Gesichtes; der Bart war etwas blond und kurz geschoren, der Scheitel kahl mit zwei kleinen Locken oberhalb der schönen Stirne; das Haar zu beiden Seiten des Hauptes war dunkel, die Farbe der Augen braun, die Nase gerade, in der Mitte etwas anschwellend, das Kinn etwas vorstehend; das Kolorit war dunkel und voller Leben und verriet noch nicht sein Magenleiden; die Hände waren schön geformt. 85 Von den Charaktereigenschaften Gregors fällt vor allem sein tiefer Ernst auf, der dadurch noch besonders gesteigert wird, daß er das Ende der Zeiten nahe sieht. Alle die schweren Bedrängnisse seiner Zeit bestärken ihn in der Annahme von der alternden Welt, von dem Herannahen des Endes. Mit dem Ernste verbindet sich die Festigkeit in der Verfolgung eines Zieles: „Eher bin ich bereit zu sterben, als zu meinen Lebzeiten die Kirche des hl. Petrus in ihrem Ansehen schädigen zu lassen; lange kann ich etwas ertragen, aber wenn ich mich einmal entschlossen habe, es nicht länger zu tragen, gehe ich freudig allen Gefahren entgegen.“ 86 Bescheiden bekennt er zwar seine Fehler, ist aber unbeugsam, wenn er es für notwendig hält. Als ihm Bischof Anastasius von Antiochien einen leisen Tadel ausspricht, weil er die Angelegenheit des Johannes Jejunator so ernst nehme, schreibt er: „Ich weiß, daß ich immer Fehler an mir hatte, und ich gab mir Mühe, sie zu bekämpfen und abzulegen.“ 87 Johannes Jejunator, Patriarch von Konstantinopel, legte sich nämlich den Titel eines ökumenischen Bischofs bei, wogegen Gregor entschiedenen Einspruch erhob. In derselben Sache zieh Kaiser Mauritius den Papst einer gewissen Unversöhnlichkeit; dieser antwortete darauf: „Ich bin ein Sünder, habe aber mit Gottes Hilfe die Demut bewahrt und bedarf keiner Ermahnung zur Demut.“ 88 So zeigt sich sein entschiedener Wille, der die Menschen nicht fürchtet, wenn er in einer Angelegenheit Gott gefallen will. 89 Ist Gregor auch streng gegen solche, die gefehlt, so denkt er doch nicht gleich an Schlimmes, sondern ordnet sofort eine Untersuchung des Falles an. Dabei ist er Streitigkeiten gänzlich abgeneigt. So hat er einmal Anweisung gegeben, wie ein Grenzstreit beizulegen ist, und fügt bei, er wolle keinen Prozeß angestrengt wissen, die Mißhelligkeiten sollen auf jede Weise beigelegt werden; er erwarte darum, daß in dieser Sache keine Klage mehr an ihn komme. 90 Neben dem Ernste ist ein Hauptcharakterzug die Gerechtigkeitsliebe. Er hat erfahren, daß auf Sizilien viele Leute durch die Verwalter des römischen Kirchengutes geschädigt wurden. Er beauftragt den Subdiakon Petrus, 91 alles genau zu untersuchen; wenn jemand geschädigt wurde, so soll ihm sein Eigentum zurückgegeben werden. Er hörte auch, daß Sklaven entlaufen wären und sich dann als zu einer Kirche gehörig ausgegeben hätten, worauf Kirchenverwalter solche sogleich als Kirchengut angesehen und behalten hätten. „Dies mißfällt mir sehr,“ schreibt er im gleichen Brief, „da es jeder Gerechtigkeit widerspricht. Mache das alles ohne Zögern gut!“
Muß er tadeln, so tut er das nicht aus Härte, sondern aus brüderlicher Liebe. „Wir sind alle ein Glied am Leibe unseres Erlösers. Darum leide ich mit, wenn Du fehlst, und freue mich, wenn Du Gutes tust!“ So an Bischof Januarius von Cagliari. 92 An Bischof Opportunus in den Abruzzen, den er tadeln mußte, und der darob noch traurig ist, schreibt er in freundlichen Worten, er habe nicht aus Härte, sondern aus Liebe, um seiner Seele willen, so zu ihm reden müssen. 93 Eine andere Eigenschaft Gregors ist seine helfende, sich um alles kümmernde Güte. Es sind oben 94 schon Beispiele angeführt worden, wir fügen jedoch zur Zeichnung seines Charakterbildes noch einige Züge an. Um 596 machten die Langobarden in Kampanien viele Gefangene. Im Mai des Jahres schreibt der Papst an den Subdiakon Anthemius in Neapel, wie groß sein Schmerz darüber sei, und schickt Geld zur Abhilfe; die Freien, die nicht selbst das Lösegeld aufbringen können, solle er loskaufen, ebenso die Sklaven, deren Herren nicht imstande sind, sie freizukaufen; er soll ein Verzeichnis der Losgekauften mit Angabe der persönlichen Verhältnisse einschicken und die aufgewandte Summe benennen. 95 Er hat großes Bedauern mit Bischof Ecclesius von Chiusi wegen seiner Erkrankung und schickt ihm ein Pferd, damit er sich ausfahren lassen kann. 96 Dem Abt Johannes Climacus vom Kloster auf dem Sinai schickt er am 1. September 601 Bettdecken, Mäntel und Beinkleider für seine Mönche; und dem Presbyter Palladius desselben Klosters, der angeschwärzt wurde und darüber sehr niedergeschlagen war, sandte er mit tröstlichen, väterlichen Worten eine Cuculle und eine Tunika. 97 Dabei wachte Gregor darüber, daß an seinem Hofe Adel und Würde hochgehalten wurden. Er ist nicht zufrieden mit dem Subdiakon Petrus, weil ihm dieser ein schlechtes Pferd sandte; wenn er ausreitet, soll sein Tier von gutem Schlage sein. 98 Keiner der Diener des Papstes, berichtet Johannes Diaconus, vom untersten bis zum obersten, zeigte etwas Barbarisches in Rede oder Haltung; das alte echte lateinische Wesen in der Toga nach Art der Quiriten behauptete seinen Platz in dem latialischen Palast. Bei wem es an heiligem Wandel oder an Klugheit fehlte, der durfte sich keine Aussichten machen, vor dem Papst bestehen zu können. 99
So steht Gregor als ein einheitlicher Charakter, als ein starker, unablässig um die Herde Christi besorgter, vor keiner Schwierigkeit zurückweichender Papst im Sturmlauf jener Tage unerschütterlich da. Es ist, als ob er nicht an die Zukunft dächte; er will den Stand der Kirche in Ordnung halten vor dem nahenden Weltende. Aber nach seinem Tode, 604, wendet sich allmählich der Zeiten Lauf wieder aufwärts; Gregor steht als Grenzstein zwischen dem Altertum und dem Mittelalter der Kirche; er schließt die Zeit vor ihm ab und wird zum Ausgangspunkt, zum großen Lehrmeister für die Folgezeit. In allen Stücken knüpft sie an ihn an; er befruchtet durch seine Schriften ihren Seeleneifer; er ist das Vorbild für die Unterweisung aller Stände in der Predigt, für die Verwaltung und Rechtsprechung der Kirche und für die Feier der heiligen Geheimnisse. Er ist der heilige Kirchenlehrer, auf den das ganze Mittelalter horcht. Darum erhält er auch die Bezeichnung der Große, die vom Ausgang des 11. Jahrhunderts sich allgemein einbürgert. 100
„Es ist bewundernswert“, sagt Papst Pius X. in dem Rundschreiben zur Zentenarfeier v. 11. März 1904, „was Gregor in der kurzen Zeit seiner Regierung erreichte: er reformierte das gesamte christliche Leben, weckte die Frömmigkeit der Gläubigen, stellte die Disziplin der Mönche und des Klerus wieder her und schärfte den Bischöfen die Sorge für die ihnen anvertraute Herde wieder ein. Wahrhaft ein Stellvertreter Gottes, dehnte er seine Wirksamkeit über die Mauern Roms hinaus aus und war überall auf das Wohl der bürgerlichen Gesellschaft bedacht. … Seine Wirksamkeit war so heilsam, daß die Erinnerung an seine Taten sich tief den kommenden Geschlechtern einprägte, namentlich während des Mittelalters, das nach seinem Geiste lebte, von seinen Worten sich nährte, nach seinem Beispiele das ganze Leben einrichtete, wodurch die christlich-soziale Gesellschaftsordnung sich einbürgerte im Gegensatz zur römischen der früheren Jahrhunderte.“
Das ist Gregor, der große, heilige Papst und Kirchenlehrer, der am 12. März 604 seine irdischen Tage beschloß.
8. Literatur
Die * Schriften * Gregors erschienen das erstemal in einer Gesamtausgabe in Paris 1518; 1588—1593 folgte die des P. Tossianensis in Rom in 6 Bänden; P. Gous-sainville ließ eine solche in 3 Bänden 1675 in Paris folgen. Daraufhin besorgte Sainte-Marthe von der Mauriner Kongregation 1705 eine Ausgabe in 4 Bänden, die J. B. Gallicioli mit Zusätzen versah und 1768—1776 in Venedig in schöner Ausgabe in 17 Bänden edierte. J. P. Migne nahm die Maurinerausgabe in seine Patrologie, P. L. LXXV—LXXIX auf.
Leben und Werke Gregors behandeln u. a.
Albers Bruno, Gregor I. d. Gr., Mönch und Papst. Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden. Jahrg. XXV, 1904, S. 138 ff. Batiffol P., St. Grégoire le Grand. Paris 1928. Bilguer Dr. v., Gregor der Große. 40 S. Berlin 1904. Bonsmann Th., Gregor I. der Große. Ein Lebensbild. 104 S. Paderborn 1890. Bonucci, Istoria de B. Gregorio. Rom 1711. Dudden F. Homes, Gregory the Great, his place in history and thought, 2 vol. London 1905. Grisar Hartmann, Il pontificato di S. Gregorio Magno. 1900, 2. Aufl. 1904. Die Aufsätze, die Grisar anläßlich der Gregor-Zentenarfeier in der Civiltà catholica erscheinen ließ, faßte er zusammen in seiner Geschichte Roms und der Päpste im Mittelalter, 1. Bd. 3. Teil. Maimbourg, Histoire du pontificat de S. Grégoire. Paris 1687. Pfahler G., Gregor der Große und seine Zeit. Frankfurt 1852. Sainte-Marthe, Histoire de S. Grégoire. Rouen 1677. Schuster, Les ancêtres de S. Grégoire. Revue Bénédictine, avril 1904. Stiglmayr Joseph, Selbstbildnis des Papstes Gregor d. Gr. nach seinen Briefen. „75 Jahre Stella Matutina“, Festschrift. Feldkirch 1931, Bd. I S. 493—512. Stuhlfath Dr. Walter, Gregor I. d. Gr. Sein Leben bis zu seiner Wahl zum Papste nebst einer Untersuchung der ältesten Viten. In: Heidelberger Abhandlungen zur mittl. Geschichte. Heidelberg 1913. Tarducci Francesco, Storia di S. Gregorio Magno e del suo tempo. Rom 1909. Van den Zype, S. Gregorius M. Ypern 1610. Weber G. Anton, Der hl. Gregor I. d. Gr. Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden. Jahrg. XXV, 1904, S. 556 ff. Wietrowsky M., Historia de gestis praecipuis in pontificatu Gregorii Magni, Prag 1726. Wolfsgruber Dr. Cölestin, Gregor der Große. Ravensburg 1897.
Neben den Artikeln über Gregor in den Sammelwerken
Bardenhewer Otto, Geschichte der altchristlichen Literatur V. 559 ff. Freiburg i. Br. 1932. Buchberger Mich., Lexikon für Theologie und Kirche IV 660, Freiburg 1932. The Catholic Encyclopedie. VI 787. Newyork. Dictionnaire d’archéologie et de liturgie. VII 753 ff. Paris. Hauck Albert, Realencyklopädie f. prot. Theologie und Kirche, VII 78 ff. Kirsch Dr. Joh. Peter, Die Kirche in der antiken griechisch-römischen Kulturwelt. Freiburg i. Br. 1930. Manitius Max, Geschichte der lat. Literatur des Mittelalters I 92—106. München 1911. Schanz-Hosius, Geschichte der römischen Literatur IV 2, 605—623. München 1920.
Seien von den unübersehbaren Einzelabhandlungen nur erwähnt:
Armbrust, Die territoriale Politik der Päpste von 500—800. Dissertation. Göttingen 1885. Bernheim Ernst, Mittelalterliche Zeitanschauungen in ihrem Einfluß auf Politik und Geschichtschreibung. 1. Teil. Tübingen 1918. Bertoni G., La versione francese delle Prediche di S. Gregorio su Ezechiele. Modena 1904. Blasel Carl, Die kirchlichen Zustände Italiens zur Zeit Gregors d. Gr. Archiv f. kath. Kirchenrecht, 84. Bd., 1904, S. 83 ff., 225 ff. Boncaud Ch., St. Grégoire le Grand et la notion chrétienne de la richesse. Paris 1912. Butler Dom Cuthbert, Western mysticism. London 1922. Carmé, La théologie de S. Grégoire Ier. Thèse de M. Carmé. Bull. de litterature eccles. Juni 1908 pag. 205—210. Clotet L., La Papauté depuis l’avènement de Grégoire le Grand jusqu’en l’an 800. Revue de l’Institut Catholique de Paris, XIII, 1908. Danzer B., Der hl. Gregor d. Gr. in der Missionsbewegung seiner Zeit. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige 1912. S. 205—219. Dreves Guido, Haben wir Gregor d. Gr. als Hymnendichter anzusehen? Theol. Quartalschrift XCI, 1909, S. 436—445. Duchesne, Les évêchés d’Italie et l’invasion lombarde. In: Mélanges d’archéologie et d’histoire, 1903, pp. 83—116. Eisenhofer Ludwig, Augustinus in den Evangelienharmonien Gregors d. Gr. Ein Beitrag zur Erforschung der literarischen Quellen Gregors d. Gr. Festschrift für Prof. Knöpfler. Freiburg i. Br. 1917, S. 56 ff. Göller Emil, Die Periodisierung der Kirchengeschichte und die epochale Stellung des Mittelalters zwischen dem christlichen Altertum und der Neuzeit. Rektoratsrede. Freiburg i. Br. 1919. Görres F., Papst Gregor I. der Große und das Judentum. Zeitschrift für wissensch. Theologie 1908, S. 489—505. Grisar P. S. J., Ein Rundgang durch die Patrimonien des Hl. Stuhles um das Jahr 600. Zeitschrift für katholische Theologie, I. Bd. (1877). Grisar P. S. J., Verwaltung und Haushalt der päpstlichen Patrimonien um das Jahr 600. Zeitschrift für katholische Theologie, I. Bd. (1877). Haberl Frz. X., Die römische schola cantorum. Vierteljahresschrift f. Musikwissenschaft. Leipzig 1887. Hartmann, Römer und Langobarden bis zur Teilung Italiens. Leipzig 1900. Hecht Hans, Bischof Waerferths von Worcester Übersetzung der Dialoge Gregors d. Gr., Leipzig 1900. Hör1e Dr. Gg. Heinrich, Frühmittelalterliche Mönchs- und Klerikerbildung in Italien. Freiburger theologische Studien. Freiburg 1914. Kühlemann Otto, Über die Quellen eines altfranzösischen Lebens Gregors des Großen. Halle 1885. Lagarde A., Le pape St. Grégoire a-t-il connu la confession? Revue d’histoire et de littérature réligieuse 17 (1912). Lederer Dr. Viktor, Gregor ein Ire? Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Regensburg, XXI (1908), S. 172 u. XXIII (1910), S. 147. Lietzmann H., Das Sacramentarium Gregorianum nach dem Aachener Urexemplar. 1921. Lietzmann H., Handschriftliches zur Rekonstruktion des Sacramentarium Gregorianum. In: Miscellanea Francesco Ehrle. Scritti di Storia e Paleografia. II. Bd. Rom 1924. Ludwig Dr. August, Gregor der Große über sogen. experimentelle Beweise des Fortlebens nach dem Tode. Psychische Studien, 1920. Mommsen, Die Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I. Zeitschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. I. Band. (1893), Heft 1. Morin D. Germain, Der Ursprung des gregorianischen Gesangs. Deutsch von Thomas Elsässer. Paderborn 1892. Ott Karl, Das Seelengemälde der Häretiker beim hl. Gregor d. Gr. Eine patristische Studie. Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens und seiner Zweige. 1911, S. 373—384. Pfeilschifter Dr. Georg, Die authentische Ausgabe der Evangelien-Homilien Gregors d. Gr. Veröffentlichungen aus dem Kirchenhistorischen Seminar München Nr. 4. München 1900. Papencordt Dr. Felix, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. Constantin Höfler. Paderborn 1857. Prunner, Gnade und Sünde nach Gregors Expositio in Job. Eichstätt 1855. Reumont A. v., Geschichte der Stadt Rom. 1867. Schneider Fedor, Rom und der Romgedanke im Mittelalter. München 1926. Schnürer Dr. Gustav, Kirche und Kultur im Mittelalter, 1. Bd. Paderborn 1924. Schnürer Dr. Gustav, Die Entstehung des Kirchenstaates. Köln 1894. Schwarzlose Karl, Die Patrimonien der römischen Kirche bis zur Gründung des Kirchenstaates. Dissertation der Berliner Universität 1887. Schwarzlose Karl, Die Verwaltung und finanzielle Bedeutung der Patrimonien der römischen Kirche bis zur Gründung des Kirchenstaates. Zeitschrift für Kirchengeschichte, XI. Bd. (1890). Sepulcri Alessandro, Gregorio Magno e la scienza profana. Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Vol. 39. 1903—04. p. 962—976. Sepulcri Alessandro, Le alterazioni fonetiche e morfologiche nel latino di Gregorio Magno e del suo tempo. In Studi medievali, 1904, vol. I, 172—234. Stark Odilo, Die Wiederherstellung des gregorianischen Gesanges. Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden. XXV. Jahrg. 1904, S, 800—812. Steinacker Herm., Die römische Kirche und die griechischen Sprachkenntnisse des Frühmittelalters. In: Festschritt Theodor Gomperz dargebracht. Wien 1902. Stiglmayr Joseph, Kirchenväter und Klassizismus. 114. Ergänzungsband zu den Stimmen aus Maria-Laach. Freiburg i. Br. 1913. Tarducci F., San Gregorio Magno e la vita monacale del suo tempo. Rivista storia Benedittina, IV, 1909, p. 169—180. Theiner Augustin, Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten. Mainz 1835. Troeltsch Ernst Augustin, Die christliche Antike und das Mittelalter. Oldenbourg-München. Vailhé S., Le Titre de patriarche oecuménique avant S. Grégoire le Grand. Echos d’Orient, XI. 1908, p. 65—69, 161—171. Vivell Cölestin, Die liturgische und gesangliche Reform des hl. Gregor d. Gr. Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner- und Zisterzienserorden. XXV. Jahrg. 1904, S. 83—138. Vivell Cölestin, Vom Musiktraktate Gregors d. Gr. Breitkopf & Härtels Musikbücherei, Leipzig 1911. Wyatt E. G. P., S. Gregory and the Gregorian music, London 1904. Zwirnmann Hans, Das Verhältnis der altfranzösischen Übersetzung der Homilien Gregors über Ezechiel zum Original und zu der Übersetzung der Predigten Bernhards. Dissertation. Halle 1904.