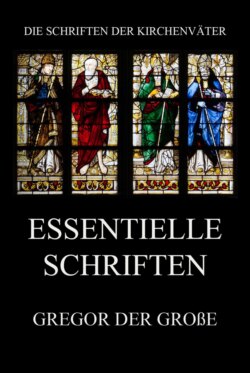Читать книгу Essentielle Schriften - Gregor der Große - Страница 7
Einleitung zu den Dialogen
Оглавление1. Veranlassung
Zum erstenmal begegnet uns die Idee dieses merkwürdigen Buches im Leben Gregors um die Wende des Jahres 592-593. Er schreibt nämlich an seinen Freund Maximian, Bischof von Syrakus: „Die Brüder, die bei mir sind, dringen auf alle mögliche Weise in mich, ich solle etwas über die Wunder, die von Vätern in Italien gewirkt wurden, schreiben. Dazu bedarf ich sehr Deiner Beihilfe. Teile mir, was Du davon in Erinnerung hast, oder was Du überhaupt erfahren kannst, kurz mit. Ich entsinne mich, daß Du mir einiges über den Abt Nonnosus, der bei Suppentonia in der Nähe des Abtes Anastasius lebte, erzählt hast. Ich habe das vergessen. Dies, und was Du sonst noch weißt, schreibe mir, bitte, recht bald, wenn Du nicht selbst zu mir kommen kannst.”1 Diese äußere Anregung zur Abfassung der Dialoge mag in der Seelenverfassung des Papstes, gerade in den ersten Jahren seiner Regierung, den lebhaftesten Widerhall gefunden haben. Denn er trug schwer an der Last des Hirtenamtes und sehnte sich oft nach der einsamen, ruhigen Beschaulichkeit seines Klosters zurück. Da war es ihm ein Labsal, sich mit den heiligen Männern, besonders mit den heiligen Männern Italiens, „seines Italiens”, das er in den Wirren der Zeit darniederliegen sah, zu unterhalten. Das Leben dieser Männer und die Wunder, die sie wirkten, waren ihm ein Trost, ein Grund, daß trotz aller Drangsal rings umher immer noch auf den Beistand des Allmächtigen zu hoffen sei.2
2. Zeit der Abfassung
Das Werk muß Ende 593 oder anfangs 594 fertig geworden sein. Denn aus den Dialogen selbst, I, Kap 7, III, Kap. 36, IV, Kap. 32, geht hervor, daß Bischof Maximian von Syrakus zur Zeit der Abfassung noch am Leben war. Im November 594 starb er, und Gregor mußte sich mit der Wahl eines Nachfolgers auf dem bischöflichen Stuhle von Syrakus befassen.3 Im 26. Kapitel des IV. Buches der Dialoge spricht Gregor von der großen Sterblichkeit, die Rom vor drei Jahren entvölkerte. Bedenken wir, daß die Pest eine Folge der Tiberüberschwemmung vom Jahre 589 war und daß sie über ein Jahr andauerte, so kommen wir gleichfalls in die Zeit von Ende 593 bis in den Anfang des Jahres 594 hinein.
3. Die Echtheit des Buches
Was die Echtheit der Dialoge betrifft, so können sie keinem anderen Autor als Papst Gregor I. zugeschrieben werden. Wie der Brief an Bischof Maximian spricht für die Urheberschaft Gregors auch der Umstand, daß mehrere Erzählungen sowohl in den Dialogen als auch in den Evangelien-Homilien vorkommen und daß Gregor in den Dialogen darauf hinweist. Literarisch wird die Autorschaft Gregors I. zuerst von Paterius, einem Vertrauten und Jünger Gregors, bezeugt. Er gab einen Auszug aus Gregors Schriften heraus und nahm darin mehr als zwanzig Stellen aus den Dialogen fast wörtlich auf. Taius von Saragossa, um 650, Ildefons von Toledo, gest. 667, Beda Venerabilis, Paulus Diakonus, Johannes Diakonus und das ganze Mittelalter kennen nur Gregor I. als Verfasser. Auch der Lehrinhalt der Dialoge stimmt mit dem der übrigen Schriften Gregors überein. Siehe dazu Näheres bei Migne P. L. LXXVII, 135. Auch der Stil ist gregorianisch, besonders in längeren Lehrabschnitten. Mitunter, besonders in den Erzählungen und kurzen Gesprächen nähert sich die Sprache mehr als sonst dem Vulgärlatein, eben weil Ereignisse aus dem Volke und von Leuten aus dem Volke erzählt werden. Man kann daraus erkennen, wie nahe Gregor dem Volke stand.
4. Die Form
Gregor wählte für seine Darstellung die Form des Dialoges. Sie war den Alten geläufig von den Dialogen der griechischen Philosophen her und nicht nur bei den griechischen, sondern auch bei den lateinischen Kirchenvätern beliebt; es seien nur genannt Chrysostomus De sacerdotio, Hieronymus Adversus Luciferianos und In Pelagianos, Augustinus De beata vita und De ordine, Sulpicius Severus zwei Dialoge zur vita des hl. Martinus, Der Dialog bietet durch Einreden und Fragen zwanglos Gelegenheit, um einzelne Gegenstände ausführlicher behandeln zu können, Digressionen einzuleiten und abzubrechen und um die Aufmerksamkeit der Leser stets wach zu halten. Gregor wählt zum fingierten Gesprächsgenossen seinen Diakon Petrus, der meist nur einfache Fragen stellt und durch seine Zwischenbemerkungen oft nur Übergänge bildet. Vielleicht ist Petrus, wie Dudden als sicher annimmt,4 der Repräsentant des Durchschnitts des damaligen Klerus mit seinen Bedenken und Fragen.
5. Inhalt und Zweck des Buches
Das wunderreiche Leben der ägyptischen und palästinensischen Mönche fand seine Erzähler in Rufinus, der zwischen 403 und 410 die lat. Vitae patrum verfaßte, und in Palladius, der 420 die Historia Lausiaca schrieb. Sulpicius Severus erzählte die Wundertaten des hl. Martinus in Gallien; sie wurden in den Klöstern vorgelesen5 und gingen in frommen Kreisen von Mund zu Mund. Dazu entstanden im ersten Viertel des 6. Jahrhunderts die Gesta Martyrum, die Gregor sicher nicht unbekannt blieben.6 Gregor nun wollte die Tugendbeispiele und Wundertaten von solchen heiligen Männern des 5. und 6. Jahrhunderts erzählen, die in Italien lebten und deren Ruf nur in einzelnen Klöstern, Städten und Gegenden, nicht aber im ganzen Lande bekannt war. Die Tugendbeispiele sollten die Leser zur Nachahmung aufmuntern, die Wunder aber sollten sie mit Vertrauen auf Gott erfüllen und unter all den Bedrängnissen der Zeit auf das Übernatürliche und Ewige hinweisen.
Aus dem Briefe an Maximian sehen wir, wie Gregor an die Sammlung des Stoffes heranging, und wir dürfen sicher annehmen, daß dies nicht der einzige derartige Brief war. Er ließ die heiligmäßigen Männer, von denen Wunderberichte im Umlauf waren, zu sich kommen, er ließ sich von anderen über Dinge berichten, die sie haben erzählen hören. Nie unterläßt Gregor beizufügen, daß die Väter einen heiligmäßigen, verehrungswürdigen Wandel führten, und nennt die Gewährsmänner, ebenfalls fromme, glaubwürdige Männer, wie Bischöfe, Äbte, Presbyter, Mönche, kirchliche und weltliche Beamte. Bei sechs Wundern war Gregor selbst Augenzeuge, III. Buch, Kap. 33 und 35; IV. Buch, Kap. 55.
So entstanden die vier Bücher der Dialoge. Das I. und III. erzählt in bunter Folge von verschiedenen heiligen Männern, das IV. beschäftigt sich mit dem Fortleben der Seele nach dem Tode und mit Visionen über bevorstehenden Tod oder über das Ableben verschiedener Personen. Das II. Buch ist ganz dem hl. Benediktus gewidmet. Mit besonderer Liebe und Sorgfalt trug Gregor diese Erzählungen zusammen und gestaltete sie so zur ersten Vita, zur ersten Biographie seines heiligen Ordensvaters, den er vor allen andern verehrte und nachahmte. Die Anschaulichkeit der Erzählung, aus der die warme Hingabe Gregors spricht, hat unzählige Künstler zu bildlichen Darstellungen veranlaßt, so daß wohl kaum ein Benediktinerkloster gefunden wird, in dem nicht Kirche oder Kreuzgang oder Refektorium an das II. Buch der Dialoge erinnern.
6. Die Wunderberichte
Gregor hat viel Kritik erfahren, weil er allzu leichtgläubig die Wunderberichte hingenommen habe. Wir tun aber wohl gut daran, nicht den Maßstab der heutigen Kritik anzulegen, sondern uns in die damalige aufgeregte zu Außerordentlichem geneigte Zeit zurückzuversetzen. Gregor ging ja auch nicht ohne prüfenden Sinn vor; so schickte er den Priester Amantius von Tivoli in ein Krankenhaus, um zu erproben, ob er wirklich die Gabe der Krankenheilung besitze, und erkundigte sich darauf bei Bischof Floridus, der dabei war, und beim Diener, der die Kranken pflegte.7 Es läßt sich nicht feststellen, ob und welche Irrtümer im einzelnen Falle bei der Wahrnehmung und bei der Weiterverbreitung des Vorgangs unterliefen. Gregor selbst glaubte an die Wunder und an charismatische Gaben; er hat den freudigen, festen Glauben wie die Männer der ersten Glaubenszeit. Seine Einstellung dazu erkennen wir deutlich aus seinen eigenen Worten: „Das ist Himmelszier, das sind die Gaben des Hl. Geistes, die sich in mannigfachen Wunderkräften kundtun, wie sie in unerforschlicher Weise verteilt sind, wie sie Paulus aufzählt: dem einen wird durch den Geist die Rede der Weisheit gegeben, dem andern die Rede der Wissenschaft nach demselben Geiste, einem andern Glaube in demselben Geiste, einem andern die Gnade zu Heilungen in demselben Geiste, einem andern Wirken von Wunderkräften, einem andern Weissagung, einem andern Unterscheidung der Geister, einem andern Sprachengaben, einem andern Auslegung von Reden.” (1 Kor 12, 8-10)8 „Laßt uns, wenn wir im Glauben versucht werden, die Wunder derer betrachten, die uns den Glauben gebracht haben, und wir werden im Glauben befestiget werden; denn ihre Wunder sind unsere Schutzwehr.”9 Die Wunder an den Märtyrergräbern sind Gregor ein Beweis für die Glorie, in der sich die Seelen der Märtyrer befinden.10 Die wunderbaren Heilungen und Totenerweckungen haben die leidende Menschheit zum Glauben gebracht.11 Den Wogen der Kirchenverfolgungen hat Gott heilige Männer entgegengestellt, durch deren Wunder der Wogenanprall wie durch feste Tore abgewehrt werden sollte.12 Die Wunderkräfte sind von Gott nur zur Festigung im Glauben und zum Heil für andere verliehen. Darum schreibt Gregor an Bischof Augustinus, den Missionär, der in England viele Wunderzeichen tat: „Gott wählte zu Glaubensboten Männer, die sich nicht in den Wissenschaften hervortaten, um der Welt zu zeigen, daß sie nicht infolge ihrer menschlichen Weisheit, sondern durch Gottes Kraft zur Bekehrung gelange. Das ist gerade wieder der Fall gewesen, als Er in England durch schwache Menschen Großes wirkte. Doch muß man, lieber Bruder, bei dieser Himmelsgabe trotz aller Freude in großer Furcht sein. Ich weiß nämlich, daß der allmächtige Gott unter dem Volke, das er erwählte, durch Dich große Wunderzeichen hat geschehen lassen. … Freue Dich, daß die Bewohner Englands durch Wunderzeichen zur Gnade geführt wurden; sei aber in Furcht, daß die Seele ob der Wunder, die sie tut, nicht überheblich werde!”13
7. Die Verbreitung
Die Dialoge nennt P. Anselm Manser eine Fortsetzung der „Väterleben”; sie waren für die Folgezeit bahnbrechend und Vorbild der Erzählungskunst.14 Wie kaum ein anderes Werk geben sie Einblick in das häusliche, soziale und religiöse Leben der nachrömischen Zeit. Sie erfreuten sich durch das ganze Mittelalter größter Beliebtheit und fanden die weiteste Verbreitung. Sie wurden unzählige Male abgeschrieben und gehörten zum unerläßlichen Bestand der Bibliotheken. Die Abgegriffenheit der Exemplare, die auf uns gekommen sind, zeigt, wie sehr sie benützt wurden. Als einziges Beispiel sei nur angeführt, was vom hl. Ulrich, Bischof von Augsburg, gest. 973, sein Biograph Gerhard schreibt: „Et post expletionem cursus et totius psalterii, legente Gerhardo praeposito, sacrorum lectiones librorum audivit… Lectiones vero fuerunt Vitas Patrum sanetorum et über S. Gregorii, quem dialogorum vocant.”15
8. Ausgaben und Übersetzungen. Literaturangabe
Hain führt in seinem Repertor. Bibliogr. 15 Wiegendrucke der lateinischen Dialoge auf. Von den neueren Ausgaben zeichnet sich aus die von Umberto Moricca, welche in vornehmer Ausstattung eine weitausgreifende Einleitung bietet und den Text nach der Schreibweise der ältesten italienischen Handschriften wiederherzustellen sucht.16
Übersetzt wurden die Dialoge schon frühe und oft. Papst Zacharias (741-752) übersetzte sie ins Griechische. Nach dieser Vorlage wurden sie von einem Mönch Antonius noch vor 800 ins Arabische übertragen.Alfred der Große ließ sie mit der Pastoralregel ungefähr 890 durch Bischof Waerferth von Worcester ins Angelsächsische übersetzen.Angier fertigte 1212 eine altfranzösische Übersetzung. Die Bibliothek von Monte Cassino bewahrt eine italienische Übersetzung aus dem 13. Jahrhundert. 1472, 1473, 1476 wurde in Augsburg eine deutsche Übersetzung gedruckt, der im Jahre 1571 die des Schweizers Adam Walasser, gedruckt in Dillingen, folgte. Sie fällt auf durch die Reinheit und den Fluß der Sprache.17 1475 war in Venedig die italienische Übersetzung des Lunardo da Udine erschienen, 1689 folgte eine französische. 1873 erschien in der Köselschen Bibliothek der Kirchenväter die Übersetzung des Benefiziaten Theodor Kranzfelder. Sie wurde wegen ihrer Genauigkeit der gegenwärtigen Arbeit zu Grunde gelegt.
Wie leicht erklärlich, hat das II. Buch, das Leben des hl. Benediktus, eigene Übersetzungen erfahren. So erschien eine solche 1701 unter dem Titel: Das Leben deß Heiligen Wunderthätigen und Weit berümbten Vatters Benedicti Von dem H. Pabst und Kirchenlehrer Gregorio M. beschrieben. Nun aber allen Liebhabern der Andacht zu nutz in teutsch übersetzt und in dieser zweyten Truck mercklich verbessert. Köllen bey Sebastiano Ketteler, Bibliopol. im Hanen vor S. Paulus. Anno 1701.
Abt Benedikt Sauter veröffentlichte 1904 bei Herder in Freiburg eine Übersetzung mit aszetischem Kommentar unter dem Titel: Der heilige Vater Benediktus nach St. Gregor dem Großen.
1929 erschien zum vierzehnhundertjährigen Jubiläum des Erzklosters Monte Cassino im Beuroner Kunstverlag als Prachtausgabe die 4. Auflage von P. Cornelius Kniel: Leben und Regel des heiligen Benediktus, mit einer Übersetzung der Dialoge.
Indem wir auf die allgemeine Literaturangabe zu Gregor in Bd. 4 verweisen, geben wir aus der reichen Literatur zu den Dialogen folgende Arbeiten an:
Merker Julius: Laut- und Formenlehre der altfranzösischen Dialoge Gregoire lo Pape. Bonn 1899. Dissertation.
Wiese Leo: Die Sprache der Dialoge des Papstes Gregor mit einem Anhang: Sermo de Sapientia und Moralium in Job fragmenta. Halle, Waisenhaus, 1899. Gekrönte Preisschrift.
Hecht Hans: Bischof Waerferths von Worcesters Übersetzung der Dialoge Gregors des Großen (Bibliothek der angelsächsischen Prosa, V, 2). Hamburg, Grand, 1907.
Günter H.: Legenden-Studien. Köln, 1906.
Delehaye, Die hagiographischen Legenden. 1907.
Reitzenstein Richard: Historia monachorum und Historia Lausiaca. Eine Studie zur Geschichte des Mönchtums und der frühchristlichen Begriffe Gnostiker und Pneumatiker. Göttingen, Vandenhoeck und Rupprecht (1916). (Forschungen zur Religion und Literatur des A. u. N. T. Neue Folge 7. Heft.)
Herwegen Ildefons, Abt: Der heilige Benedikt. Ein Charakterbild. Düsseldorf 1917.
Zu vorliegender Übersetzung diente die lateinische Ausgabe Migne, P. L. LXXVII (I., III. Und IV. Buch) und LXVI (II. Buch). Verschiedentlich wurden die Lesarten Moriccas verwendet.
Der Übersetzer versuchte das Original möglichst wortgetreu wiederzugeben und dabei den traulichen Charakter, die liebliche Farbe desselben samt allen seinen Umständlichkeiten zu wahren.
Dem Hochwürdigen Herrn Dr. P. Johannes E. Stöcckerl O.F.M. wird für Anfertigung des Registers aufrichtiger und herzlicher Dank ausgesprochen.
Fußnoten
1. Ep. Lib. III. 51, Migne P. L. LXXVII, 646
2. Vgl. hiezu die Einleitung zum I. Buch der Dialoge S. 1 ff.
3. Lib. Ep. V, 22, Migne P. L. LXXVII, 751
4. Dudden, Gregory the Great, London 1905, I. 324
5. Regel des hl. Benedikt, Kap. 42
6. Dufoucq A., Etudes sur les „Gesta martyrum” romains, Paris 1900
7. III Buch, 35. Kap.
8. Moral. lib. XVII, Kap. 31, Nr. 50, Migne, P. L. LXXVI, 35
9. Homil. In Ezech. III, 23, Migne, P. L. LXXVI, 972
10. Homil. In Evang. XXXIII, 6, Migne, P. L. LXXVI, 1237
11. Homil. In Evang. IV, 7, Migne, P. L. LXXVI, 1090
12. Moral. lib. XXVIII, 16. Migne. P. L. LXXVI, 469
13. Ep. lib. XI, 28, Migne, P. L. LXXVII. 1139
14. St.-Benediktus-Stimmen, 1918, S. 236
15. Mon. Germ. h. Ed. Pertz, Script, tom. IV, pag. 411
16. Umberto Moricca, Gregorii Magni Dialogi libri IV in: Fonti per la Storia d’Italia, publicate dall’Istituto Storico Italiano. Roma 1924. - Herrn Universitätsprofessor Dr. Johannes Zellinger in München schulde ich besonderen Dank dafür, daß er mich mit diesem schönen Werke bekannt machte.
17. Dialogi S. Gregorii Magni. Ein vast lustig und nutzlich Buch des heiligen Bapst und treflichen Kirchenlehrers Gregorii Magni, von dem Leben und Wunderwercken der Italienischen Vätter, auch von Unsterblichkeit der Seelen. In vier Bücher schier vor Tausent Jaren beschrieben, jetztunder aber auß dem Latein verteutscht und durch Adam Walasser in Truck geben. Getruckt zu Dillingen durch Sebaldum Mayer 1571.