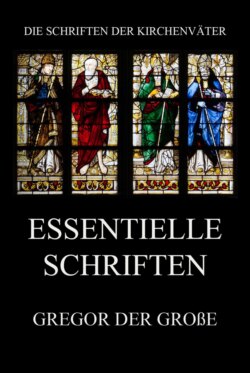Читать книгу Essentielle Schriften - Gregor der Große - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vier Bücher Dialoge Erstes Buch
Оглавление(Einleitung)
Eines Tages befand ich mich wegen des zu großen Ungestüms einiger Weltleute, denen wir in ihren Anliegen oft mehr leisten müssen, als wozu wir sicher verpflichtet sind, in großer Niedergeschlagenheit und suchte ein stilles, mit meinem Kummer vertrautes Gemach auf, wo mir alles, was mir an meiner Beschäftigung mißfiel, klar werden, und wo alles, was mich gewöhnlich schmerzte, in seiner Gesamtheit vor den Augen frei vorbeiziehen konnte. Nachdem ich lange, in stille Betrübnis versunken, so dagesessen hatte, trat mein lieber Sohn, der Diakon Petrus, ein, mein vertrauter Freund aus schöner Jugend frühesten Tagen und mein Genosse bei der Erforschung des göttlichen Wortes. Er sah, daß mein Inneres von großem Leid durchdrungen war, und sprach: Was ist dir denn Neues zugestoßen, daß du so ungewöhnlich traurig bist? Der Kummer, o Petrus, sagte ich, den ich Tag für Tag ertragen muß, ist mir ja altgewohnt, da ich ihn beständig fühle, und immer neu, da er beständig wächst. Meine arme, von der Arbeitslast verwundete Seele denkt zurück, wie glücklich sie einst im Kloster war, wie alles Hinfällige weit unter ihr lag, wie sie alles Wandelbare hoch überragte, wie sie nur an Himmlisches zu denken gewohnt war und wie sie, wenngleich im Körper zurückgehalten, doch die Grenzen des Fleisches in der Betrachtung überschritt, wie sie sogar den Tod, den doch fast alle als eine Strafe empfinden, lieb gewann als den Eingang zum Leben und als Lohn für ihre Mühen. Jetzt aber muß sie sich wegen des Hirtenamtes mit den Anliegen der Weltleute befassen und sich, nachdem sie eine so herrliche Ruhe genossen, mit dem Staube irdischer Beschäftigung bedecken lassen. Und wenn sie sich durch das Eingehen auf so viele Fragen nach außen zerstreut hat, kehrt sie, wenn sie wieder dem Innerlichen sich zuwendet, geschwächt zurück. So erwäge ich denn, was ich zu tragen habe, erwäge, was ich verlor, und wenn ich den Verlust ansehe, wird mir meine Last noch schwerer. Denn siehe, jetzt bin ich ein Spielball der Wellen eines weiten Meeres und werde in meinem Geistesschifflein von den Wogen eines heftigen Sturmes hin und her geworfen. Und wenn ich mich des früheren Lebens erinnere, ist es mir, als ob ich rückwärts blickte und aufseufzend nach dem Gestade schaute. Und was noch trauriger ist - während ich so von den ungeheuren Fluten dahingetrieben werde, kann ich den Hafen, den ich verlassen, kaum mehr sehen. Denn so pflegt es bei dem geistigen Verfall zu gehen, daß man zuerst zwar das innegehabte Gut verliert, sich aber des Verlustes noch erinnert, alsdann nach längerer Zeit das Gut selbst, das man verloren, aus dem Gedächtnis entschwinden läßt, so daß man schließlich nicht einmal mehr in der Erinnerung besitzt, was man ehedem in Wirklichkeit sein eigen nannte. Daher kommt es, daß wir, wie ich vorher sagte, nicht einmal mehr, sobald wir weiter hinausfahren, den Hafen der Ruhe sehen können, den wir verlassen haben. Bisweilen aber kommt zur Steigerung meines Schmerzes noch hinzu, daß mir das Leben einiger Männer ins Gedächtnis zurückgerufen wird, die der heutigen Welt ganz und gar Lebewohl gesagt haben. Wenn ich dann die Höhe, auf der diese Männer wandelten, betrachte, da erkenne ich, wie tief ich stehe. Die meisten von ihnen führten ganz im Verborgenen ein Gott wohlgefälliges Leben; damit ihr jugendfrischer Geist durch menschliche Geschäfte nicht alt werde, bewahrte sie der allmächtige Gott vor den Mühseligkeiten dieser Welt.
Doch ich vermag die gepflogene Unterhaltung besser wiederzugeben, wenn ich Rede und Gegenrede durch Anführung des Namens unterscheide.
Petrus. Mir ist wenig davon bekannt, daß das Leben einzelner Männer in Italien durch Tugenden geglänzt habe; ich kann mir also nicht denken, welche du da mit dir in Vergleich ziehst, so daß du ganz ins Feuer gerätst. Ich zweifle ja nicht daran, daß es hierzulande fromme Männer gegeben hat, glaube aber nicht, daß sie jemals Zeichen und Wunder getan haben, außer dies müßte bisher so mit Stillschweigen übergangen worden sein, daß wir davon gar nichts mehr wissen.
Gregorius. Ach, Petrus, ich glaube, der Tag würde eher zu Ende gehen als meine Erzählung, wenn ich nur das allein anführen wollte, was nur meine Wenigkeit in dieser Beziehung über vollkommene und bewährte Männer teils durch das Zeugnis frommer und glaubwürdiger Leute, teils durch eigene Wahrnehmung in Erfahrung gebracht hat.
Petrus. Da möchte ich dich freundlich bitten, mir einiges davon zu erzählen. Es scheint mir unbedenklich, aus diesem Anlaß die Schriftforschung zu unterbrechen, da die Erinnerung an Tugendbeispiele ebenso erbaulich ist. Denn bei der Schriftauslegung sehen wir, wie die Tugend erworben und bewahrt wird; aus der Erzählung der Wunder aber erkennen wir, wie die erworbene und bewahrte Tugend sich offenbart. Auch werden manche eher durch Beispiele als durch Lehren zur Liebe zum himmlischen Vaterlande entflammt. Es entspringt sogar in der Regel aus der Erzählung der Väterbeispiele für den Zuhörer ein doppelter Nutzen, insofern er nämlich durch den Vergleich mit den Vorfahren zur Liebe zum zukünftigen Leben angeeifert wird und zugleich in seiner Selbsteinschätzung sich gedemütigt findet, wenn er Größeres an anderen wahrnimmt.
Gregorius. Was mir von ehrwürdigen Männern mitgeteilt wurde, will ich ohne Zaudern wieder erzählen und stütze mich dabei auf ein Beispiel von heiligem Ansehen Es ist mir sonnenklar, daß Markus und Lukas ihr Evangelium nicht als Augenzeugen, sondern auf Grund dessen, was sie gehört, verfaßt haben. Doch gebe ich um den Lesern jeden Anlaß zum Zweifel zu nehmen, beiden einzelnen Berichten an, durch wen mir die Sache zugekommen ist. Das aber bitte ich dich zu beachten, daß ich mich bei einigen Erzählungen nur an den Sinn, bei anderen hingegen an Sinn und Wortlaut halte. Denn wollte ich bei allen Personen den Wortlaut genau beibehalten, so könnte die Schriftsprache das im Volksdialekt Erzählte nicht in geeigneter Weise wiedergeben. Es sind sehr ehrwürdige Greise, aus deren Munde ich vernommen, was ich nun berichte.
I. Kapitel: Von Honoratus,1 dem Abt des Klosters zu Fundi.2
Der Patrizier Venantius besaß einst in Samnium ein Landgut, dessen Pächter einen Sohn namens Honoratus hatte. Dieser entbrannte schon in den Knabenjahren infolge seiner Enthaltsamkeit von großer Liebe zur himmlischen Heimat. Er zeichnete sich durch seinen Wandel aus, unterdrückte jedes unnütze Wort und zügelte, wie schon erwähnt, durch Enthaltsamkeit sein Fleisch in hohem Grade. Da gaben seine Eltern eines Tages den Nachbarn ein Gastmahl, bei welchem auch Fleischspeisen aufgetragen wurden. Da nun der Heilige aus Liebe zur Enthaltsamkeit sich weigerte, diese Gerichte zu berühren, ergingen sich seine Eltern über ihn in Spottreden und sagten: „Iß doch, oder glaubst du etwa, wir könnten dir hier auf diesen Bergen einen Fisch vorsetzen?” In jener Gegend waren aber die Fische nur vom Hörensagen, nicht vom Sehen bekannt. Während nun Honoratus die Zielscheibe des Spottes war, ging auf einmal bei Tisch das Wasser aus; sogleich ging ein Sklave mit einem hölzernen Eimer, wie man sie dort benutzt, zur Quelle. Und während er Wasser schöpfte, schwamm ein Fisch in den Eimer hinein. Zurückgekehrt, goß der Sklave vor den Augen der Gäste auch den Fisch mit aus, der dem Honoratus zur Nahrung für einen ganzen Tag gereicht hätte. Alle gerieten darob in Verwunderung, und das ganze Spottgerede der Eltern hatte ein Ende. Sie ehrten nunmehr an Honoratus die Enthaltsamkeit, die sie vorher verlacht hatten; und so hat ein Bergfisch den Mann Gottes aus Spott und Hohn befreit. Da er immer mehr an Tugenden zunahm, wurde ihm von seinem oben genannten Herrn die Freiheit geschenkt. Er gründete darauf in Fundi ein Kloster, in welchem er ungefähr zweihundert Mönchen als Abt vorstand, und gab von dort aus im ganzen Umkreis das Beispiel eines außerordentlichen Tugendwandels. Eines Tages nämlich löste sich von dem Berge, der das Kloster hoch überragte, ein großes Felsstück los, das auf der abschüssigen Bergwand herunterrollte und das ganze Kloster samt allen Mönchen mit dem Untergang bedrohte. Als der Heilige den Stein herabkommen sah, rief er sogleich oft nacheinander den Namen Christi an, streckte seine Rechte aus, machte das Kreuzzeichen entgegen und hielt so den Stein an der steilen Berglehne fest, wie es Laurentius, ein frommer Mann, bezeugt. Und da keine Stelle da war, wo der Stein fest hätte aufliegen können, meint man heute noch beim Hinaufschauen, der Stein wolle herabstürzen.
Petrus. Hat wohl dieser ausgezeichnete Mann früher selbst, um später Schülern ein Lehrmeister zu werden, einen Lehrer gehabt?
Gregorius. Ich habe nie das Geringste davon gehört, daß er je eines anderen Schüler gewesen sei; doch die Gabe des Hl. Geistes unterliegt keinem Gesetze. Es gilt zwar im geistlichen Leben als Regel, daß keiner es wage, Vorsteher zu sein, der nicht gelernt hat, Untergebener zu sein, oder daß einer nicht von den Untergebenen Gehorsam verlange, den er nicht selbst den Oberen zu leisten weiß. Es gibt jedoch manche, die innerlich so durch die Schule des Hl. Geistes unterwiesen werden, daß ihnen trotz des äußeren Mangels einer menschlichen Schule die Eigenschaft eines innerlichen Lehrers nicht abgeht; doch darf dieser freie Zug im Leben solcher Männer nicht von Schwachen nachgeahmt werden, damit nicht jeder wähne, er sei vom Hl. Geiste erfüllt, und es so verschmäht, eines Menschen Schüler zu sein und dafür ein Lehrer des Irrtums wird. Eine Seele aber, die des göttlichen Geistes voll ist, trägt klare Anzeichen an sich, Tugendkraft nämlich und Demut. Finden sich beide in vollkommenem Grade in einer Seele vereinigt, legen sie ohne Zweifel Zeugnis ab von der Gegenwart des Hl. Geistes. So liest man auch nichts davon, daß Johannes der Täufer einen Lehrmeister gehabt habe. Auch hat die Wahrheit selbst, die in leiblicher Gegenwart die Apostel lehrte, ihn dem Leibe nach nicht den Jüngern beigesellt; sie unterwies ihn vielmehr auf innerliche Art und überließ ihn sozusagen nach außen seiner Freiheit. So wurde Moses in der Wüste von einem Engel geleitet und erhielt von ihm, nicht von einem Menschen, seine Weisung.3 Doch soll, wie gesagt, dies für die Schwachen ein Gegenstand der Verehrung, nicht der Nachahmung sein.
Petrus. Was du sagst, ist sehr schön; aber bitte, sage mir auch, ob dieser große Abt auch einen Schüler hinterließ, der in seine Fußstapfen trat!
II. Kapitel: Von Libertinus, dem Prior4 jenes Klosters
Gregorius. Libertinus, ein gar ehrwürdiger Mann, der zur Zeit des Gotenkönigs Totila Prior des Klosters zu Fundi war, lebte und erhielt seine Ausbildung unter der Leitung des Honoratus. Obwohl schon vielerseits seine zahlreichen Wundertaten erzählt und verbreitet wurden, berichtete mir doch der erwähnte fromme Laurentius, der noch am Leben ist und ehedem sehr vertraut mit dem Heiligen war, vieles von ihm. Aus dem, was ich davon in Erinnerung habe, will ich einiges erzählen.
Er machte einmal in der oben genannten Provinz Samnium für das Kloster eine Reise. Da kam der Gotenanführer Darida mit seinem Heere desselben Weges, und dessen Leute rissen den Diener Gottes vom Reitpferde herab. Er ertrug willig den Verlust des Tieres und gab den Plünderern auch noch die Peitsche, die er in der Hand hielt, mit den Worten: „Nehmet sie nur, damit ihr doch etwas habet, um das Pferd antreiben zu können!” So wie er dies gesagt, begann er zu beten. In eiligem Ritte kam die Schar des Anführers an einen Fluß mit Namen Vulturnus. Sie stießen dort mit den Lanzen auf die Pferde ein und verwundeten sie mit den Sporen bis aufs Blut. Die Pferde wurden durch die Stöße und Verwundungen zwar erschöpft, waren aber nicht von der Stelle zu bringen; sie fürchteten sich, ins Wasser zu gehen, wie vor einem tödlichen Sprung. Als nun die Reiter selbst vom langen Zuschlagen müde waren, bemerkte einer aus ihnen, daß sie wegen der Unbill, die sie dem Diener Gottes unterwegs zugefügt hätten, jetzt auf dem Marsche so aufgehalten würden. Sie kehrten sogleich zurück und fanden Libertinus im Gebete auf den Boden hingestreckt. Sie sagten zu ihm: „Stehe auf und nimm dein Pferd wieder!” Er aber antwortete: „Gehet in Frieden, ich habe das Pferd nicht nötig!” Da saßen sie ab, hoben ihn wider seinen Willen auf das Pferd, von dem sie ihn heruntergezogen hatten, und ritten eiligst von dannen. Ihre Pferde gingen nun so leicht über den Fluß, den sie vorher nicht hatten überschreiten können, wie wenn das Flußbett ohne Wasser gewesen wäre. So wurde also dadurch, daß der Diener Gottes sein Pferd zurückerhielt, einem jeden von ihnen das seinige wiedergegeben.
Zur selben Zeit fiel Buccelinus5 mit seinen Franken in Kampanien ein. Über das Kloster unseres Dieners Gottes ging das Gerücht, daß es viel Geld besitze. Die Franken drangen deshalb in die Kirche ein, suchten wütend nach Libertinus und schrien immer „Libertinus!” gerade da, wo dieser betend am Boden lag. Ein wahrhaft wunderbarer Vorgang: Die Franken suchen und wüten, dringen ein, stoßen schon auf der Schwelle auf ihn und können ihn doch nicht sehen. So wurden sie in ihrer Blindheit irregeführt und kehrten mit leeren Händen wieder um.
Ein andermal wieder reiste er in Sachen des Klosters und im Auftrage des Abtes, der seines Lehrers Honoratus Nachfolger war, nach Ravenna. Aus Liebe zu diesem ehrwürdigen Honoratus pflegte Libertinus überall, wohin er ging, einen Schuh desselben bei sich zu tragen. Während er so des Weges zog, siehe, da brachte eine Frau den Leichnam ihres Sohnes daher. Als sie den Diener Gottes sah, loderte die Liebe zu ihrem Kinde aufs neue auf, und sie ergriff sein Pferd am Zügel und beschwor ihn: „Oh, du darfst mir nicht weiterziehen, ehe du meinen Sohn wieder lebendig gemacht hast!” Es schien ihm ein solches Wunder zu außerordentlich, und er erschrak über ihre Bitte. Er wollte der Frau ausweichen; da ihm dies aber nicht gelang, wußte er nicht, was er tun sollte. Nun können wir uns vorstellen, welch ein harter Streit in seiner Seele entstand. Denn hier stritten miteinander die Demut seines Wandels und das Mitleid mit der Mutter; auf der einen Seite die Angst, er könnte sich etwas Ungewohntes anmaßen, auf der andern Seite der Schmerz, er müsse der armen Frau seine Hilfe versagen. Aber zur größeren Ehre Gottes gewann das Mitleid den Sieg über das tugendhafte Herz, das gerade dadurch sich stark erwies, daß es sich besiegen ließ; denn es wäre kein tugendhaftes Herz gewesen, wenn es dem Mitleid nicht nachgegeben hätte. So stieg er also ab, kniete nieder, erhob seine Hände gegen den Himmel, nahm dann den Schuh aus seinem Busen und legte ihn dem toten Knaben auf die Brust. Und während er betete, kehrte die Seele des Knaben in den Körper zurück. Er nahm ihn bei der Hand und gab ihn der weinenden Mutter lebend zurück. Hierauf setzte er seinen Weg fort.
Petrus. Was sollen wir nun dazu sagen? Wirkte dieses Wunder das Verdienst des Honoratus oder das Gebet des Libertinus?
Gregorius. Bei diesem großen Wunder traf mit dem Glauben der Frau der beiden Männer Wunderkraft zusammen, und darum glaube ich, Libertinus habe deshalb solches vermocht, weil er gelernt hatte, mehr auf die Kraft des Meisters als auf seine eigene zu bauen. Indem er nämlich dem toten Knaben den Schuh des Honoratus auf die Brust legte, dachte er, daß dessen Seele die Erhörung seiner Bitte erlangen werde. Denn auch Elisäus trug den Mantel seines Meisters, kam an den Jordan und schlug damit einmal in das Wasser, aber es teilte sich nicht. Doch als er gleich darauf sagte: „Wo ist denn jetzt der Gott des Elias?”6 und den Fluß mit dem Mantel des Meisters schlug, da bahnte er einen Weg mitten durch das Wasser. Siehst du nun, Petrus, wieviel bei Wunderzeichen die Demut vermag? Dann erst konnte er des Meisters Kraft ausüben, als er dessen Namen nannte. Denn dadurch, daß er zur Demut gegen den Meister zurückkehrte, konnte er tun, was der Meister getan.
Petrus. Jetzt verstehe ich; doch, ich bitte, weißt du noch mehr von ihm zu unserer Erbauung zu erzählen?
Gregorius. Gewiß, vorausgesetzt, daß es Nachahmer findet. Denn ich für meinen Teil schätze die Tugend der Geduld höher als Zeichen und Wunder. Eines Tages also wurde der Amtsnachfolger des ehrwürdigen Honoratus gegen unsern ehrwürdigen Libertinus sehr zornig, so zwar, daß er ihn mit den Händen schlug. Da er keinen Stock zum Schlagen finden konnte, griff er nach einem Fußschemel und schlug ihn damit auf den Kopf und in das Gesicht, so daß das ganze Antlitz geschwollen und blau wurde. Stillschweigend suchte Libertinus, so übel er zugerichtet, sein Lager auf. Es war aber auf den andern Tag in einer Klostersache gerichtlicher Termin anberaumt. Darum begab sich Libertinus nach der Matutin an das Bett des Abtes und bat demütig um den Segen. Da aber der Abt wußte, wie sehr Libertinus von allen geehrt und geliebt wurde, glaubte er, derselbe wolle wegen der Unbill, die er ihm zugefügt hatte, das Kloster verlassen. Deshalb forschte er näher nach und fragte: „Wohin willst du denn gehen?” Libertinus antwortete: „Vater, es ist für das Kloster ein gerichtlicher Termin angesetzt, von dem ich nicht wegbleiben kann; da ich gestern versprochen habe, heute zu kommen, will ich jetzt hingehen.” Da erkannte der Abt vom Grunde des Herzens sein hartes und liebloses Verhalten sowie die Demut und Sanftmut des Libertinus, sprang vom Lager auf, umschlang seine Füße und bekannte, daß er gesündigt und gefehlt habe, indem er einem so großen und heiligen Mann eine so arge Kränkung anzutun wagte. Aber auch Libertinus fiel nieder und warf sich ihm zu Füßen mit der Beteuerung, nicht durch den Zorn des Abtes, sondern durch seine eigene Schuld sei ihm eine solche Behandlung widerfahren. Auf diese Weise wurde der Abt zu großer Sanftmut geführt, und die Demut des Jüngers ward so zur Meisterin des Lehrmeisters. Als er nun aufs Gericht ging, sahen viele bekannte und adelige Männer, die ihn sehr verehrten, mit Verwunderung sein geschwollenes und blauunterlaufenes Gesicht und erkundigten sich angelegentlich, was es denn damit für eine Bewandtnis habe. „Gestern abend”, sagte er ihnen, „stieß ich wegen meiner Sünden an einen Fußschemel und zog mir dieses zu.” So wahrte der Heilige in seinem Herzen die Ehre der Wahrheit sowohl als die Ehre seines Meisters, indem er einerseits des Abtes Fehler nicht verriet, anderseits keiner Unwahrhaftigkeit sich schuldig machte.
Petrus. Hat wohl dieser ehrwürdige Libertinus, von dem du so viele Zeichen und Wunder erzählt hast, in der ausgedehnten Kongregation keine Nachahmer seiner Tugenden hinterlassen?
III. Kapitel: Von dem Bruder Gärtner des nämlichen Klosters
Gregorius. Felix7 mit dem Beinamen der Krumme, den du selbst gut kennst, und der noch vor kurzem Prior des dortigen Klosters war, hat mir viel Wunderbares von den Mönchen jenes Klosters erzählt. Es fällt mir manches davon ein, ich muß es aber übergehen, da ich zu etwas anderem zu kommen trachte. Doch eine Begebenheit, die er mir erzählte, darf ich nicht verschweigen.
In jenem Kloster war ein heiligmäßiger Mönch Gärtner. Es kam aber regelmäßig ein Dieb, stieg über den Zaun und trug heimlich Gemüse davon. Da nun der Gärtner vieles pflanzte, was der Dieb weniger leicht hätte finden sollen, und er dennoch einen Teil davon zertreten, den andern gestohlen sah, ging er den ganzen Garten ab und fand endlich die Stelle, wo der Dieb immer hereinkam. Als er nun weiter im Garten auf und ab ging, fand er eine Schlange und sagte zu ihr: „Komm mit mir!” An der Stelle angelangt, wo der Dieb hereinkam, sagte er zur Schlange: „Im Namen Jesu befehle ich dir, daß du mir auf diese Stelle acht habest und keinen Dieb hereinkommen lassest!” Sogleich legte sich die Schlange der Länge nach quer über den Weg, während der Mönch in seine Zelle zurückkehrte. Als nun alle Brüder zur Mittagszeit ihre Ruhe hielten, kam wie gewöhnlich der Dieb und kletterte über den Zaun; als er seinen Fuß in den Garten setzen wollte, sah er plötzlich, daß eine langgestreckte Schlange ihm den Weg versperrte. Vor Schrecken fiel er rücklings herab und blieb mit seinem Schuh an einem Zaunpfahl hängen. So mußte er mit dem Kopfe nach abwärts hängen bleiben, bis der Gärtner wieder kam. Zur gewohnten Stunde kam dieser und sah den Dieb an dem Zaune hängen. Zur Schlange sprach er: „Gott sei Dank! Du hast deine Sache gut gemacht, jetzt gehe wieder!”, und sogleich entfernte sie sich. Alsdann trat er an den Dieb heran und sagte zu ihm: „Was ist das, Bruder? Gott hat dich mir in die Hände gegeben. Warum hast du es gewagt, der Mönche Arbeit so oft zu bestehlen?” Unterdessen machte er seinen Fuß vom Zaune, wo er hängen geblieben war, los und stellte ihn unverletzt auf den Boden. Mit den Worten: „Folge mir!” führte er ihn zur Gartentüre und gab ihm mit großer Güte und Freundlichkeit soviel Gemüse, als er hatte heimlich nehmen wollen, und sagte: „Gehe nun hin und stiehl in Zukunft nicht mehr. Solltest du etwas notwendig haben, so komme hier zu mir herein, und mit Freuden will ich dir geben, was du sonst nur unter einer Sünde und mit großer Mühe wegnehmen könntest.
Petrus. Ich war bis jetzt, wie ich sehe, ganz ohne Grund, der Meinung, daß es in Italien keine Väter gegeben habe, die Wunderbares taten.
IV. Kapitel: Von Equitius,8 Abt in der Provinz Valeria9
Gregorius. Was ich jetzt erzähle, erfuhr ich von dem ehrwürdigen Fortunatus, Abt des Klosters Balneum Ciceronis,10 sowie aus dem Munde einiger anderer ehrwürdiger Männer.
Im Gebiete der Provinz Valeria lebte ein heiligmäßiger Mann namens Equitius, der dort, wie es sein Leben verdiente, allgemeine Bewunderung genoß, und zu dem Fortunatus in freundschaftlichen Beziehungen stand. Equitius war wegen seiner großen Heiligkeit erklärlicherweise der Abt über viele Klöster der dortigen Provinz. Er wurde in seiner Jugend von sinnlichen Lockungen aufs heftigste angefochten, und gerade diese schweren Versuchungen führten ihn zu besonders eifriger Pflege des Gebetes. Als er nun unablässig Gott den Allmächtigen anflehte, er möge ihm in dieser Bedrängnis zu Hilfe kommen, hatte er einmal in der Nacht ein Gesicht, als ob ein Engel zu ihm träte und er verschnitten würde. In dieser Erscheinung zeigte es sich an, daß ihm jede sinnliche Regung benommen wurde. Von jener Zeit an war er so von allen Versuchungen frei, als ob er dem Leibe nach kein Geschlecht hätte. Im Vertrauen auf diese wunderbare Hilfe des allmächtigen Gottes unternahm er es, ähnlich wie er bisher Männer geleitet, so auch Frauen vorzustehen. Er unterließ es aber niemals, seine Jünger zu mahnen, daß sie nicht in dieser Sache wegen seines Beispiels zu leicht auf sich selbst vertrauen, und zu ihrem Falle sich eine Kraft zuschreiben sollten, die sie nicht empfangen hätten.
In jener Zeit wurden hier in Rom die Zauberer gefänglich eingezogen. Damals flüchtete sich Basilius, ein Hauptmagier, in einem Mönchshabit in die Valeria. Er begab sich zum hochwürdigsten Bischof Castorius von Amiternum11 und bat ihn, er möge ihn dem Abt Equitius zuweisen und zur Aufnahme in sein Kloster empfehlen. Da begab sich nun der Bischof ins Kloster, brachte den Basilius als Mönch mit sich und ersuchte den Diener Gottes Equitius, diesen Mönch in sein Kloster aufnehmen zu wollen. Kaum hatte jedoch der heilige Mann ihm ins Antlitz gesehen, so sprach er: „Den du mir da empfiehlst, Vater, der ist, ich sehe es, kein Mönch, sondern ein Teufel.” Da entgegnete der Bischof: „Du suchst nur einen Vorwand, mir meine Bitte abschlagen zu können.” Darauf erwiderte der Diener Gottes: „Ich bezeichne ihn als das, als was ich ihn sehe. Doch damit du nicht meinst, ich wolle dir nicht gehorchen, erfülle ich deinen Wunsch.” Basilius wurde also ins Kloster aufgenommen. Nach einigen Tagen entfernte sich der Diener Gottes etwas weiter vom Kloster, um die Gläubigen zu himmlischen Begierden zu ermahnen. In seiner Abwesenheit verfiel in dem Frauenkloster, das unter seiner Leitung stand, eine der Frauen, die dem verweslichen Fleische nach schön aussah, in ein heftiges Fieber. Sie hatte große Beklemmungen und stieß mehr knirschend als rufend hervor: „Ich muß auf der Stelle sterben, wenn nicht der Mönch Basilius kommt und mich durch seine Heilkunst wieder gesund macht.” Keiner von den Mönchen jedoch durfte es wagen, in Abwesenheit des Heiligen das Frauenkloster zu betreten, am wenigsten jener Neueingetretene, dessen Lebenswandel die Kongregation noch nicht kannte. Man sandte eilends einen Boten ab und ließ dem Diener Gottes Equitius sagen, daß jene Klosterfrau an einem ungemein heftigen Fieber erkrankte und daß sie sehnlichst nach einem Besuche des Mönches Basilius verlange. Als der Heilige dies hörte, lächelte er abweisend und sagte: „Habe ich nicht gesagt, daß dieser ein Teufel ist und kein Mönch? Gehet und jaget ihn aus dem Kloster! Wegen der Dienerin Gottes aber, die durch ein heftiges Fieber beängstiget wird, beunruhigt euch nicht weiter, denn sie wird von dieser Stunde an kein Fieber mehr haben und nicht mehr nach Basilius verlangen.” Der Mönch kehrte zurück und erfuhr, daß die gottgeweihte Jungfrau zur selben Stunde gesund wurde, zu welcher es der Diener Gottes Equitius in weiter Ferne gesagt hatte. Bei diesem Wunder folgte der Heilige dem Beispiele des göttlichen Meisters, der zum Sohne des königlichen Beamten gebeten wurde und ihn durch das Wort allein gesund machte,12 so daß der Vater bei seiner Rückkehr erfuhr, daß sein Sohn zu der gleichen Stunde dem Leben wiedergegeben worden war, zu welcher er dies aus dem Munde der ewigen Wahrheit vernommen hatte. Die Mönche kamen aber alle sogleich dem Befehle des Abtes nach und verstießen den Basilius aus der Klosterbehausung. Nach seiner Vertreibung aus dem Kloster erzählte er, er habe oft die Zelle des Equitius in die Lüfte erhoben, ohne jemandem darin ein Leid antun zu können. Nicht lange darnach wurde er hier in Rom, als das christliche Volk gegen ihn aufgebracht wurde, verbrannt.
Eines Tages begab sich eine Dienerin Gottes aus demselben Frauenkloster in den Garten und sah dort eine Salatstaude. Sie wollte davon essen, vergaß aber, sie mit dem Kreuzzeichen zu segnen, und biß gierig hinein. Augenblicklich wurde sie vom bösen Feinde ergriffen und stürzte zu Boden. Da sie heftige Schmerzen litt, benachrichtigte man eilends den Abt Equitius, damit er komme und ihr durch sein Gebet helfe. Kaum hatte der Abt den Garten betreten, so schrie schon der böse Geist, der sie ergriffen hatte, wie zu seiner Entschuldigung aus ihrem Munde: „Was habe ich denn getan? Was habe ich denn getan? Ich saß ruhig auf der Salatstaude, sie kam und hat mich gebissen.” Mit großer Entrüstung befahl ihm der Mann Gottes, er solle weichen und nicht länger in der Dienerin des allmächtigen Gottes verweilen. Er entwich sofort und konnte ihr nichts mehr anhaben.
Ein Edelmann aus der Provinz Nursia, der Vater jenes Castorius, der sich jetzt bei uns in Rom aufhält, sah, daß der ehrwürdige Equitius, ohne eine heilige Weihe empfangen zu haben, von Ort zu Ort eilte und mit Eifer das Predigtamt ausübte. Eines Tages nun wagte er es, ihn freundschaftlicherweise darüber zu befragen und sagte: „Du hast keine heilige Weihe und hast auch vom römischen Oberhirten, unter dem du stehst, keine Vollmacht zu predigen erhalten, wie getraust du dich dennoch zu predigen?” Der Heilige sah sich durch diese Frage gezwungen, zu offenbaren, auf welche Weise er die Erlaubnis zu predigen bekommen hatte, und sagte: „Oft muß ich selbst über das, was du sagst, nachdenken. Aber es erschien mir einmal in der Nacht ein schöner Jüngling, der legte ein Aderlaßmesser auf meine Zunge und sagte: ‘Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund; ziehe aus zu predigen!’ Und von jenem Tage an kann ich nicht mehr von Gott schweigen, selbst wenn ich wollte.”
Petrus. Da möchte ich erst ein Wunderwerk von diesem Abte hören, wenn er schon solche Gnadengaben empfangen hat.
Gregorius. Das Wunderwerk, Petrus, kommt von der Gnadengabe, nicht die Gnadengabe von dem Wunderwerk, sonst wäre die Gnade nicht mehr Gnade. Denn jedem Werke gehen Gnaden voraus, wenn auch allerdings die Gnadengaben durch die nachfolgenden Werke neues Wachstum empfangen. Damit du jedoch nicht ohne Kenntnis von seinem Lebenswandel bist, so wisse, daß der hochwürdigste Bischof Albinus von Reate13 ihn gut kannte und daß noch viele leben, die ihn kennen konnten. Warum fragst du aber noch nach einem Wunderwerk, da doch die Reinheit seines Lebens mit seinem Predigteifer übereinstimmte? Denn er besaß einen so großen Eifer, Gott Seelen zu gewinnen, daß er neben der Leitung der Klöster noch die Kirchen, Städte und Dörfer und die Häuser der Gläubigen im ganzen Umkreis besuchte und in den Herzen seiner Zuhörer die Liebe zum himmlischen Vaterlande entzündete. Dabei war er so armselig gekleidet und war so unscheinbar in seinem Auftreten, daß man ihm, wenn man ihn etwa nicht kannte, nicht einmal den Gruß erwidern mochte, So oft er sich nach auswärts begab, ritt er das schlechteste von allen Tieren, das im Kloster zu finden war; dabei benützte er die Halfter als Zaumzeug und ein Hammel feil als Sattel. Die heiligen Bücher führte er an seinem eigenen Leibe mit sich und trug sie rechts und links in Taschen aus Fell; sowie er irgendwo hinkam, erschloß er den Quell der heiligen Schriften und bewässerte die geistigen Gefilde. Natürlich drang die Kunde von seinen Predigten auch nach Rom; und wie nun einmal die Schmeichlerzunge die Seele dessen, der ihr sein Ohr leiht, zu umgarnen und zu töten weiß, so beklagten sich damals die Kleriker dieses apostolischen Stuhles schmeichlerischer Weise beim Papste und sagten: „Wer ist denn dieser Bauer, der die Befugnis zu predigen sich herausnimmt und das Amt unseres apostolischen Herrn sich anzumaßen wagt, ohne daß er etwas gelernt hat? Man soll darum, wenn es so beliebt, jemand hinschicken und ihn hierher bringen lassen, damit er einen Begriff von Kirchenzucht bekomme!” Wie nun in der Regel die Schmeichelei bei einem vielbeschäftigten Geiste sehr leicht Eingang findet, wenn sie nicht schon an der Schwelle des Herzens schleunigst abgewiesen wird, so stimmte der Papst dem Rat der Kleriker bei, daß man den Equitius nach Rom bringen müsse, damit er lerne, was sich für ihn gezieme. Er betraute mit dieser Sendung den damaligen Defensor14 Julianus, der später Bischof von Sabina wurde, trug ihm jedoch auf, den Diener Gottes auf sehr ehrenvolle Weise hierherzuführen und ihm aus dem Beschluß keinerlei Kränkung entstehen zu lassen. Um den Wunsch der Kleriker bezüglich des Equitius zu erfüllen, brach er eilends nach dessen Kloster auf. Der Gesuchte war gerade nicht zu Hause. Julianus fand aber die Bücherschreiber über ihrer Arbeit und erkundigte sich, wo der Abt sei. Sie sagten: „Dort unten im Tal, unterhalb des Klosters, mäht er Gras.” Es hatte aber Julianus einen sehr hochmütigen und trotzigen Diener, über den er oft selbst kaum Herr werden konnte. Diesen also schickte er fort, den Equitius so schnell wie möglich herbeizuholen. Der Diener machte sich auf den Weg und betrat keck und eiligen Schrittes die Wiese. Er musterte mit seinem Blicke alle Mäher und fragte, wer von ihnen Equitius sei. Kaum aber hatte er gehört, welcher es sei, und ihn von weitem angesehen, ergriff ihn eine ungeheure Furcht, und es befiel ihn ein Zittern und eine solche Schwäche, daß er sich schwankenden Fußes kaum aufrecht halten konnte. Zitternd nahte er sich dem Manne Gottes, umfing demütig unter Küssen seine Knie und meldete ihm, daß sein Herr zu ihm gekommen sei. Der Diener Gottes erwiderte seinen Gruß und befahl ihm: „Nimm von dem frischen Gras und füttere damit die Tiere, auf denen ihr hergeritten seid! Ich werde, da nur mehr wenig steht, die Arbeit vollenden und dann nachkommen.” Der Defensor Julianus wunderte sich gar sehr, daß sein Diener so lange nicht zurückkehrte. Doch endlich, sieh, da sah er ihn kommen und Gras von der Wiese dahertragen. Darob wurde er sehr aufgeregt und herrschte ihn an: „Was ist denn das? Ich habe dich fortgeschickt, den Mann zu bringen, und nicht Gras!” Der Diener antwortete darauf: „Siehe, der, den du suchst, kommt nach mir gegangen.” Da kam der Mann Gottes, mit genagelten Stiefeln angetan und mit der Sense auf der Schulter. Als er noch weit entfernt war, zeigte der Diener auf ihn und sagte seinem Herrn, dieser sei es, den er suche. Auf den ersten Anblick dachte Julianus gering von dem Diener Gottes wegen seines Äußeren und legte sich hochfahrend schon die Worte zurecht, mit denen er ihn anreden wollte. Der Diener Gottes war aber kaum näher gekommen, da befiel Julianus auch schon ein unerträglicher Schrecken, so daß er zitterte und kaum das Wort finden konnte, um zu sagen, wozu er gekommen sei. Gedemütigten Sinnes fiel er ihm zu Füßen, bat ihn um sein Gebet und berichtete, sein apostolischer Vater, der Papst, trage Verlangen, ihn zu sehen. Equitius, der ehrwürdige Mann, sprach dafür Gott, dem Allmächtigen, unendlichen Dank aus und versicherte, in dem Papste habe ihn die göttliche Gnade einer Heimsuchung gewürdigt. Auf der Stelle berief er die Brüder zu sich, ließ in derselben Stunde noch die Reittiere in Bereitschaft setzen und drängte seinen Exekutor energisch zu augenblicklicher Abreise. Julianus aber wendete ein: „Das geht nicht an, denn ich bin noch müde von der Reise und kann heute nicht mehr aufbrechen.” Darauf erwiderte Equitius: „Ach, du machst mich traurig, mein Sohn, denn wenn wir heute nicht mehr fortgehen, kommen wir auch morgen nicht mehr zur Abreise.” So verblieb also der Diener Gottes, durch die Müdigkeit seines Exekutors genötigt, diese Nacht noch in seinem Kloster. Aber siehe! Am folgenden Tage kam beim Morgengrauen auf einem durch den Ritt ganz abgehetzten Pferde ein Diener mit einem Brief zu Julianus; in dem Briefe wurde ihm aufgetragen, den Diener Gottes nicht zu belästigen und ihn nicht vom Kloster fortzunehmen. Als nun Julianus fragte, warum der Auftrag geändert worden sei, erfuhr er, daß in derselben Nacht, in der er als Exekutor abgeschickt wurde, der Papst durch eine Erscheinung lebhaft darüber in Schrecken versetzt worden sei, daß er sich unterfangen habe, den Mann Gottes herbeiholen zu lassen. Sogleich erhob sich Julianus, empfahl sich in das Gebet des ehrwürdigen Mannes und sagte: „Unser Vater bittet, ihr sollet euch nicht weiter mehr bemühen.” Als der Diener Gottes dies vernahm, wurde er traurig und sagte: „Habe ich es dir nicht gestern gesagt, daß wir überhaupt nicht reisen dürfen, wenn wir nicht sogleich aufbrechen?” Darnach hielt er seinen Exekutor zum Erweise der Gastfreundschaft noch eine Weile im Kloster zurück und nötigte ihn trotz seines Sträubens einen Lohn für seine Bemühung anzunehmen. Erkenne also, Petrus, wie sehr diejenigen unter dem Schutze Gottes stehen, die gelernt haben, in diesem Leben sich selbst gering zu achten; welches Reiches Bürgern diejenigen in Ehren innerlich beigezählt werden, die sich nichts daraus machen, nach außen vor den Menschen gering zu scheinen, daß dagegen in den Augen Gottes diejenigen wenig gelten, welche in ihren eigenen Augen und vor den Augen der Mitmenschen aus eitler Ruhmsucht sich groß tun! Darum gilt gar manchen das Wort der ewigen Wahrheit: „Ihr rechtfertiget euch wohl vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen; denn was hoch ist vor den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott.”15
Petrus. Ich muß mich sehr darüber wundern, daß einem so großen Papste dieser Irrtum über den großen Mann unterlaufen konnte.
Gregorius. Wie kannst du dich wundern, Petrus, daß wir irren, da wir doch Menschen sind? Oder hast du vergessen, daß David, der doch sonst den Geist der Weissagung hatte, den unschuldigen Sohn des Jonathas bestrafte, nachdem er den Worten eines lügnerischen Dieners Gehör geschenkt hatte?16 Wir glauben zwar, daß die Bestrafung nach einem verborgenen Urteil Gottes gerecht war, weil sie von David so verhängt wurde, mit unserer menschlichen Vernunft jedoch können wir nicht begreifen, wie sie sich rechtfertigen ließ. Weshalb sich also wundern, wenn wir durch Lügenreden manchmal auf Irrwege geführt werden, da wir doch keine Propheten sind? Sehr zu beachten ist, daß die Überlast der Sorgen den Geist eines jeden Vorgesetzten beschwert. Und wenn die Seele sich in vieles teilen muß, nimmt ihre Kraft für das einzelne ab, und um so eher entgeht ihr etwas in irgendeiner Sache, je weitläufiger sie sich mit vielem befassen muß.
Petrus. Das ist sehr richtig, was du sagst.
Gregorius. Ich darf nicht verschweigen, was ich über diesen Mann von meinem ehemaligen hochwürdigsten Abt Valentinus erfahren habe. Der Leib des Equitius wurde nämlich in der Kirche des hl. Märtyrers Laurentius beigesetzt; da stellte einmal ein Bauersmann, ohne zu bedenken, welch ein großer und würdiger Mann hier begraben liege, und ohne sich zu scheuen, eine Truhe voll Getreide auf das Grab. Plötzlich kam dann vom Himmel her ein Sturmwind, hob die Truhe, die auf dem Grabe stand, in die Höhe, und schleuderte sie, während alle anderen Dinge fest auf ihrem Platze blieben, weit weg, so daß alle deutlich erkennen konnten, wie groß das Verdienst dessen sein müsse, der hier begraben lag.
Auch das Ereignis, das ich noch anfüge, erfuhr ich von dem genannten ehrwürdigen Mann Fortunatus, den ich wegen seines Alters, seiner Tugenden und seiner Einfalt sehr lieb habe. Als nämlich die Langobarden in die Provinz Valeria einfielen, flüchteten sich die Mönche aus dem Kloster des hochwürdigsten Mannes Exquitius zu seinem Grabe in der vorher erwähnten Kirche. Die Langobarden drangen in ihrer Wut in das Gotteshaus ein und schleppten die Mönche heraus, um sie entweder zu foltern oder mit dem Schwerte zu töten. Da jammerte einer von ihnen und rief, von heftigen Schmerzen ergriffen: „Ach, ach, heiliger Equitius, hast du denn ein Wohlgefallen daran, daß wir fortgeschleppt werden, und verteidigest du uns nicht?” Auf diese Worte hin fuhr sogleich ein unreiner Geist in die wütenden Langobarden. Sie stürzten zu Boden und wurden so lange gequält, bis sie alle, auch jene Langobarden, welche vor der Kirche sich befanden, erkannten, daß sie den heiligen Ort nicht länger entehren dürften. Wie nun der heilige Mann hier seine Jünger in Schutz nahm, so hat er auch nachher vielen, die dorthin ihre Zuflucht nahmen, Hilfe geleistet.
V. Kapitel: VonKonstantius,17 dem Mesner an der Kirche des hl. Stephanus
Die folgende Erzählung verdanke ich einem meiner Mitbischöfe, der viele Jahre in der Stadt Ankona als Mönch zubrachte und dort ein Klosterleben von nicht gewöhnlicher Frömmigkeit führte. Mit ihm stimmen auch einige ältere Leute unter uns überein, die aus jener Gegend stammen. In der Nähe jener Stadt also liegt eine Kirche zum seligen Märtyrer Stephanus, an der ein Mann von ehrwürdigem Wandel namens Konstantius das Amt eines Mesners versah. Der Ruf seiner Heiligkeit war weit und breit zu den Leuten gedrungen, da er die irdischen Dinge von Grund aus verachtete und mit aller Kraft der Seele nur nach dem Himmlischen verlangte. Da nun eines Tages in jener Kirche das Öl ausging und dem Diener Gottes nichts zu Händen war, womit er die Ampeln hätte anzünden können, füllte er alle Ampeln in der Kirche mit Wasser und tat wie gewöhnlich den Papyrusdocht hinein; darauf nahm er Feuer und zündete die Ampeln an, und das Wasser brannte in den Ampeln wie Öl. Stelle dir also vor, Petrus, wie reich an Verdiensten der Mann gewesen sein muß, der im Notfalle die Natur eines Elementes verwandeln konnte!
Petrus. Das ist sehr wunderbar, was ich da höre; ich möchte aber gern wissen, wie demütig dieser Mann in seinem Innern sein konnte, der nach außen hin so glänzte.
Gregorius. Mit Recht forschest du bei Wunderwerken nach dem Zustand der Seele, weil es gar oft vorkommt, daß die Wunderdinge, die nach außen hin geschehen, innerlich die Seele in ihrer Art in Versuchung führen. Wenn du aber auch nur Eines hörst, das dieser ehrwürdige Konstantius vollbracht hat, so wirst du sogleich sehen, wie demütig er war,
Petrus. Nachdem du mir ein solches Wunder von ihm erzählt hast, mußt du mich auch noch mit seiner Seelendemut erbauen.
Gregorius. Da der Ruf von seiner Heiligkeit sehr groß geworden war, hatten viele Leute aus verschiedenen Gegenden das sehnlichste Verlangen, ihn zu sehen. Eines Tages kam nun ein Bauersmann von weither, um ihn zu sehen. Es traf sich zufällig, daß der heilige Mann zur selben Stunde gerade auf einer hölzernen Leiter stand und die Ampeln richtete. Er war aber sehr klein, schmächtig und unansehnlich von Gestalt. Der Bauer, der ihn sehen wollte, erkundigte sich nach ihm und bat dringend, man möge ihm denselben zeigen; solche, die den heiligen Mann kannten, taten es dann. Doch wie törichte Menschen die Verdienste nach der Beschaffenheit des Körpers bemessen, so konnte der Bauer beim Anblicke des kleinen und unansehnlichen Männleins gar nicht glauben, daß dieser es sei. In seinem bäuerlichen Kopfe entstand so gewissermaßen ein Widerstreit zwischen dem, was er gehört hatte, und dem, was er sah, und er meinte, so klein könne der nicht aussehen, den er sich so ganz groß vorgestellt hatte. Allein, da ihm alle versicherten, dieser sei es, so lachte und spottete er über ihn und sagte: „Ich hatte ihn mir als einen großen Mann vorgestellt, aber dieser hat ja gar nichts von einem Manne an sich.” Als der Mann Gottes Konstantius dies hörte, ließ er voll Freude die Ampeln, die er richtete, stehen, stieg eilends herab, umarmte den Bauer und drückte ihn in großer Liebe an sich; er küßte ihn und sagte ihm vielmals Dank dafür, daß er so über ihn geurteilt habe, „denn du allein”, sagte er, „hast offene Augen für mich gehabt.” Aus diesem Vorgang müssen wir abnehmen, wie demütig der in seinem Innern war, der den Bauer trotz seiner abfälligen Bemerkung nur um so mehr liebte. Denn eine Beleidigung bringt es an den Tag, wie einer im Herzen beschaffen ist. Wie nämlich die Stolzen über Ehrenbezeigungen sich freuen, so freuen sich die Demütigen über Kränkungen. Wenn sie sich auch in den Augen anderer gering geschätzt sehen, so freuen sie sich, weil sie das Urteil bestätigt sehen, das sie selbst über sich fällen.
Petrus. Dieser Mann war wirklich, wie ich sehe, groß nach außen in seinen Wundern, aber größer noch im Innern durch die Demut seines Herzens.
VI. Kapitel: Von Marcellinus,18 Bischof der Stadt Ankona
Gregorius. Dieselbe Stadt Ankona besaß einen Bischof von ehrwürdigem Lebenswandel namens Marcellinus. Das Podagra halte seine Füße ganz zusammengezogen, so daß ihn seine Hausgenossen je nach Wunsch da und dorthin auf den Händen tragen mußten. Eines Tages nun geriet die Stadt Ankona durch Fahrlässigkeit in Brand. Das Feuer wurde immer größer, und alles lief zusammen, um zu löschen. Aber obwohl man wie um die Wette Wasser hineinschleuderte, loderten die Flammen so gewaltig empor, daß der ganzen Stadt der Untergang drohte. Während das Feuer überall rings um sich griff und schon einen beträchtlichen Teil der Stadt eingeäschert hatte und niemand mehr ihm Einhalt gebieten konnte, erschien der Bischof, von den Seinigen auf den Händen herbeigetragen; tief ergriffen von der großen Gefahr und Bedrängnis, befahl er den Trägern: „Setzet mich gerade vor das Feuer!” Das geschah, und sie setzten ihn dahin, wo die ganze Gewalt des Brandes hinzudrängen schien. Wunderbarerweise schlugen jetzt die Flammen in sich zusammen, wie wenn sie dadurch die Ablenkung des Ansturms ausdrücken und sagen wollten, über den Bischof könnten sie nicht hinwegschreiten. So geschah es, daß der Feuersbrunst an jener Stelle Einhalt getan wurde, sie in sich selbst erlosch und weiter kein Haus mehr zu ergreifen wagte. Siehst du, Petrus, von welcher Heiligkeit es zeugt, daß ein kranker Mann sich hinsetzt und durch sein Gebet eine Feuersbrunst zurückdrängt?
Petrus. Ja, ich sehe es und staune.
VII. Kapitel: Von Nonnosus,19 Prior des Klosters auf dem Berg Sorakte
Gregorius. Jetzt will ich dir von einem benachbarten Orte etwas erzählen, was ich vom Bischof Maximianus, einem ehrwürdigen Mann, und von Laurio, einem bejahrten Mönche, den du kennst, erfahren habe, die beide noch leben. Dieser Laurio wurde nämlich in einem Kloster, das bei der Stadt Nepeta20 liegt und Suppentonia21 heißt, von Anastasius, einem überaus heiligen Manne, erzogen. Dieser ehrwürdige Mann Anastasius stand mit Nonnosus, dem Prior des Klosters auf dem Berge Sorakte, sowohl wegen der Nachbarschaft als auch wegen seiner Seelengröße und wegen des Strebens nach Tugend in innigster Beziehung. Der genannte Nonnosus lebte in seinem Kloster unter einem äußerst strengen Abte, ertrug aber dessen Charakter stets mit einem wunderbaren Gleichmut; er selbst war den Brüdern ein milder Oberer und besänftigte oft in Demut des Abtes Jähzorn. Da aber das Kloster zu oberst auf dem Gipfel des Berges lag, blieb den Brüdern kein ebener Platz mehr, auch nicht für den kleinsten Garten. Ein kleines Plätzchen wäre an der Seite des Berges noch vorhanden gewesen, aber dieses nahm ein sehr großer, aus dem Boden herausragender Stein ein. Einmal dachte der ehrwürdige Nonnosus darüber nach, daß diese Stelle sich dazu eignen würde, wenigstens das Gewürz für das Gemüse zu bauen, wenn der Fels nicht da wäre; er sah aber sogleich ein, daß wohl fünfzig Paar Ochsen den Felsen nicht von der Stelle bringen könnten. Da also menschliche Bemühung hier nichts vermochte, suchte er himmlische Hilfe und begab sich dort in der Stille der Nacht ins Gebet. Und als die Brüder am Morgen herauskamen, sahen sie, daß der große Felsblock weiter weg gerückt war und den Brüdern einen schönen, freien Platz gelassen hatte.
Wieder ein anderes Mal war es, daß der ehrwürdige Mann in der Kirche die gläsernen Ampeln reinigte; eine fiel ihm dabei aus den Händen und zersprang in tausend Stücke. Aus Furcht vor dem heftigen Zorn des Klosterabtes las er alle Scherben zusammen, legte sie vor dem Altar nieder und begann unter schwerem Seufzen zu beten. Als er darnach das Haupt vom Gebete erhob, fand er die Ampel, deren Stücke er unter Ängsten zusammengelesen hatte, wieder ganz. So ahmte er also in zwei Wundern zweier Väter Wunderwerke nach: beim Felsblock das Wunder Gregors, der einen Berg versetzte, bei der Wiederherstellung der Ampel ein Wunder des Donatus,22 der einen zerbrochenen Kelch wieder unversehrt herstellte.
Petrus. Wir haben, wie ich sehe, neue Wunder nach alten Beispielen.
Gregorius. Willst du nun davon etwas hören, wie Nonnosus in seinem Wirken auch den Elisäus nachahmte?
Petrus. Ja freilich, ich bin vor Neugier ganz gespannt.
Gregorius. Einmal ging im Kloster das alte Öl aus; es war zwar die Zeit der Olivenernte nahe, aber auf den Ölbäumen sah man keine Früchte. Deshalb beschloß der Klosterabt, daß die Brüder sich in der Umgegend bei der Olivenernte verdingen sollten, damit sie so als Lohn für ihre Arbeit ein wenig Öl ins Kloster brächten. Der Ausführung dieses Auftrages widersetzte sich aber der Mann Gottes Nonnosus in aller Demut, damit nicht die Brüder durch ihre Abwesenheit vom Kloster an ihrer Seele Schaden litten, während sie Öl verdienen sollten. Da man aber nun doch auf den Bäumen des Klosters einige wenige Oliven fand, befahl er sie abzunehmen und in die Presse zu tun, das Öl aber sollten sie, wie wenig es auch sein mochte, zu ihm bringen. So geschah es; die Brüder fingen das Öl in einem kleinen Schüsselchen auf und brachten es dem Diener Gottes Nonnosus. Dieser stellte es vor dem Altar nieder, ließ alle aus der Kirche sich entfernen und betete. Hierauf ließ er die Brüder wieder hereinkommen und befahl ihnen, das Öl, das sie gebracht hatten, fortzunehmen und davon ein klein wenig in alle Gefäße des Klosters zu gießen, nur damit der Segen des Öls hineingegossen erscheine. Darnach ließ er alle diese leeren Gefäße verschließen. Als man sie aber am andern Tag wieder öffnete, waren alle voll Öl.
Petrus. Wir erfahren wirklich täglich, wie sich das Wort der ewigen Wahrheit erfüllt, die da sagt: „Mein Vater wirket bis jetzt, und ich wirke auch.”23
VIII. Kapitel: Von Anastasius,24 Abt des Klosters Suppentonia25
Gregorius. Zu derselben Zeit war der vorher erwähnte ehrwürdige Anastasius Notar der heiligen römischen Kirche, der ich nach Gottes Ratschluß diene. Da er sich Gott allein widmen wollte, verließ er den Aktenschrank, wählte sich ein Kloster und verlebte an dem schon genannten Ort, der Suppentonia hieß, viele Jahre unter heiligen Werken und stand dem Kloster in emsiger Wachsamkeit vor. Diesen Ort überragt ein mächtiger Fels, während nach unten sich ein gewaltiger Abgrund auftut. In einer Nacht nun, da Gott der Allmächtige bereits beschlossen hatte, den ehrwürdigen Anastasius für seine Mühen zu belohnen, ertönte hoch vom Felsen herab eine Stimme, welche in langgezogenem Tone rief: „Anastasius, komm!” Nach ihm wurden noch sieben andere Brüder mit Namen genannt. Während einer kleinen Pause schwieg die Stimme und nannte darauf einen achten Bruder. Dem Konvent, der die Stimme deutlich vernahm, stand es unbezweifelbar fest, daß für die Genannten das Ende herangekommen sei. Wirklich starb der ehrwürdige Anastasius innerhalb weniger Tage; die übrigen wurden in der Reihenfolge, in der ihre Namen von dem Gipfel des Felsens herab gerufen worden waren, aus dem Leben hinweggenommen. Der Bruder aber, bei dessen Namen die Stimme zuerst etwas innehielt und ihn erst dann nannte, überlebte die Sterbenden um einige Tage und segnete dann das Zeitliche; damit wurde deutlich erwiesen, daß das Schweigen der Stimme eine kurze Lebensfrist bedeutet hatte. Aber noch etwas Wunderbares trug sich zu. Als nämlich der ehrwürdige Anastasius verschied, befand sich im Kloster ein Bruder, der ohne ihn nicht länger leben wollte. Er warf sich zu seinen Füßen nieder und flehte ihn unter Tränen an: „Ich beschwöre dich bei demjenigen, zu dem du gehst, laß mich nicht länger als sieben Tage nach dir auf dieser Welt zurück!” Auch dieser starb noch vor Ablauf des siebenten Tages, obwohl er in jener Nacht nicht mit den übrigen genannt worden war. Daraus erhellt klar, daß sein Tod nur durch die Fürbitte des ehrwürdigen Anastasius erlangt wurde.
Petrus. Da dieser Bruder nicht mit den anderen genannt wurde, sondern auf die Fürbitte des Heiligen aus diesem Lichte hinweggenommen wurde, was anders bleibt da noch übrig als anzunehmen, daß verdienstvolle Heilige bei Gott manchmal etwas erlangen können, was nicht vorher bestimmt ist?
Gregorius. Nein, sie können keineswegs etwas erlangen, was nicht vorausbestimmt ist, sondern das, was die heiligen Männer durch ihr Gebet erreichen, ist eben in der Weise vorausbestimmt, daß es erst durch Gebete erlangt werden soll. Denn auch selbst die Vorherbestimmung des ewigen Lebens ist von Gott so getroffen, daß die Auserwählten durch ihre Anstrengung zu demselben gelangen sollen, insofern sie so durch ihr Gebet verdienen, was der allmächtige Gott ihnen von Ewigkeit her zu schenken beschlossen hat.
Petrus. Ich bitte, lege mir noch deutlicher dar, wie die Vorherbestimmung durch Gebet unterstützt werden kann.
Gregorius. Was ich sagte, Petrus, läßt sich schnell beweisen. Du weißt nämlich sicherlich, daß der Herr zu Abraham sprach: „Nach Isaak wird dein Same genannt werden.”26 Er sagte auch zu ihm: „Ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht.”27 Und wiederum gab er ihm die Verheißung: „Ich will dich segnen und deinen Samen mehren wie die Sterne des Himmels und wie den Sand, der am Ufer des Meeres ist.”28 Daraus erhellt offenbar, daß Gott der Allmächtige beschlossen hatte, den Samen Abrahams durch Isaak zu vermehren, und dennoch steht geschrieben: „Und Isaak flehte zu dem Herrn für sein Weib, weil es unfruchtbar war: und er erhörte ihn und ließ Rebekka empfangen.”29 Wenn nun aber die Vermehrung von Abrahams Geschlecht durch Isaak vorherbestimmt war, warum bekam er eine Unfruchtbare zur Frau? Es geht doch daraus klar hervor, daß die Vorherbestimmung durch Gebet zur Wirklichkeit wird, wenn derjenige, in dem Gott den Samen Abrahams vermehren wollte, durch Gebet Nachkommen erlangt.
Petrus. Da die Begründung das Dunkel aufhellte, bleibt mir kein Zweifel mehr übrig,
Gregorius. Soll ich dir nun etwas aus dem Gebiet von Tuscien erzählen, damit du siehst, welche Männer dort gelebt haben und wie nahe sie der Erkenntnis Gottes waren?
Petrus. Ja, ich wünsche es und bitte sehr darum.
IX. Kapitel: Von Bonifatius, 30 Bischof der Stadt Ferentino.
Gregorius. Es lebte ein ehrwürdiger Mann namens Bonifatius, der in der Stadt Ferentino das bischöfliche Amt inne hatte und dasselbe ganz mit seinen Tugenden umgab. Viele Wunder erzählt von ihm der Presbyter Gaudentius, der noch lebt. Er wuchs unter seiner Leitung heran und kann um so getreuer alles von ihm erzählen, als er alles miterleben durfte. Auf seiner Kirche lastete eine große Armut, welche für gute Seelen eine Wächterin der Demut zu sein pflegt. Er besaß als ganzes Einkommen nichts anderes als einen einzigen Weinberg, und dieser wurde einmal durch einen Hagel derart verwüstet, daß nur an wenigen Stöcken einige kleine und ärmliche Trauben zurückblieben. Als hierauf der genannte Gottesmann, der hochwürdigste Bischof Bonifatius, in seinen Weinberg kam, sagte er Gott dem Allmächtigen vielmals Dank, weil er sich auch noch in seiner Dürftigkeit eine Beschränkung auferlegt sah. Als dann die Zeit kam, wo die noch hängen gebliebenen Weintrauben reiften, bestellte er wie sonst einen Wächter für den Weinberg und trug ihm auf, ihn mit aller Sorgfalt zu bewachen. Eines Tages befahl er dann seinem Neffen, dem Presbyter Konstantius, er solle alles Weingeschirr des bischöflichen Hauses und alle Fässer, wie man es früher tat, auspichen und in Bereitschaft setzen. Als dies sein Neffe, der Presbyter, vernahm, verwunderte er sich aufs höchste über den fast unsinnigen Befehl, Weingeschirre herzurichten, da man doch keinen Wein bekam; er wagte aber nicht, nach dem Grunde dieses Auftrags zu fragen, sondern gehorchte und richtete alles wie sonst zurecht. Alsdann begab sich der Diener Gottes in den Weinberg, nahm die Lese bei den wenigen Trauben vor und tat sie in die Kelter; er ließ dann alle Anwesenden hinausgehen und blieb allein mit einem kleinen Knaben zurück, den er in die Kelter stellte und die ganz wenigen Trauben keltern ließ. Als aus denselben ein wenig Wein floß, fing der Mann Gottes ihn eigenhändig in einem kleinen Gefäß auf und verteilte ihn, wie um einen Segen auszuteilen, in alle Fässer und bereitstehenden Geschirre, so daß die Gefäße alle kaum etwas von dem Wein angefeuchtet schienen. Nachdem er so von dem Wein eine Kleinigkeit in alle Gefäße gegossen hatte, rief er den Presbyter und ließ die Armen holen. Da begann der Wein in der Kelter sich zu vermehren, so daß er alle Geschirre, welche die Armen mitgebracht hatten, anfüllen konnte. Als er sah, daß er diese befriedigt hatte, ließ er den Knaben aus der Kelter steigen, schloß den Weinkeller zu, versiegelte ihn und kehrte zur Kirche zurück. Am dritten Tage rief er den Presbyter Konstantius zu sich, schloß nach einem Gebete den Weinkeller auf und fand die Gefäße, in welche er ein kleinwenig von der Flüssigkeit gegossen hatte, so sehr vom Weine überlaufen, daß der sich vermehrende Wein den ganzen Boden bedeckt hätte, wenn der Bischof noch etwas später gekommen wäre. Hernach verbot er dem Presbyter aufs strengste, irgend jemandem, so lange er lebe, etwas von diesem Wunder zu erzählen. Er befürchtete nämlich, er möchte von der Menschengunst wegen dieses Wunders so hoch erhoben werden, daß er innerlich gerade dadurch Schaden nehmen könnte, wodurch er nach außen vor den Menschen so groß erschien. Er wollte hierin auch dem Beispiele des Meisters folgen, der, um uns den Weg der Demut zu zeigen, hinsichtlich seiner selbst den Jüngern befahl, das Geschaute niemandem zu erzählen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei.
Petrus. Da sich gerade Gelegenheit bietet, möchte ich fragen, was es damit für eine Bewandtnis hat, daß unser Erlöser den zwei Blinden, denen er das Augenlicht wieder schenkte, zwar befahl, niemandem etwas davon zu sagen, daß diese aber dennoch hingingen und es im ganzen Lande verbreiteten. Sollte etwa der eingeborene Sohn Gottes, gleichewig mit dem Vater und mit dem Heiligen Geiste, in diesem Falle etwas gewollt haben, was er nicht ausführen konnte, so daß das Wunder, das er verschwiegen haben wollte, nicht verborgen bleiben konnte?
Gregorius. Unser Erlöser hat alles, was er in seinem sterblichen Leibe tat, uns als ein Beispiel für unser Handeln aufgestellt, so daß wir nach dem Maße unserer Kraft in seine Fußstapfen treten und ohne anzustoßen den Lebensweg, der jetzt unsere Aufgabe ist, wandeln können. Er wirkte das Wunder und befahl darüber Schweigen zu beobachten, und doch konnte es nicht verschwiegen bleiben, damit auch seine Auserwählten, welche seinem Beispiele und seiner Lehre folgen, bei ihren Großtaten zwar gerne verborgen bleiben möchten, wider ihren Willen aber zum Frommen anderer in ihren Wundern bekannt würden. So ist es einerseits große Demut, daß sie ihre Werke verborgen halten wollen, andererseits ein großer Nutzen, daß ihre Werke nicht verschwiegen bleiben können. Der Herr wollte also keineswegs etwas, was er nicht ausführen konnte, sondern was seine Glieder für einen Willen haben sollen und was dennoch mit ihnen wider ihren Willen geschieht, das hat er uns durch sein Beispiel gelehrt.
Petrus. Die Erklärung gefällt mir.
Gregorius. Wir müssen noch einige Begebenheiten aus dem Wirken des Bischofs Bonifatius anführen, nachdem wir einmal seiner Erwähnung getan haben. Ein anderes Mal nämlich nahte der Tag der Gedächtnisfeier des seligen Märtyrers Prokulus heran. Ein Adeliger namens Fortunatus, der an jenem Orte wohnte, bat den ehrwürdigen Mann inständig, er möge, wenn er bei dem seligen Märtyrer das Hochamt halte, zu einer Erquickung bei ihm zukehren. Der Mann Gottes konnte das nicht abschlagen, um was ihn die Liebe aus dem Herzen des Fortunatus ersuchte. Nachdem also das Hochamt zu Ende war, ging er bei Fortunatus zu Tisch. Doch ehe er noch Gott das Lobgebet sprechen konnte, erschien ein Mann mit einem Affen unter der Türe und schlug die Zimbel, wie eben manche als Spielleute sich den Unterhalt zu verschaffen pflegen. Als der Heilige diesen Laut vernahm, entrüstete er sich und sprach: „Ach, ach, dieser Arme ist tot, dieser Arme ist tot! Ich bin zu Tisch gekommen, um mich zu erquicken, und ich habe den Mund noch nicht zum Lobe Gottes auftun können, da kommt schon dieser mit seinem Affen und schlägt die Zimbel!” Er setzte jedoch hinzu: „Gehet und gebt ihm zu essen und zu trinken, wie es die Liebe erfordert; wisset aber, daß er tot ist.” Als der unglückselige Mann Brot und Wein vom Hause erhalten hatte und zur Türe hinausgehen wollte, fiel plötzlich ein großer Stein vom Dache und traf ihn mitten auf den Kopf. Er wurde von diesem Schlage zu Boden geschleudert, und als man ihn aufhob, war er schon halbtot und beschloß den andern Tag, wie es der Mann Gottes gesagt hatte, vollends sein Leben. Bei diesem Fall, Petrus, legt sich die Erwägung nahe, daß man heiligen Männern eine sehr große Ehrfurcht entgegenbringen muß; denn sie sind Tempel Gottes. Und wenn ein Heiliger zum Zorn gereizt wird, wer anders wird da zum Zorn herausgefordert als der Bewohner dieses Tempels? Um so mehr also ist der Zorn der Gerechten zu fürchten, als in ihrem Herzen, wie wir wissen, derjenige zugegen ist, den nichts hindert, Rache zu nehmen, wie er will.
Ein anderes Mal verkaufte sein Neffe, der schon erwähnte Presbyter Konstantius, sein Pferd um zwölf Goldstücke, legte das Geld in seine Truhe und ging fort, um ein Geschäft zu besorgen. Da kamen unmittelbar darauf Arme zur bischöflichen Wohnung und baten ungestüm, der heilige Bischof Bonifatius solle ihnen zur Linderung ihrer Not etwas schenken. Da aber der Mann Gottes nichts zum Verteilen hatte, regte er sich in Gedanken darüber auf, daß die Armen mit leeren Händen von ihm fortgehen sollten. Da fiel ihm ein, daß sein Neffe, der Presbyter Konstantius, sein Reitpferd verkauft und den Erlös dafür in seiner Truhe liegen hatte. In Abwesenheit des Neffen machte er sich also über die Truhe, brach in frommer Gewalttätigkeit das Schloß auf, nahm die zwölf Goldstücke heraus und verteilte sie nach seinem Belieben unter die Armen. Als nun der Presbyler Konstantius von seinem Gange zurückkehrte, traf er die Truhe erbrochen an und fand den Erlös für sein Pferd, den er hineingelegt hatte, nicht mehr vor. Da schlug er einen großen Lärm auf und schrie in heftigem Zorn: „Alle läßt man hier leben, nur ich kann in diesem Hause nicht leben!” Auf dieses Geschrei kamen der Bischof und alle Bewohner des bischöflichen Hauses herbei. Der Mann Gottes wollte ihn durch sanftes Zureden beschwichtigen, jener aber machte ihm Vorwürfe und sagte: „Alle läßt du mit dir leben, nur ich allein kann es bei dir nicht aushalten; gib mir mein Geld zurück!” Auf diese Worte hin begab sich der Bischof in die Kirche der seligen allzeit jungfräulichen Maria, erhob seine Hände, zog dabei das Gewand über den Armen auseinander und betete stehend, sie möge ihm doch etwas geben, womit er die Erregung des Presbyters beschwichtigen könne. Und als sein Blick auf das Gewand zwischen seinen ausgestreckten Armen fiel, bemerkte er dort plötzlich zwölf Goldstücke, die glänzten, als ob sie soeben aus dem Feuer gekommen wären. Er verließ die Kirche, warf das Geld dem zornigen Presbyter in den Schoß und sagte: „Siehe, da hast du das Geld, das du verlangt hast, aber das sollst du dir merken, daß du, wenn ich einmal gestorben bin, wegen deines Geizes nicht Bischof an dieser Kirche werden wirst!” Aus dieser Äußerung schließt man, daß der Presbyter das Geld zurücklegen wollte, um damit die Bischofswürde zu erlangen. Das Wort des Mannes Gottes hatte Bestand, denn Konstantius beschloß sein Leben als Presbyter.
Einmal kamen zwei Goten zu ihm, um seine Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen, und sagten, sie wären auf der Reise nach Ravenna. Er schenkte ihnen mit eigener Hand ein kleines hölzernes Fäßchen, das mit Wein gefüllt war, damit sie sich dessen etwa bei der Mahlzeit auf der Reise bedienen könnten. Die Goten aber tranken aus demselben, bis sie nach Ravenna kamen. Sie hielten sich einige Tage in jener Stadt auf und genossen alle Tage von dem Weine, den sie von dem heiligen Manne bekommen hatten. Und so kamen sie auf dem Rückweg wieder nach Ferentino zu dem ehrwürdigen Vater, ohne daß sie einen Tag mit dem Trinken aufgehört hätten, und doch ging der Wein in dem kleinen Fäßchen nicht aus, gerade als ob in dem hölzernen Fäßlein, dem Geschenk des Bischofs, der Wein nicht so fast sich vermehrt hätte, als vielmehr darin gewachsen wäre.
Neulich kam aus jener Gegend ein Priestergreis zu mir, der Dinge von dem Heiligen erzählte, die wir nicht mit Stillschweigen übergehen dürfen. Er erzählte nämlich, daß derselbe einmal, als er in seinen Garten ging, diesen ganz von Raupen bedeckt fand. Da er sah, wie alles Gemüse zugrunde gerichtet wurde, wandte er sich zu den Raupen und sprach: „Ich beschwöre euch im Namen des Herrn, unseres Gottes Jesu Christi, gehet weg von hier und verzehret mir dieses Gemüse nicht!” Sofort machten sie sich alle auf das Wort des Mannes Gottes davon, so daß auch nicht eine innerhalb des Gartens zurückblieb. Doch, was ist daran Wunderbares, daß wir solche Dinge aus der Zeit seines bischöflichen Amtes erzählen, als er in den Augen des allmächtigen Gottes schon durch seine Weihe und durch sein Amt groß dastand, da die Wundertaten noch viel größer sind, die dieser Priestergreis von ihm erzählt, da er noch ein kleiner Knabe war? Er erzählt nämlich, daß er zur Zeit, wo er noch als Knabe bei seiner Mutter weilte, wenn er von zu Hause fortging, manchmal ohne Hemd, oft auch ohne Rock heimkam, denn so oft er einen Nackten traf, bekleidete er ihn; er entblößte sich selbst, um sich in den Augen Gottes mit dem Lohn dafür zu bekleiden. Die Mutter zankte ihn deshalb oft; denn es sei, sagte sie, nicht recht, daß er, obwohl selber notleidend, an die Armen seine Kleider verschenke. Eines Tages betrat sie ihre Scheune und fand, daß alles Getreide, das sie sich als Lebensunterhalt für das ganze Jahr aufgehoben hatte, von ihrem Sohne an die Armen verteilt worden war. Während sie nun aus Schmerz, daß sie den Unterhalt für fast ein ganzes Jahr verloren, sich Backenstreiche gab und sich mit den Fäusten in das Gesicht schlug, kam der Knabe Gottes, Bonifatius, dazu und wollte sie trösten, so gut er konnte. Da sie sich aber gar nicht trösten ließ, bat er sie, sie möge aus der Scheune hinausgehen, in welcher von allem Getreide nur spärliche Reste zurückgeblieben waren. Sogleich begab sich dort der Knabe Gottes ins Gebet. Nach kurzer Zeit ging er hinaus und führte die Mutter wieder in die Scheune, die nun so voll von Getreide war, wie sie es früher nicht gewesen war, als sie sich über den eingeernteten Bedarf für ein ganzes Jahr gefreut hatte. Beim Anblick dieses Wunders ging die Mutter in sich und drängte nun selbst den Knaben, der so schnell Erhörung seines Gebetes finden konnte, zum Almosengeben. Sie hielt sich in ihrem Hof räum auch Hühner; es kam aber ein Fuchs vom nahen Felde und holte sie nach und nach. Während nun eines Tages der Knabe in dem Hofe stand, kam wieder der Fuchs und holte ein Huhn. Schnell ging er in die Kirche, warf sich zum Gebete nieder und sprach laut: „Gefällt es dir, o Herr, daß ich von dem, was sich die Mutter zieht, nichts zu essen bekomme? Denn siehe, die Hühner, die sie zieht, verzehrt der Fuchs.” Darnach erhob er sich vom Gebete und verließ die Kirche. Alsbald kam der Fuchs zurück, ließ das Huhn, das er in der Schnauze trug, los und fiel vor seinen Augen tot zu Boden.
Petrus. Es ist sehr wunderbar, daß Gott sich würdigt, die Gebete derer, die auf ihn hoffen, auch in geringen Dingen zu erhören.
Gregorius. Das geschieht, Petrus, nach weiser Einrichtung unseres Schöpfers, damit wir wegen des Kleinen, das wir erhalten, Großes erhoffen sollen; der heilige und einfältige Knabe fand nämlich deshalb in geringen Dingen Erhörung, damit er vom Kleinen lerne, wieviel er von Gott bei großen Bitten erwarten dürfe.
Petrus. Es gefällt mir, was du sagst.
X. Kapitel: Von Fortunatus,31 dem Bischof von Todi
Gregorius. Noch ein anderer Mann von ehrwürdigem Lebenswandel befand sich in jener Gegend, Fortunatus mit Namen, Bischof der Kirche von Todi. Dieser besaß eine immense Kraft und Gnade in Austreibung der bösen Geister, so daß er manchmal aus den Besessenen Legionen von Dämonen austrieb und durch ununterbrochenen Gebetseifer ganze Scharen derselben, wenn sie sich ihm widersetzten, überwand. Julianus nun, Defensor unserer Kirche, der vor nicht langer Zeit hier gestorben ist, war ein sehr vertrauter Freund dieses Mannes. Aus seinem Munde weiß ich auch, was ich jetzt erzähle; denn er wagte es aus Freundschaft oft, seine Taten mit anzusehen, und bewahrte auch nachher sein Andenken zu unserer Belehrung gleichwie süßen Honig in seinem Munde.
In dem nahen Tuscien hatte eine vornehme Matrone eine Schwiegertochter, die bald, nachdem sie deren Sohn geehelicht hatte, mitsamt der Schwiegermutter zur Einweihung der Kirche des heiligen Märtyrers Sebastianus eingeladen wurde. In der Nacht aber vor dem Tage, an dem sie zur Kircheneinweihung gehen wollte, unterlag sie der Fleischeslust und konnte sich von ihrem Manne nicht enthalten.32 Als am Morgen einerseits die gepflogene Fleischeslust sie im Gewissen zurückschreckte, anderseits der Anstand den Kirchengang forderte, fürchtete sie sich mehr vor den Menschen als vor Gottes Gericht und ging mit ihrer Schwiegermutter zur Kirchweihe. In dem Moment aber, in welchem die Reliquien des heiligen Märtyrers Sebastian in die Kirche getragen wurden, ergriff ein böser Geist die Schwiegertochter und begann sie vor allem Volke zu peinigen. Als der Priester der Kirche die Frau in ihren großen Schmerzen sah, nahm er ein Tuch vom Altar und bedeckte sie damit, aber auch in ihn fuhr allsogleich der Teufel. Weil er etwas, was über seine Kräfte ging, tun wollte, mußte er erst durch eigene Qual zur Erkenntnis gelangen, was hier vorging.33 Die Anwesenden aber trugen die junge Frau aus der Kirche und brachten sie nach Hause. Da nun der alte böse Feind sie durch beständiges Quälen ganz aufzureiben drohte und da ihre Angehörigen sie dem Fleische nach liebten, ja bis zum Verderben liebten, übergaben sie die Frau zur Wiedererlangung der Gesundheit den Zauberern. So stürzten sie ihre Seele vollends ins Verderben, während sie ihrem Leibe für den Augenblick durch Zauberkünste helfen wollten. Man führte sie also an einen Fluß und tauchte sie ins Wasser unter. Längere Zeit suchten die Zauberer durch ihre Zauberformeln es dahin zu bringen, daß der Teufel, der in sie gefahren war, sie wieder verlasse. Aber durch ein wunderbares Gericht des allmächtigen Gottes fuhr, wenn durch die gottlose Kunst ein Teufel ausgetrieben war, sogleich eine ganze Legion in sie hinein. Sie wurde darum in so vielerlei Bewegungen hin- und hergeworfen und schrie in sovielen Stimmen, als böse Geister von ihr Besitz genommen hatten. Darauf hielten die Anverwandten Rat, gestanden ihre Sünde der Treulosigkeit gegen den Glauben, führten die Frau zu dem ehrwürdigen Bischof Fortunatus und ließen sie bei ihm zurück. Er nahm sie auf und betete viele Tage und Nächte. Er oblag mit einer so großen Anstrengung dem Gebete, weil er sah, daß in dem einen Körper ein ganzes Heer von bösen Geistern gegen ihn stehe. Doch nach einigen Tagen machte er sie so gesund und wohlbehalten, wie wenn der böse Feind nie ein Anrecht auf sie gehabt hätte.
Wieder ein anderes Mal trieb der Diener des allmächtigen Gottes aus einem Besessenen einen unreinen Geist aus. Als der böse Geist sah, daß es um die Abendzeit war und zu einer Stunde, wo sich die Menschen zurückziehen, nahm er die Gestalt eines Fremdlings an, ging auf die Plätze der Stadt und schrie: „Ja, das ist ein heiliger Mann, der Bischof Fortunatus! Seht, was er getan hat! Einen Fremdling hat er aus seiner Herberge hinausgestoßen! Ich suche ein Plätzchen, um ausruhen zu können, und finde keines in seiner Stadt!” Da saß eben ein Mann in seinem Hause mit seinem Weibe und seinem kleinen Sohn am Kohlenfeuer; er hörte das Schreien und fragte, was ihm denn der Bischof getan habe; darauf lud er ihn in sein Haus ein und ließ ihn neben sich am Kohlenfeuer Platz nehmen. Während sie nun über verschiedene Dinge miteinander redeten, fuhr der böse Geist in den Knaben, warf ihn in die Glut und nahm ihm schnell das Leben. Der unglückliche, seines Kindes beraubte Vater erkannte nun, wen er aufgenommen und wen der Bischof vertrieben hatte.
Petrus. Wie sollen wir denn das erklären, daß der Erbfeind die Kühnheit hatte, jemanden zu töten und noch dazu in dem Hause eines Mannes, der ihn für einen Fremdling ansah und ihn aus Gastfreundschaft bei sich aufnahm?
Gregorius. Vieles, Petrus, scheint gut zu sein und ist es nicht, weil es nicht in guter Absicht geschieht; deshalb sagt auch die ewige Wahrheit im Evangelium: „Ist dein Auge schalkhaft, so wird dein ganzer Leib finster sein.”34 Denn wenn die Absicht, die vorausgeht, unrecht ist, so ist böse jedes Werk, das nachfolgt, mag es auch aussehen wie ein gutes Werk. Ich glaube nämlich, daß der Mann, der scheinbar Gastfreundschaft übte und dabei seines Kindes beraubt wurde, nicht an dem Werke der Barmherzigkeit seine Freude hatte, sondern an der üblen Nachrede gegen den Bischof; denn die Strafe, die nachfolgte, tat kund, daß die vorhergehende gastliche Aufnahme nicht ohne Schuld war. Denn es gibt Leute, die deswegen sich guter Werke befleißen, um den Glanz der Tätigkeit anderer zu verdunkeln; sie freuen sich nicht über das Gute, das sie tun, sondern über das Lob, das sie dafür ernten und womit sie andere in Schatten stellen. Darum glaube ich, daß der Mann, der den bösen Geist als Gast aufnahm, eher an eitle Prahlerei dachte als an ein gutes Werk, damit es den Anschein habe, als handle er besser als der Bischof, da er einen bei sich auf genommen, den Fortunatus, der Mann des Herrn, fortgejagt hatte.
Petrus. Ja, so ist es, wie du sagst; eben der Ausgang zeigte, daß die Absicht beim Werke keine reine war.
Gregorius. Wieder zu einer anderen Zeit wurde ein Mann zu ihm gebracht, der das Augenlicht verloren hatte. Er bat, daß er ihm durch seine Fürsprache helfen möge, und erlangte Hilfe. Denn sowie der Mann Gottes nach einem Gebete die Augen mit dem heiligen Kreuze bezeichnet hatte, wurde ihm das Augenlicht plötzlich wiedergegeben, und die Nacht der Blindheit entschwand. Ferner wurde einmal das Pferd eines Ritters derart scheu, daß es nur mit Mühe von vielen Leuten gehalten werden konnte und alle, die in seine Nähe kamen, biß. Endlich wurde es von einer Anzahl von Leuten gefesselt und vor den Mann Gottes geführt. Dieser streckte seine Hand aus und machte auf den Kopf des Pferdes das Kreuzzeichen und verwandelte dadurch die ganze Raserei in Sanftmut, so daß das Tier hernach zahmer war als vor dem Wutanfall. Auf das hin beschloß der Ritter, das Pferd, das er durch die Macht des Wunders so schnell von der Raserei geheilt sah, dem heiligen Mann als Geschenk anzubieten. Als dieser nun anfänglich die Annahme verweigerte, jener aber fortgesetzt bat, er möge das Geschenk nicht verschmähen, schlug der heilige Mann unter den beiden Möglichkeiten den Mittelweg ein, indem er einerseits die Bitte des Ritters erhörte, anderseits aber es ablehnte, ein Geschenk für ein Wunderwerk anzunehmen. Er zahlte nämlich einen entsprechenden Preis, und dann nahm er das angebotene Pferd an. Denn da er sah, daß er den Ritter betrüben würde, wenn er das Pferd nicht annähme, kaufte er aus Liebe, was er nicht nötig hatte.
Ich darf auch jenes Wunderwerk dieses Mannes nicht verschweigen, das ich vor ungefähr zwölf Tagen erfuhr. Es wurde nämlich ein armer alter Mann zu mir gebracht, und da mir eine Unterhaltung mit alten Leuten immer sehr lieb ist, erkundigte ich mich angelegentlich, wo er zu Hause sei. Er sagte, er sei aus der Stadt Todi. Darauf trug ich ihn: „Bitte, Vater, hast du etwa den Bischof Fortunatus gekannt?” „Ja”, sagte er, „ich habe ihn gekannt, und zwar sehr gut.” Darauf fuhr ich fort: „Erzähle mir, bitte, was du für Wunderwerke von ihm weißt, und sag’ mir, was er für ein Mann gewesen ist; denn ich möchte das so gerne wissen.” Darauf antwortete er: „Dieser Mann war ganz anders als die Leute, wie wir sie heutzutage sehen; denn um was immer er den allmächtigen Gott bat, das erhielt er, sowie er darum betete. Nur ein einziges Wunder, das mir gerade in den Sinn kommt, möchte ich von ihm erzählen. Es kamen nämlich einmal Goten, die in die Gegend von Ravenna reisten, in die Nähe der Stadt Todi. Sie hatten aber auf einem Hofe, der ganz nahe bei Todi lag, zwei kleine Knaben entführt. Als das dem heiligen Mann Fortunatus hinterbracht wurde, schickte er sofort hin und ließ die Goten zu sich kommen. Er redete sie mit freundlichen Worten an und gab sich Mühe, zuerst ihr rauhes Wesen zu mildern, und fügte dann schließlich bei: ‘Was ihr als Preis verlangt, das will ich euch geben, aber gebt mir die Knaben, die ihr weggeführt habt, wieder heraus! Schenket mir diesen Beweis eurer Gunst!’ Darauf antwortete der, welcher dem Anschein nach ihr Anführer war: ‘Verlange irgend etwas anderes, und wir werden es tun, die Knaben aber geben wir auf keinen Fall heraus.’ Daraufhin drohte ihm der ehrwürdige Mann mit gütigen Worten und sprach: ‘Du betrübst mich, mein Sohn, und hörst nicht auf deinen Vater; betrübe mich nicht, damit die Sache nicht einen schlimmen Ausgang für dich nehme!’ Aber der Gote verharrte in der Wildheit seines Herzens und ging nach einer abschlägigen Antwort davon. Als er am andern Tag abziehen wollte, kam er noch einmal zum Bischof, und wiederum bat ihn der Bischof in gleicher Weise für die erwähnten Kleinen. Als er aber durchaus nicht in die Herausgabe einwilligen wollte, sprach der Bischof voll Trauer: ‘Ich weiß es, daß es für dich nicht gut ist, mich zu betrüben und so davon zu gehen.’ Der Gote aber gab nichts auf diese Worte, ging in seine Herberge zurück, ließ die zwei Knaben, um die es sich handelte, auf Pferde setzen und schickte sie mit seinen Leuten voraus. Er bestieg dann auch selbst sein Pferd und ritt nach. Als er aber in jener Stadt vor die Kirche des heiligen Petrus kam, glitt sein Pferd aus; es stürzte mit ihm zu Boden, und er brach sich dabei das Hüftbein, so daß das Bein in zwei Teile auseinanderging. Man hob ihn auf und trug ihn in die Herberge zurück. Sogleich schickte er und ließ die zwei Knaben zurückholen, sandte zum ehrwürdigen Mann Fortunatus und ließ ihm sagen: ‘Ich bitte dich, Vater, sende deinen Diakon zu mir.’ Als der Diakon an sein Lager kam, ließ er die zwei Knaben, deren Herausgabe er dem Bischof rundweg abgeschlagen hatte, hereinbringen, übergab sie dem Diakon und sprach: ‘Geh’ und sage dem Bischof, meinem Herrn: Weil du mich verwunschen hast, sieh, darum bin ich jetzt geschlagen. Nimm aber nun die Knaben, die du verlangt hast, und lege für mich, ich bitte dich, Fürbitte ein.’ Der Diakon nahm die Knaben und führte sie zum Bischof, worauf ihm der ehrwürdige Fortunatus sogleich Weihwasser gab und sagte: ‘Gehe schnell und besprenge damit seinen Leib!’ Der Diakon ging also weg, begab sich zum Goten und besprengte seine Glieder mit dem Weihwasser. Und o wundervolles, höchst staunenswürdiges Ereignis! Sobald das Weihwasser die Hüfte des Goten berührte, war der ganze Knochenbruch so gut geheilt und das Hüftbein wieder gesund, daß der Gote zur selben Stunde das Bett verlassen, zu Pferde steigen und seine Reise fortsetzen konnte, gleich als ob er keine Verletzung an seinem Leibe erlitten hätte. So kam es also, daß er die Knaben dem heiligen Fortunatus, durch Strafe gezwungen, umsonst geben mußte, nachdem er sie aus Gehorsam nicht einmal gegen ein Entgelt hatte herausgeben wollen.” Als der Greis mit dieser Erzählung zu Ende war, wollte er mir noch andere Wunder berichten, aber da viele Leute da waren, an welche ich ermunternde Worte richten mußte, und da es schon spät geworden war, konnte ich den Wundertaten des ehrwürdigen Fortunatus nicht länger zuhören, denen ich, wenn es anginge, immer zuhören möchte.
Am anderen Tage aber erzählte mir der Greis eine noch wunderbarere Geschichte von ihm; er erzählte nämlich folgendes: „In derselben Stadt Todi lebte ein wohlgeachteter Mann namens Marcellus mit seinen zwei Schwestern zusammen. Es befiel ihn eine Unpäßlichkeit, und er starb gerade am Abend des hochheiligen Ostersamstags. Da man den Leichnam etwas weiter zum Begräbnis hätte tragen müssen, konnte die Beerdigung an jenem Tage nicht mehr stattfinden. Da sich nun auf diese Weise ein Aufschub des Begräbnisses ergab, eilten seine Schwestern, die der Todesfall in tiefe Trauer versetzt hatte, weinend zum Bischof und klagten ihm laut: ‘Wir wissen, daß du wie die Apostel lebst, die Aussätzigen machst du rein und die Blinden machst du sehend, o komm und erwecke unsern Toten wieder zum Leben!’ Als er vom Tode ihres Bruders erfuhr, mußte auch er darüber weinen und sagte zu ihnen: ‘Gehet heim und saget solche Worte nicht mehr; denn es ist eine Anordnung des allmächtigen Gottes, der kein Mensch entgegenhandeln kann.’ Sie gingen weg, der Bischof aber blieb wegen des Todesfalles in tiefe Trauer versunken. Am folgenden Sonntag rief der Bischof noch vor anbrechender Morgendämmerung zwei seiner Diakonen zu sich und begab sich mit ihnen zum Hause des Toten. Er betrat den Raum, wo der entseelte Leichnam lag, und begann zu beten. Nachdem er sein Gebet beendigt hatte, stand er auf und setzte sich neben den Leichnam; mit einer nicht gar lauten Stimme rief er den Verstorbenen beim Namen mit den Worten: ‘Bruder Marcellus!’ Dieser aber schlug sofort, wie wenn er durch eine nahe, leise Stimme aus leichtem Schlummer geweckt worden wäre, die Augen auf, sah den Bischof an und sprach: ‘Oh, was hast du getan? Was hast du getan?’ Darauf erwiderte der Bischof: ‘Was ich getan habe?’ Er aber sagte: ‘Gestern kamen zwei, die mich aus meinem Leibe holten und an einen guten Ort führten; heute aber kam einer gesandt, der sagte: ‘Führt ihn wieder zurück, denn der Bischof Fortunatus ist in sein Haus gekommen!’ Nach diesen Worten erholte er sich bald wieder von seiner Krankheit und blieb noch längere Zeit am Leben.” Man darf jedoch nicht glauben, daß er den Ort, den er schon erlangt hatte, verloren habe, weil er ohne Zweifel durch das Gebet seines Fürsprechers nach dem Tode ein noch besseres Leben führen konnte, nachdem er schon vor seinem Sterben sich bemüht hatte, Gott dem Allmächtigen wohlzugefallen. Doch wozu erzählen wir vieles von seinem Leben, da wir an seinem Leichnam noch bis auf den heutigen Tag so viele Wundererweise erfahren? Denn so oft man ihn mit Vertrauen anfleht, er möge Besessene befreien, Kranke gesund machen, wie er das im Leben unaufhörlich getan hat, so fährt er fort, dies auch bei seinen sterblichen Überresten zu tun.
Doch möchte ich, Petrus, in meiner Erzählung wieder in die Provinz Valeria zurückkehren, von der ich außerordentlich viel Wunder aus dem Munde des ehrwürdigen Fortunatus35 vernommen habe, den ich früher bereits erwähnte. Dieser besucht mich jetzt öfter und verschafft mir stets neue Erquickung, wenn er von den Werken der Alten erzählt.
XI. Kapitel: Von Martyrius,36 Mönch der Provinz Valeria
In dieser Provinz lebte ein sehr frommer Diener des allmächtigen Gottes namens Martyrius, der folgenden Beweis seiner Tugend gab. Eines Tages buken seine Mitbrüder Brot in der Asche, hatten aber vergessen, das Kreuzzeichen darauf zu drücken. Man pflegt nämlich in jener Gegend das noch ungebackene Brot mit einer Holzform so zu zeichnen, daß es in vier Viertel geteilt erscheint. Da kam der Diener Gottes dazu und erfuhr von den Brüdern, daß das Brot nicht gezeichnet wurde. Während nun das Brot schon mit Glut und Asche überdeckt war, sprach er: „Warum habt ihr es nicht bezeichnet?” und machte bei diesen Worten mit dem Finger das Kreuzzeichen über die Glut. Bei dieser Bezeichnung krachte das Brot sehr heftig, gerade wie wenn ein mächtiger Topf im Feuer zersprungen wäre. Als man dasselbe dann fertig gebacken aus dem Feuer nahm, fand es sich, daß es mit dem Kreuze bezeichnet war, das ihm nicht eine Berührung, sondern der Glaube aufgedrückt hatte.
XII. Kapitel: Von dem Presbyter Severus37 aus derselben Provinz
In jener Gegend heißt ein Tal Interorina,38 das von vielen im Volksdialekt Interocrina genannt wird. Dort lebte ein Mann von bewundernswertem Lebenswandel namens Severus, Priester an der Kirche der seligen Gottesmutter und immerwährenden Jungfrau Maria. Zu ihm schickte einmal ein Hausvater, der sein Ende herannahen sah, eilends Boten und ließ ihn bitten, er möge doch möglichst rasch kommen und durch sein Gebet für seine Sünden Fürsprache einlegen, damit er so für das Böse noch Buße tun und frei von Schuld aus dem Leben scheiden könne. Nun traf es sich, daß dieser Priester zufälligerweise gerade mit dem Beschneiden seines Weinbergs beschäftigt war; er sagte deshalb zu den Boten: „Gehet voraus, ich komme gleich nach!” Denn da er sah, daß ihm nur noch ein wenig zu tun übrig blieb, hielt er sich etwas auf, um das bißchen Arbeit, das noch zu tun war, zu vollenden. Als das geschehen war, ging er zum Kranken. Auf dem Wege kamen ihm schon jene, die vorher bei ihm gewesen waren, entgegen und sagten: „Vater, warum hast du gezögert? Bemühe dich nicht mehr, denn er ist schon gestorben.” Als er dies hörte, erschrak er und rief laut, er sei sein Mörder. Weinend kam er zum Leichnam des Verschiedenen und warf sich unter Tränen vor seinem Bette nieder. Während er heftig weinte, sein Haupt auf den Boden stieß und rief, er sei schuld an dessen Tod, erwachte der Verstorbene plötzlich wieder zum Leben. Die vielen Umstehenden, die es sahen, stießen Schreie der Verwunderung aus und weinten nun vor Freude noch mehr. Als sie ihn dann fragten, wo er war, oder wie er wieder hergekommen sei, sagte er: „Häßliche Leute führten mich davon; aus Mund und Nase kam ihnen ein Feuer, das ich nicht ertragen konnte. Während sie mich durch finstere Orte führten, kam plötzlich ein Jüngling von schönem Aussehen mit noch anderen uns entgegen und sagte zu denen, die mich schleppten: ‘Führt ihn wieder zurück, denn der Presbyter Severus weint um ihn; seinen Tränen hat ihn der Herr wieder geschenkt.’” Sogleich erhob sich Severus vom Boden und half ihm, als er Buße tat, mit seiner Fürsprache. Und nachdem der wiedererweckte Kranke sieben Tage lang für die begangenen Sünden Buße getan hatte, schied er am achten Tage freudig aus dem Leben. Siehe, Petrus, ich bitte, wie sehr der Herr diesen Severus, von dem wir reden, als seinen Liebling behandelt hat, da er ihn nicht einmal kurze Zeit in Trauer lassen konnte.
Petrus. Diese Dinge, die mir bis jetzt unbekannt waren, sind höchst wunderbar. Aber was sagen wir dazu, daß man jetzt solche Männer nicht mehr finden kann?
Gregorius. Ich glaube, Petrus, daß uns auch heute eine große Anzahl solcher Männer nicht mangelt; denn deswegen, weil sie keine solchen Wunder tun, müssen sie ihnen nicht ungleich sein. Denn der wahre Wert des Lebens liegt in der Tugend und nicht im Wunderwirken. Es gibt sehr viele, die, ohne Wunder zu wirken, dennoch den Wundertätern nicht nachstehen.
Petrus. Wie kann man mir, ich bitte, dies beweisen, daß es viele gibt, die zwar keine Wunder tun und die trotzdem den Wundertätern nicht unähnlich sind?
Gregorius. Weißt du etwa nicht, daß der Apostel Paulus im Apostelamte ein Bruder des Apostelfürsten Petrus ist?
Petrus. Gewiß, das weiß ich, und es unterliegt keinem Zweifel, daß er, obwohl der geringste unter den Aposteln, doch am meisten unter allen gearbeitet hat.
Gregorius. Wie du dich gewiß erinnerst, wandelte Petrus auf dem Meere. Paulus aber erlitt Schiffbruch auf dem Meere; es war auf demselben Elemente: Paulus konnte dort nicht zu Schiff fortkommen, wo Petrus zu Fuß ging. Es ist also ganz klar, daß demnach beider Verdienst im Himmel gleich ist, wenn auch beider Wunderkraft ungleich ist.
Petrus. Ich gestehe, das Gesagte gefällt mir; denn jetzt erkenne ich deutlich, daß man auf das Leben und nicht auf die Wunder schauen muß. Doch da die Wunder, die geschehen, gerade von einem guten Leben Zeugnis geben, so bitte ich dich, fortzufahren, wenn du noch welche weißt, um so meine Neugier durch gute Beispiele zu befriedigen.
Gregorius. Ich möchte dir zum Lobe des Erlösers einiges von den Wundern des ehrwürdigen Mannes Benediktus erzählen, aber ich sehe, daß dazu heute die Zeit nicht mehr reicht. Wir können ungehinderter darüber sprechen, wenn wir damit ein anderes Mal beginnen.