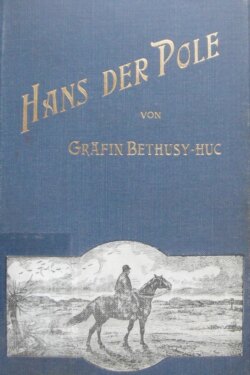Читать книгу Hans der Pole - Gräfin Bethusy-Huc - Страница 6
IV.
ОглавлениеDrei Tage darauf stand in der „Ostdeutschen Nationalzeitung“ zu lesen:
„Wieder ein Gutsverkauf an die Polen! Das Rittergut Warozin, 550 Morgen, 10 800 Mark Grundsteuer-Reinertrag, soll an die Herren von Mielosenski verkauft werden. Die Verhandlungen sind, wie wir hören, noch nicht zum Abschlusse gelangt. Es besteht somit noch eine Hoffnung, dass dieser Grundbesitz dem Deutschtum erhalten bleiben kann und dass der kecke Handstreich durchkreuzt wird, mit dem sich das Polentum in dem Kreise Ulzenburg, der bisher nur deutschen Grundbesitz umschloss, einzunisten versucht. Freilich bedarf es dazu einer schärferen Wachsamkeit und schneidigeren Haltung, als sie bisher dergleichen Vorkommnissen gegenüber von der Regierung eingenommen wurde. Es fragt sich da, ob die Worte, die der Reichskanzler unlängst über die Bekämpfung des Polentums als nationale Lebensfrage gesprochen hat, nur Worte bleiben oder Taten zeitigen sollen. Der Besitzer des Gutes, Baron Walsberg, ist Leutnant im 220. Regiment. Obgleich noch minderjährig, hat er jedenfalls die Entscheidung zu treffen. Der Vormund, der die Verhandlungen eingeleitet hat, ist Rittmeister d. R. Beide zählen somit zu den Kreisen der Gesellschaft, welche Se. Majestät der Kaiser als die „Edelsten der Nation“ bezeichnete. Noblesse oblige!“
Diese Nachricht, sofort nach Berlin telefoniert, blitzte noch zur selben Stunde mit den Depeschen des Wolffschen Bureaus durch ganz Deutschland, an demselben Tage durch die „Reuter“- und „Stefani“- Agenturen und die „Associated Press“ über ganz Europa und um den Erdball herum. Während Hans seinen Kummer tief in sich verschloss und seinem Kameraden Benno Arden Schwiegen zur Ehrenpflicht gemacht hatte, wusste plötzlich die ganze Welt darum. Im Gegensatze zu der verschärften Staatsaktion, welche die Regierung jüngst noch im Landtage angekündigt hatte, wirkte die Nachricht sensationell. Im Auslande wurde sie mit schadenfrohen Worten kurz kommentiert, von deutschen Blättern in entrüsteten Artikel ausgesponnen. Berliner Blätter deuteten alsbald auch an, dass der Kaiser sich höchst ungnädig über diesen Fall ausgelassen habe.
Der Regierungspräsident von Arden hatte gerade an seinen Sohn Benno geschrieben, er möchte zur Feier seines Geburtstages noch seinen Freund Leutnant von Walsberg mitbringen, da getanzt werde sollte und die Tänzer rar wären. Zur selben Stunde, als der Brief etwa in den Händen Bennos sein musste, wurde Herrn von Arden die „Deutsche Nationalzeitung“ mit der blauangestrichenen Notiz vorgelegt. Das korrekte stets ein gemäßigtes Wohlwollen ausdrückende Gesicht des Präsidenten wurde einen Schein blasser.
„Das ist ja unerhört!“ fuhr er den Regierungsrat an, der ihm das Schriftstück vorgelegt hatte. „Telefonieren Sie sofort an den Landrat von Ulzenburg und fordern Sie schleunigen Bericht.“ Die telefonische Antwort brachte den Bescheid, dass der Landrat auf einer Urlaubsreise begriffen, um übrigen im Landratsamt wohl die missliche pekuniäre Lage von Warozin, ein Verkauf an Polen aber nicht bekannt sei.
„Das ist ja eine Haupt – “ der Regierungspräsident unterbrach seinen Gefühlsausbruch und sah den Regierungsrat an.
„Was ist da zu machen?“
„Sehr fatal – es ist der dritte Polenverkauf in unserem Bezirk.“
Der Rat blickte mit tiefem Ernst auf das ominöse Zeitungsblatt herab, der Präsident ging erregt im Zimmer umher. Dann sagte er:
„Zunächst muss die Presse zum Schweigen gebracht werden.“
„Ja, wünschen der Herr Präsident, dass ich –“
„Nein, nein, ich fahre selbst zum Professor von Schulen.“
Eine Viertelstunde später rollte das Coupé des Präsidenten der Vorstadt zu, wo Professor von Schulen eine Villa bewohnte. Dieser Professor wäre dem Präsidenteneigentlich unsympathisch gewesen, wenn er es nicht für eine Pflichtsache gehalten hätte, fast liiert mit ihm zu sein. Stand er doch an der Spitze des Nationalvereins zur Wahrung des Deutschtums, dieses Vereins, der die „Ostdeutsche Nationalzeitung“ ins Leben gesetzt und seit Berufung des Professors von Schulen auf der ganzen Linie eine unheimliche Rührigkeit entfaltet hatte.
Das Coupé hielt vor einem gepflegten Vorgarten. Ein Bernhardiner erhob sich in königlicher Haltung von der Haustürschwelle, als die Glocke, die den Besuch anmeldete, erklang, und legte sich beim Anblicke des Coupés befriedigt wieder hin. Ein Diener in dunkler Livree geleitete den Präsidenten durch die mit afrikanischen Waffen und Tigerfellen dekorierte Eintrittshalle, die Treppe hinauf und bat, in einem kleinen Empfangszimmer zu warten, bis er den Herrn Professor benachrichtigt haben würde. Herr von Arden blickte mit einem gewissen Unbehagen um sich. Erstes war ihm das intensive, fremdartige Parfüm-, das den Raum erfüllte, unangenehm, dann lag ein gewisses, schwüles Etwas über der ganzen Einrichtung, das ihm auf die Nerven fiel. Diese mit orientalischen Seidenstoffen bezogenen Möbel, diese Frauenporträts in zum Teil recht derangierter Toilette, die vielen eleganten Überflüssigkeiten, die den Raum erfüllten, das alles war nicht der Rahmen für einen Mann der Arbeit und Pflichterfüllung, dachte der Präsident, aber zugleich wiederholte er sich, dass Professor von Schulen dennoch ein solcher Mann sei und dass man ihn jedenfalls gar nicht entbehren könnte. Da drang ein Ton an sein Ohr, der ihn zusammenzucken ließ wie unter einem Peitschenhiebe – eine Trau hatte laut und hell irgendwo gelacht. Die Stirn des Präsidenten rötete sich – nicht weil in einem eleganten Junggesellennest eine Frau ihre Gegenwart verriet – aber weil Professor von Schulen gestattete, dass sie es in dieser Weise vor den Ohren des ersten Vertreters der Regierung tat. Unwillkürlich richtete er sich höher auf – das Unpassende dieser Situation musste er gleich von vornherein markieren. Da wurde die Portiere zurückgeschlagen.
„Mein hochverehrter Herr Präsident, welche unerwartete Freude und Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich war gerade im Begriff, mich zu Ihnen zu begeben, es hat offenbar eine merkwürdige Ideen-Assoziation zwischen Ihnen und meiner Wenigkeit stattgefunden – aber wollen Sie mir nicht die Ehre erweisen hier in mein Arbeitszimmer einzutreten, ich weiß, Sie lieben das bric-à-brac, das uns hier umgibt, nicht, das ist auch nur der Empfangsraum für alle Welt – ein Besucher wie Sie gehört ins Allerheiligste!“
Es war doch schwer, in kühler Reserve zu bleiben dieser überströmenden Liebenswürdigkeit gegenüber und dem Blick dieser weichen, braunen Augen abweisend zu begegnen. Der Präsident hielt es daher für das Beste, sofort zu der question of matter überzugehen. Er zog das Blatt der „Ostdeutschen Nationalzeitung“ mit der blau angestrichenen Stelle aus der Tasche.
„Ich komme in einer besonderen Angelegenheit“, begann er. Da fiel ihm auch schon der Professor ins Wort.
„In dieser selben Angelegenheit wollt ich zu Ihnen, Herr Präsident, denn es ist mir ganz außerordentlich fatal, dass gerade unsre Zeitung einen so aggressiv gegen die Regierung gerichteten Passus gebracht hat! Ich war so überbürdet mit Arbeit, dass ich die Redaktion des „Provinziellen“ nicht durchsehen konnte; wer durfte dann auch ahnen, dass dieser Lapsus vorkommen würde.“
Der Präsident hatte inzwischen wieder seine ruhige, korrekte Haltung angenommen.
„Ich hab natürlich keinen Augenblick geglaubt, dass die betreffende Stelle von Ihnen herrühren könnte, Herr Professor“, sagte er, „die Frage ist nur die: wie machen wir diese Wendung wieder gut? Wenn ich mich persönlich auch ganz und gar eliminiere, so meine ich doch, wir schaden dem Ganzen, wenn wir das Vertrauen zur Regierung untergraben.“
„Ich bin ganz Ihrer Ansicht, Herr Präsident, unsere Bestrebungen, das Deutschtum im unseren Ostmarken zu stärken, können natürlich nur Erfolg haben, wenn wir Hand in Hand mit der Regierung gehen, Zu meinem großen Bedauern sind ja manche Maßnahmen getroffen worden, die sich nicht ganz mit unseren Zielen decken.“
„Das möchte ich doch bezweifeln, Herr Professor.“
„Herr Präsident, Sie müssen mir ein offenes Wort gestatten, wie man es eben nur einem so hochdenkenden Manne gegenüber aussprechen darf – ist doch unser beider Bestreben nur darauf gerichtet, die nationale Sache zu fördern, nicht wahr?“
Der Präsident machte eine zustimmende Bewegung, und der Professor fuhr fort:
„Vor allem meine ich, dass die Triebkraft der öffentlichen Meinung in ihrem vollen Werte geschätzt und verwendet werden müsste, und dazu könnte unsere Zeitung in viel ausgedehnterem Maße als bisher dienen:“
„Gewiss, an eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung in regierungsfreundlicher Weise denke ich ja auch in erster Stelle, aber Sie sprachen von Maßnahmen.“
„Da Sie darauf zurückkommen, Herr Präsident, so möchte ich mir erlauben zu bemerken, dass es mir nicht opportun schein, wenn wir einerseits den Kamp gegen des Polentum predigen und in der nächsten Zeitungsspalte die Nachricht von der Auszeichnung eines Mannes bringen müssen, der eine unpatriotische Handlung begangen hat. Ich erinnere nur an die Ernennung zum Deichhauptmann des Prinzen Hertram – dieses Mannes, der sein an der Grenze belegene Besitzung Scharnowitz an einen Nationalpolen verkauft hatte!“
„Der Prinz hat sich aber zugleich Verdienste um die Ausgestaltung des Dammnetzes erworben.“
„Weil seine noch deutschen Güter gerade am meisten von den Überschwemmungen des Chelmflusses zu leiden hatten – sehen Sie, mein verehrter Herr Präsident, ich kenne die Personalien all dieser Leute, und es gibt mir jedes Mal einen Stich ins Herz, wenn ein Mann, dessen nationales Empfingen ich als nicht ganz rein kenne, wenn ein solcher Mann irgendwie in den Vordergrund gestellt wird. Gerade unser grundbesitzender Adel muss mit leuchtendem Beispiel im Kamp um das Deutschtum vorangehen, und ich versichere Sie, diesen Herren würden ihre Pflichten erst klar werden, wenn Sie einmal ein Exempel statuierten, einen Mann, der um des Mammons willen sein nationales Empfinden verkauft hat, an den Pranger stellten zum abschreckenden Beispiel für andere! Sie ahnen vielleicht doch nicht in ganzem Umfange, wie scharf im feindlichen Lager mobil gemacht, wie alle Schleusen geöffnet werden, damit die polnische Sturmflut deutsches Land überströme. Ich habe die überraschendsten Aufschlüsse darüber in Händen, wie nahe verquickt die polnische Bewegung mit der sozialdemokratischen ist; glauben Sie mir, wir stehen an der Schwelle ernstester Ereignisse, wenn wir erhaltenden Parteien nicht fest geschlossen, Hand in Hand vorwärts gehen!“
„Das ist allerdings auch meine Ansicht“, sagte der Präsident sehr ernst, „und ich hoffe, Sie geben mit in den nächsten Tagen Gelegenheit, eingehend mit Ihnen über diese Dinge zu konferieren.“
„Sie kommen meiner Bitte zuvor, Herr Präsident; um auf den Ausgangspunkt unseres Gespräches zurückzukommen, so hoffe ich eine Aktion eingeleitet zu haben, die anstatt des polnischen Käufers einen deutschen für Warozin herbeischafft.“
„sie denken an einen Ankauf durch die Landbank?“ bemerkte der Präsident.
„Pardon, Herr Präsident, ich habe leider erfahren, dass der Vormund des Barons Walsberg in erster Linie an die Landbank herangetreten ist, mit dem Preise, den diese bot, aber nicht zufrieden war.“
„Ja, unsere Mittel sind natürlich nur beschränkt; wenn diese Herren nicht selbst das Gefühl dafür haben, dass sei, selbst mit kleinem Verlust, besser tun, an die Landbank als an einen Polen zu verkaufen, so ist das ein trauriges Zeichen der Zeit.“
„Ganz meine Auffassung, Herr Präsident! Trotzdem hoffe ich Wege gefunden zu haben, um Warozin in deutschen Händen zu erhalten.“
„Das wäre wirklich ein nationales Werk, Herr Professor; darf ich näheres darüber erfahren?“
„Gewiss, Herr Präsident, Sie wissen, ich stehe Ihnen mit meiner schwachen Kraft vollständig zur Verfügung! Die Sache ist die: Warozin grenzt, wie Sie vielleicht wissen, mit den Besitzungen des Herzogs von Allenstein. Der Generaldirektor des Herzogs ist mein persönlicher Freund – ich habe allen Grund anzunehmen, dass ein polnischer Nachbar ihm sehr unerwünscht wäre, und da er gerade auf der Rückreise von Karlsbad unsere Stadt passiert, habe ich ihn telegraphisch um eine Unterredung gebeten. Ich erwarte ihn eigentlich jeden Augenblick und bin überzeugt, er wird sich bereitfinden lassen, den polnischen Handstreich auf Warozin zu verhindern. Einstweilen habe ich selbst an Frau von Walsberg geschrieben und ihr einen Käufer in Aussicht gestellt, denn – ich wollte zwar eigentlich nicht davon sprechen, aber Ihnen gegenüber, Herr Präsident, geht mir immer das Herz auf – also, im Falle der Generaldirektor Blei weder für sich noch für seinen Herzog kaufen will, springe ich selbst in die Bresche.“
„Wie, Sie wollten – – –“
„Warozin kaufen, wenn es keinen anderen Weg gibt, die Polen fern zu halten, gewiss, Herr Präsident!“
Herr von Arden reichte ihm die Hand; in diesem Augenblick hatte er wieder einmal alle Animosität gegen den Professor vergessen.
„Wenn wir viele Männer wie Sie hätten, Herr von Schulen, da stände es besser um uns!“
„Ihre große Liebenswürdigkeit überschätzt mich, Herr Präsident“, sagte der Professor, sich tief verneigen, „vielleicht darf ich Ihnen sogleich eine Notiz vorlegen, die ich schon für alle Fälle für unsere Zeitung vorbereitet hatte.“
„Ach, Sie haben auch schon daran gedacht! Darf ich bitten?“
Der Professor schob auf seinem monumentalen Schreibtisch eine Sphinx von französischer Bronze zur Seite und zog darunter ein beschriebenes Blatt hervor, das er dem Präsidenten reichte.
Herr von Arden las:
„Wie wir hören, ist es der persönlichen Initiative unseres Regierungspräsidenten zu verdanken, dass weitere Krause für den Verkauf von Warozin interessiert worden sind. Unsere Leser werden sich erinnern, dass dieser seit Urväterzeiten deutsch Besitz in polnische Hände übergehen sollte. Es soll ein opferfreudiger Patriot gefunden sein, der bereit ist, das Gut zu kaufen, da der bisherige Besitzer, Baron von Walsberg, leider nicht in der Lage ist, es halten zu können.“
„Sie beschämen mich“, sagte Herr von Arden, aber der Professor widersprach lebhaft.
„Ich habe nur ausgesprochen, was Sie dachten, Herr Präsident. Sie kamen zu mir, um diese Initiative zu ergreifen!“
Er geleitete seinen Gast zurück durch die Waffenhalle, vorüber an dem schweifwedelnden Bernhardiner, und öffnete selbst die Tür des Coupés, strahlend von Liebenswürdigkeit und Bonhomie, und Herr von Arden fuhr davon. Sobald der Professor aus seinem Gesichtskreise verschwunden war, hatte er wieder das undefinierbare unangenehme Gefühl, das ihn jedes Mal nach dem Zusammensein mit ihm beschlich.
„Wenn man doch reich wäre!“ seufzte er. „Reichtum bedeutet Unabhängigkeit!“
Aber er war nicht reich, und er hatte vier Kinder. Somit war er darauf angewiesen Karriere zu machen, und da hieß es beständig: lavieren, Kompromisse eingehen.
Und Schulen war so begabt und konnte ihm so nützlich sein. Melancholisch blickte er durch das Fenster des Coupés hinaus auf die Straße.
Da tauchte ein Großer, breitschultriger Mann vor ihm auf. Dem Impulse des Augenblicks folgend, gab der Präsident das Zeichen zum Halten des Wagens, und die Tür des Coupés öffnend, rief er hinaus:
„Herr Generaldirektor Blei!“
Der Angerufene wandte sein mächtiges, von dichtem, graumeliertem Haar umlocktes Haupt nach dem Wagen hin und trat grüßend näher.
„Sehr erfreut, Herr Präsident!“
„Sie sind im Begriff, zu Herrn von Schulen zu gehen?“
„Fällt mir gar nicht ein!“
„Aber Herr von Schulen erwartet Sie!“
„Das schadet ihm nichts und mir auch nicht!“
„Immerhin – es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit, ich bin zufällig informiert – haben Sie Zeit, Herr Generaldirektor?“
„Für sie habe ich immer Zeit, Herr Präsident!“
„Dann steigen Sie ein.“ Der Präsident lehnt sich hinaus und rief dem Kutscher zu: „Fahren Sie über die Promenade.“
Der Generaldirektor stieg ein.
„Es ist ein glücklicher Zufall, der Sie mir in den Weg führt“, begann Herr von Arden. Und er entwickelte ihm die ganze Angelegenheit mit Warozin und schloss damit, dass ein deutscher Käufer sich ein eminentes Verdienst um das Deutschtum erwerben würde, was höheren Ortes des größten Beifalls sicher sein würde.
Der Generaldirektor hatte ruhig zugehört, bloß in den Winkel seiner blauen Augen spuckte etwas wie ein unterdrücktes Lächeln.
„Herr Präsident“, sagte er endlich, „nach meiner Ansicht ist es ein höchst patriotisches Werk, ein heruntergewirtschaftetes Gut an einen Polen zu verkaufen, denn der verkracht sicher darauf, und dann ist man ihn los!“
„Herr Generaldirektor, ich habe in vollem Ernste gesprochen!“ sagte der Präsident vorwurfsvoll.
„Ich auch“, versicherte der Generaldirektor. „Anstatt eine Polenhetze zu organisieren, sollten wir vor unseren eigenen Türen kehren, unseren Kram in Ordnung halten und, ohne viel Geschrei zu machen, ein jeder auf seinem Posten fest stehen. Warum soll ich meinem Herzog Warozin anhängen oder warum soll ich meine ohnehin in Anspruch genommene Arbeitskraft noch mit der Bewirtschaftung eines eigenen Gutes beschweren?“
„Aber die nahe Nachbarschaft eines Polen kann doch für Sie nicht angenehm sein“, warf der Präsident ein.
Der Generaldirektor zuckte die Achseln.
„Davor fürchte ich mich nicht – höchstens sehen die Leute dann mit eigenen Augen, dass sie es bei mir besser haben als bei dem „Schlachzüzen“. (Szlachta – polnische Adel)
„Ich verstehe doch nicht, Herr Generaldirektor, dass sie diese Sache so ruhig ansehen. Bedenken Sie: der erste polnische Grundbesitz in einem Bezirk, in dem bisher nur deutsche ansässig waren. Schon die Unverschämtheit dieser Leute empört doch unsereins.“
„Verzeihen Sie, Herr Präsident, aber ich sehe hier nur die Konsequenz einer Tatsache sich vollziehen. Wir haben den Polen so viel Grundbesitz abgekauft, dass wir uns nicht wundern dürfen, wenn sie nun ihrerseits das von uns erworbene Geld in Gütern anlegen. Ich meine: kräftigen wir nur unseren deutschen Gutsbesitzerstand – das ist das beste Mittel gegen das Polentum. Und gerade weil ich die Phrasen des Professors von Schulen nicht ausstehen kann, gehe ich nicht zu ihm.“
„Ich bin erstaunt, Sie so sprechen zu hören, Herr Generaldirektor, und Ihr Urteil über Herrn von Schulen ist mir ebenfalls ganz überraschend.“
„Ja, Herr Präsident, ich kann keine Mördergrube aus meinem Herzen machen – mir liegt einmal dieses semitische Wunderkind nicht!“
„Meinen Sie den Professor von Schulen damit?“
„Allerdings – Sie sind erst zu kurze Zeit hier, Herr Präsident, um alle diese Verhältnisse zu kennen, aber unsereiner, der hier alt und grau geworden ist, kennt sich ja einigermaßen aus.“
„Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich einweihen wollten!“
„Gern, Herr Präsident, habe ich doch die Familie gekannt, noch ehe sie in diesem jüngsten hoffnungsvollen Sprossen gipfelte, denn Schulens Vater, der reiche Jude Schmule, war Pächter der herzoglichen Kohlengruben, in denen er seine Millionen erworben hat.“
„Davon hatte ich keine Ahnung“, murmelte der Präsident.
„Er spricht nicht gern von seinem Vater, der Herr Professor“, versetzt der Generaldirektor“, „aber er hat Unrecht damit, denn der alte Schmule ist in seiner Art ein ganzer Kerl, lebt als kaufmännischer Patrizier, der sich vom Geschäft zurückgezogen hat, in Berlin W., hat Einfluss an allen Ecken und Kanten und ist eine Persönlichkeit – heißt übrigens jetzt auch Schulen, hat nur den Adel dem Sohne allein überlassen. Der kam mit 16 Jahren als Wunderkind auf die Universität, machte den Dr. phil. und jur., wurde mit 22 Jahren habilitiert, mit 27 Jahren ordentlicher Professor – Leuchte der Wissenschaft, und da sein Vater aus den materiellen Gütern Gewinn genug gezogen hat, stürzte er sich auf die idealen Güter, die gerade en vogue sind, na – Sie wissen ja selbst, wie er in Patriotismus, Sozialreform, Flottenbegeisterung und dgl. macht. Er hat’s verstanden, Liebling im Kultusministerium und Schützling der allmächtigen Schmollergruppe zu werden – endet jedenfalls noch mal an hervorragender Stelle im Reichsamt des Innern – aber ich sage: Gott sei Dank, dass er mir in meinen Kram nicht hineinpfuschen kann – für mich bleibt’s ‘ne Kreuzung von Jud‘ und Jesuit!“
Der Generaldirektor sah ungeniert nach seiner Uhr.
„Verzeihung, Herr Präsident, aber ich möchte hier absteigen, ich habe noch einen wichtigen Abschluss heut zu machen.“
„Ich bin Ihnen dankbar für das Zeitopfer, das Sie mir gebracht haben – es hat mich alles sehr interessiert, wenn ich auch nicht umhin kann, Ihnen nochmals mein Bedauern auszusprechen, dass – “
„Ich bitte um Ihre Nachsicht, Herr Präsident!“
Der Generaldirektor verließ den Wagen und schritt grüßend davon.
Herr von Arden blickt ihm mit einem leisen Gefühl von Neid nach. Der da stand fest auf seinen Füßen und hatte den Mut der eigenen Meinung. Immerhin – so ungünstig er Schulen beurteilte, dass er einflussreich, von oben her gestützt und ein Mann mit einer Zukunft war, hatte er doch zugegeben.
Der Präsident seufzte tief auf und fuhr nachdenklich nach Hause.
Inzwischen saß Frau Maria von Mielosinska, die Gattin des Käufers von Warozin, auf einer der seidenen Ottomanen im orientalischen Salon der Villa Schulen, und die weiße, gepflegte Hand des Professors glitt liebkosend über ihr rötlich schimmerndes Haar, während er mit den weichsten Modulationen, deren seine Stimme fähig war, sagte:
„Ich tue alles für Dich, mein süßes Lieb; wenn es nicht anders geht, kaufe ich Warozin, und anstatt des von Dir so sehr gefürchteten Landaufenthaltes an der Seite Deines Mannes machen wir ein verstecktes Liebesnest daraus, in das wir uns ab und zu einmal flüchten, wenn uns die übrige Welt zu langweilig wird!“
Maria Mielosinska schmiegte sich lächelnd an seine Brust.
„Ich wusste, dass Du mir helfen würdest, Charles“, flüsterte sie, „ich würde sterben, wenn ich mit meinem Manne die Hälfte des Jahres au fond de la sampagne sitzen müsste, wie dieser schreckliche Schwager „Oberlandsgerichtsrat“ es haben will. Sie sprachen beide französisch, nur den deutschen Titel hatte sie in hartem gebrochenen Deutsch hervorgestoßen.
„Der Schwager ist ein Unmensch, eine Frau wie Du gehört nicht auf das Land“, sagte Charles. „Wie kommt Dein Schwager auf diese Idee?“
„O, er sagt, wir verbrauchen zu viel Geld in Paris, ein halbes Jahr sollen wir sparen.“ Sie lachte. „Kannst Du Dir mich als so eine Art von deutscher Hausfrau denken?“
„Nein, Schatz, das wäre, als ob man von einem Vollblute Ackerarbeit verlangte!“
„O ja, Du verstehst mich! Und dann handelt es sich noch um Lonka – ach Du – eigentlich ist es schrecklich, dass ich nächstens eine erwachsenen Tochter haben werde.“
„Wenn man als halbes Kind heiratet – die Konsequenzen der Tatsachen“, meinte er lächelnd. „Aber was hat Lonka mit den Wünschen Deines Schwagers zu tun?“
„Das ist eine Geschichte! Er sagt: in der Hand der Frauen liegt die Zukunft Polens – darin hat er ja Recht, dass wir Polinnen immer viel für unser Vaterland getan haben. Aber er findet uns – mich speziell, glaube ich – nicht auf der Höhe stehend. Er hat ein Programm für die Erziehung polnischer Frauen, sagte ich Dir – und darin steht, dass sie nicht zu früh in die Welt treten, ernsthaft erzogen, auf ihre Mission vorbereitet werden sollen. Und nun soll Lonka, wenn sie aus der Pension kommt, mit uns aufs Land gehen – so eine Dummheit! Jeder Polin liegt ihre Mission im Blute, so was lernt sich nicht und braucht keine Vorbereitung – ach, ich glaube mein Schwager erdolchte mich, wenn er wüsste, dass ich das alles einem Deutschen verrate! Aber Du bist gar kein richtiger Deutscher, mein Liebling, Du bist international!“
„So international wie die Liebe“, erwiderte er, den Arm um sie schlingend.