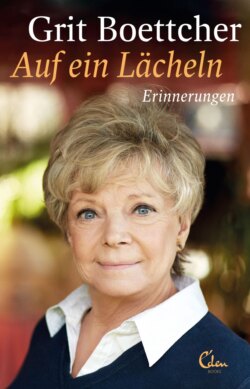Читать книгу Auf ein Lächeln - Grit Boettcher - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Start ins Leben
ОглавлениеAls ich auf die Welt komme, ist sie schon da. Meine Schwester ist knapp 19 Monate älter als ich, und alle nennen sie »Mausi«. »Mau« sage ich, als ich mit dem Sprechen anfange. Dann »Mausiii« – mit vielen Is. Vor allem wenn sie nicht in meiner Nähe ist. Für mich ist sie mehr als meine große Schwester. Sie ist mein zweites Ich. Und das gehört natürlich an meine Seite. Klar, dass ich Mama und sie zu Mausis Einschulung in die Berliner Lynarstraße begleite. Jedes Kind wird einzeln aufgerufen. Beim Namen »Gertrud« meldet sich niemand. Mama beugt sich zu Mausi: »Du bist gemeint. Gertrud ist dein offizieller Name. Aber für uns bleibst du die Mausi.«
Ich bin seit 1938 auf dieser Welt und bis heute die Grit. So steht’s auch in meinem Pass. Dass auf meiner Geburtsurkunde ein anderer Vorname eingetragen ist, erfahre ich wie Mausi erst bei der Einschulung. Da heiße ich auf einmal Margit. Mamas Erklärung diesmal: »Damals, bei deiner Geburt, waren kurze Vornamen nicht erwünscht. Der Hitler mochte sie wohl nicht.«
Mehr sagt sie nicht, und ich frage nicht weiter. Dass Eltern und Kinder über vieles reden, sich vertrauensvoll austauschen, das ist damals keine Selbstverständlichkeit, eher ein Unding. Mausi, unsere Freundinnen und ich kennen es nicht anders und vermissen den ehrlichen Austausch daher nicht. Auch der Krieg ist bei uns daheim tabu.
»Es gibt Weihnachten, Ostern, Geburtstage, und es gibt Krieg«, erklärt Mama es kurz. »Merkt euch einfach: Es kommt, wie es kommt.«
Es kommt, wie es kommt. Diesen Satz habe ich schon früh verinnerlicht. Und auf meine Art interpretiert: Was und wie es auch kommt, Mausi und ich müssen es hinnehmen. Kein Drama daraus machen, sondern lieber das Beste. Es zumindest versuchen.
Das tue ich bereits mit vier – auf etwas kuriose Art und Weise. Mama isst gern Innereien, besonders Nieren. Mausi auch. Ich nicht. Da bei uns aber »gegessen wird, was auf den Tisch kommt« und ich Mama nicht verärgern möchte, entwickle ich einen Plan und mache ihn meiner Schwester schmackhaft: »Wenn du meine Portion mitisst, kriegst du was von mir.«
»Was?«, fragt sie sofort.
»Die nächste Zuckerstange, die uns der Bäcker schenkt«, verspreche ich.
Mausi nimmt das Angebot an. Da Mama meist vor oder nach uns isst, bekommt sie unseren Handel nicht mit. Und wenn Mausi mal keine Lust auf eine zweite Portion hat, vergrabe ich die Nierchen einfach in den Kästen auf unserem Balkon. Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht. Hauptsache, Mama muss nicht schimpfen, weil ich meinen Teller nicht leer esse. Ohrfeigen tut sie uns nie. »Wenn ihr frech seid, gibt’s Hausarrest«, warnt sie uns manchmal vor. »Oder ich rede eine Woche nicht mit euch.«
Eine Woche kein Wort! Das wollen und können wir uns nicht vorstellen. Nein, wir möchten Mama nicht ärgern. Sie hat genug zu tun. Wie viele Frauen, deren Männer im Krieg sind, erzieht sie uns allein, ist gleichzeitig Mama und Papa. Als Sekretärin verdient sie für uns drei das Geld. Nebenher schmeißt sie den Haushalt und organisiert Mausis und meinen Alltag während der Stunden, in denen sie unterwegs ist. Viel Zeit für sie selbst bleibt da nicht. Auch nicht zum Schmusen mit uns oder zum Vorlesen.
Papa ist als Soldat erst in Frankreich stationiert, dann in Jugoslawien. Mama spricht nicht über ihn. Vielleicht fürchtet sie, dass sie dann weint. Das macht sie nie vor uns. Nur einmal sehe ich zufällig, wie sie ein Foto von Papa in der Hand hält und ihre Augen feucht schimmern. Sie hat sich immer unter Kontrolle – unseretwegen. Mausi und ich spüren das instinktiv. Es sind schwere Zeiten, das hören wir Kinder ständig da und dort. Mama sagt das nicht, sie möchte uns unsere Kindheit möglichst leicht machen.
Manchmal, wenn wir schon im Bett liegen, sitzt sie abends mit unserer Nachbarin Elsa in der Küche. Wir wissen nicht, worüber sie sprechen, aber sie lachen oft laut. Dann lächeln Mausi und ich uns an – und schlafen heiter ein.
Nicht vor anderen weinen – das übernehme ich schon früh von Mama. Wenn ich traurig bin oder mich verletzt fühle, mache ich das mit mir aus. Bis heute. Nur mit einem Unterschied: Als Kind habe ich mich zum Weinen auch mal in den Ästen von einem der Bäume in unserer Straße versteckt. In meinem Alter klettere ich nicht mehr.
Spielsachen haben Mausi und ich damals nicht – wie die meisten Kinder in unserem Mietshaus in Berlin-Spandau am Wolmirstedter Weg 7. Wir wohnen im zweiten Stock, haben zwei Zimmer. Ein Paar nebenan teilt sich eine Kammer. Eine fünfköpfige Familie mit viel Geld, so tuschelt man, residiert im Parterre mit Terrasse. Die Tochter ist ein paar Jahre älter als wir und trägt Kleider, die wir nur aus Schaufenstern kennen. Manchmal treffen wir uns alle ganz unten im Luftschutzkeller. Da hängen Gasmasken. Wenn alles ruhig ist, setzen wir sie auf und erschrecken uns gegenseitig. Die Erwachsenen lächeln dann nur.
Am liebsten spielen wir draußen auf der Straße. Da fahren kaum Autos, und es gibt Platz genug für Kästchenhüpfen, Ballspiele, Verstecken oder Rollschuhlaufen. Birgit, ein drei Jahre jüngeres Nachbarmädchen, hat welche. Die kann man kleiner und größer einstellen, und manchmal leiht Birgit sie mir. Ich habe schnell den richtigen Schwung raus, schwebe dahin, drehe Pirouetten.
»Dass dir nicht schwindlig wird«, wundert sich Mausi.
»Niemals«, erwidere ich. »Vielleicht werde ich ja mal Tänzerin.«
»Das ist doch kein Beruf«, sagt sie. »Ich werde Krankenschwester. Wie die Frau im Hinterhaus, die immer so ein Häubchen auf dem Kopf hat. Die hat mir gesagt, dass es wichtig ist, kranken Menschen zu helfen.«
Dazu fällt mir nichts ein. »Komm, lass uns Marienkäfer suchen!«
Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Eng aneinandergedrängt, Flügel an Flügel sitzen sie in den grünen Büschen in unserem Viertel. Manche haben gelbe Punkte, die schimmern wie Gold. Wir Kinder sammeln sie in kleinen Schachteln mit Luftlöchern. Wer nach einer Viertelstunde die meisten Käfer hat, hat gewonnen. Dann lassen wir sie wieder fliegen. Ich gewinne oft. Als ich Mama davon erzähle, sagt sie: »Vielleicht bist du ein Glückskind, Grit. Die kleinen Käfer gelten als Symbol für Glück und Fleiß.«
Mausi hört zu und zieht die Mundwinkel nach unten. »Ich möchte auch ein Glückskind sein. Aber ich mag das Spiel nicht.« Sie hat’s überhaupt nicht so mit Tieren. Wenn ich eine Schnecke von der Straße ins Gebüsch setze oder einen Wurm vor einem Vogel rette, sagt sie »Igitt« und schüttelt sich.
Sind wir uns sonst ähnlich? Wir sind beide blond wie unsere Mama. Mausi dunkel-, ich hellblond. Ich habe Streichholzbeinchen, sie nicht. Und was unsere Charaktere betrifft: Ich habe von klein auf meinen eigenen Kopf, sie passt sich schneller an. Aber das alles trennt uns nicht. Ob wir uns über Kleinigkeiten streiten, ich sie mal auf dem Balkon aussperre oder sie mich – zu zweit fühlen wir uns am besten.
Erst recht, als eine Nachbarin, die als Kinderschneiderin ihr Geld verdient, uns Stoffreste schenkt. Und dazu zwei kleine Püppchen, jedes circa zehn Zentimeter groß. »Ran an die Arbeit«, ermuntert uns Tante Tutta, wie wir sie alle nennen. »Die beiden Nackedeis brauchen eine Garderobe für alle Gelegenheiten.« Sie gibt uns auch noch Nadel und Faden und bringt uns die wichtigsten Stiche bei.
Was für ein Riesenspaß! Stundenlang entwerfen wir, schneidern und nähen: Kleider, Hosen, Jacken und den ganzen Rest. Mausi ist da geschickter und exakter. Ich bin etwas großzügiger, nicht so sorgfältig. Bei mir reißt eine Hose schnell wieder auf, bei ihr hält sie ein Puppenleben lang.
Tante Tutta näht auch ab und zu für uns. Mein Lieblingskleid ist hellblau, hat Puffärmel und einen leicht gefalteten Rock. Ich trage es, bis es nicht mehr passt und die Nähte platzen. Von da an faszinieren mich Falten- und vor allem Plisseeröcke. Die sind aber zu teuer für uns. Später, als ich mein erstes Geld verdiene, möchte ich mir einen Plisseerock kaufen. Als ich mich bei der Anprobe im Spiegel des Kaufhauses sehe, ziehe ich den Rock sofort wieder aus. Meine Beine, die ich bis heute zu dünn finde, sehen unter den Falten noch dürrer aus.
Von den Beinen zu den Füßen. Die wachsen in unserem Alter natürlich schnell – zu schnell für Mamas Geldbeutel. Ein-, zweimal im Jahr geht sie mit uns in einen Schuhladen in der Nähe. Beim Reinkommen sehe ich ein Paar in Mahagoni mit rötlichem Lack vorn an der Spitze. Die und keine anderen möchte ich haben. Es gibt sie nur noch in einer Größe. Zuversichtlich probiere ich sie an. Zu eng. Ich kneife meine Zehen so fest wie möglich zusammen, schnüre die Schuhe zu und mache ein paar Probeschritte. »Die sind so schön«, schwärme ich Mama vor, »und die passen ganz toll.« Ich bin keine gute Schwindlerin. Mama durchschaut mich sofort.
»Du gehst so komisch, Grit. Zieh sie bitte aus, wir messen mal deine Füße aus.«
Tschüs, Mahagonis! Die Schuhe, die Mama dann kauft, sind etwas zu groß, aber passen mit Einlegesohle genau und halten lang.
Sie überstehen auch unseren Aufenthalt bei Tante Anni und Onkel Gerd in Klein Kreutz bei Brandenburg. 1943 fahren wir mit Mama hin. »Wird Zeit, dass wir sie mal wieder besuchen«, sagt sie nur und drängt zur Eile.
Das Haus in Klein Kreutz liegt zwischen lauter Weinreben, es klebt regelrecht an einem Berg. Drinnen ist es ziemlich dunkel. Viele Fenster sind kaputt und mit Pappe verkleidet. Der Onkel murmelt irgendwas von »Luftangriffen«. In der Nähe hat er einen Bunker tief in die Erde gebaut und oben mit Sand zugeschüttet. Ganz flach, »damit die feindlichen Flieger ihn nicht von oben entdecken«, sagt er kurz. Mit einer kleinen Leiter können wir reinsteigen. Wir Kinder – es sind noch andere Verwandte da – finden das aufregend. Angst haben wir nicht. Auch nicht vor den Bomben, die wie Weihnachtsbäume leuchten, wenn mal wieder welche vom Himmel fallen. Wir finden sie einfach schön, wissen nichts von ihrer schrecklichen Wirkung. Gern schauen wir ihnen zu und müssen oft mehrfach ermahnt werden, bis wir endlich in den Bunker klettern. Letztlich überlassen uns die Erwachsenen aber unserer Arglosigkeit.
Mama bleibt nur einen Tag in Klein Kreutz. Sie muss in Berlin arbeiten. Mausi und ich haben keine Zeit, um traurig zu sein. Es gibt so viel Ablenkung und Abwechslung hier. Allein das große Spargelfeld, die vielen Krautköpfe und der riesige Kartoffelacker! Erst buddeln wir die Kartoffeln aus, später dürfen wir die neuen Pflanzkartoffeln mit dem Keim nach oben hineinsetzen und leicht andrücken. Die Arbeit mit den Kartoffeln mag ich am liebsten, weil die Erde so gut riecht.
Unsere »Ferien auf dem Land« mitten im Krieg enden abrupt. Urplötzlich ist Mama wieder da, treibt uns an. Wir müssen nach Radl bei Gablonz im Sudetenland. Warum, sagt sie mal wieder nicht. Und wir fragen auch nicht. Dieses schnelle Abreisen gehört zu unserem Alltag. In Radl haben wir weniger Platz als in Berlin, aber die Nachbarn sind freundlich und hilfsbereit wie daheim in Spandau. Als Mama schnell wieder verschwindet, kümmert sich eine der sudetendeutschen Frauen um uns. Sie trägt immer sieben oder acht Röcke übereinander und lacht viel.
Irgendwann ist Mama wieder da. Aber nicht allein. In ihren Armen hält sie ein Baby: Manni – unseren kleinen Bruder Manfred. Dass sie schwanger gewesen ist, haben wir Mädels nicht mitbekommen. Hat Mama einen dicken Bauch gehabt? Vermutlich. Aber unaufgeklärt, wie wir mit unseren sechs und acht Jahren sind, hätten wir daraus keine Schlüsse ziehen können. Wir kennen ja noch nicht mal den Klapperstorch.
Der kleine Manni entpuppt sich als großer Charmeur und erobert Mausis und mein Herz auf Anhieb. Wie er in Mamas Bauch gekommen ist, dass Papa wohl etliche Monate vorher mal zu Besuch in Berlin gewesen sein muss – offenbar in unserer Abwesenheit –, das reimen wir uns erst später zusammen.
Nach ein paar Monaten in Radl soll’s zurück nach Berlin gehen. Es ist Frühling und schon extrem heiß. Trotzdem laufen wir herum wie im Winter, tragen vier, fünf Kleidungsstücke übereinander: Mäntel, Jacken, Pullover. Der Grund: Wir haben nur noch einen Koffer. Dazu ein klappriges Kinderwägelchen, in dem Manni liegt. So marschieren wir los. Erst mal Richtung Dresden.
Irgendwann kommen wir zu einem kleinen Bahnhof. Als würde er auf uns warten, steht da schon ein Zug bereit. »Schnell, schnell«, macht Mama uns Beine, »da müssen wir hin und irgendwie rein!« Allerdings wollen das nicht nur wir. Immer mehr Menschen mit Koffern, Kisten, Bollerwagen, selbst mit Ziegen kommen dazu, drängeln, schubsen und stoßen. Ich falle mehrmals hin. Mannis Wagen bleibt stecken und hat danach einen Achter im Rad. Mama atmet schwer. Einmal legt sie sich neben dem Bahnsteig hin und schläft kurz ein. Als sie wieder aufwacht, hat sie rosige Bäckchen, und links in ihrem Gesicht kleben kleine Steinchen wie Mosaike. Die Sonne scheint auf dieses Kunstwerk, und Mama sieht im Licht wunderschön aus.
»Weiter geht’s«, sagt sie matt, »lauft hinter mir her.« Das ist in dem Gedränge nicht einfach. Ich konzentriere mich ganz fest auf Mannis Wagen, will ihn nicht aus den Augen verlieren – und merke, wie ich plötzlich zittere. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich eine Riesenangst. Angst, Mama und meine Geschwister in dem Chaos zu verlieren.
Irgendwie schaffen wir es alle vier in den Zug. Aber wir können nicht zusammenbleiben. Die nachkommenden Menschen schieben, pressen und wühlen sich zwischen uns. Mausi sehe ich gar nicht mehr, Mama ist ganz weit vor mir, in eine Ecke abgedrängt. Fremd aussehende Männer kämpfen sich ihren Weg frei, boxen sich regelrecht durch die Massen. »Das müssen die Russen sein«, höre ich jemanden sagen. Ich zucke zusammen. Von den Russen, erinnere ich mich, ist immer mal wieder hinter vorgehaltener Hand gesprochen worden. Es werden immer mehr. Drohend schwenken sie ihre Fäuste. »Uri, Uri«, brüllt einer in meiner Nähe, reißt einer alten Frau die Uhr vom Handgelenk und stürzt sich auf die nächste, begrapscht sie. Sie wehrt sich – und kriegt seine Faust ins Gesicht.
Mir wird schwindlig. Nur der Gedanke an Mama, Mausi und Manni hält mich irgendwie auf meinen Kinderbeinen. Mit letzter Kraft ziehe ich mich an einer Kiste vor mir hoch, quetsche mich an den Rand, halte Ausschau nach Mama. Plötzlich entdecke ich sie, gar nicht mehr so weit weg.
Ein bärtiger Typ mit einer Waffe steht vor ihr. »Uri, Uri«, schreit er Mama an, zerrt an ihrer Hand, richtet dann seine Pistole auf ihre Brust. Mama, die keine Uhr hat, schüttelt den Kopf, greift neben sich in den Kinderwagen und hebt unseren Bruder hoch, presst ihn an sich. Eingekeilt, mit brennenden Augen schaue ich zu ihr: Will sie mit Manni sterben? Ein Schuss, und wir Mädchen hätten keine Mutter und keinen Bruder mehr. Schlagartig wird mir klar, wie schnell alles vorbei sein kann.
Während ich noch überlege, wie ich Mama helfen kann, treffen sich unsere Blicke. Tränen kullern über meine Wangen. Es soll das erste und letzte Mal sein, dass ich in der Öffentlichkeit weine.
Da ertönt eine laute weibliche Stimme. Mit einem Rucksack vor dem Bauch schiebt sich eine Frau mutig hinter Mama vor, gestikuliert und ruft dem Mann mit der Waffe irgendwas in seiner Sprache zu. Zwei-, dreimal. Er zögert. Dann gibt er Mama einen Stoß und läuft »Uri« brüllend weiter.
Wie von selbst rutsche ich auf die Knie, den Kopf unter den Armen vergraben. Irgendwann höre ich Mamas Stimme, dann Mausis. Ich blinzle, atme auf. Wir sind wieder zusammen.
Aber der Albtraum ist noch nicht zu Ende. Nach weiteren Fußmärschen drängen wir uns wieder in einen Zug. Mama schiebt uns durch ein offenes Fenster ins Innere, eine Frau mit verweinten Augen hilft ihr mit dem Wägelchen. Sie hat auch einen Kinderwagen neben sich, verdeckt mit einem Tuch. Unterwegs kommen die beiden ins Gespräch. Sie reden leise, aber laut genug für uns. »Ich habe große Angst, dass mein Sohn verdurstet«, sagt Mama. »Ich kann ihn nicht stillen, habe auch kein Milchpulver oder Wasser.«
Die andere Frau legt ihre Hand auf die von Mama. »Ich kann Ihnen helfen. Es soll wohl so sein. Ich habe Milch …« Sie wischt sich über die Augen. »Mein Kleiner braucht sie nicht mehr. Er ist tot. Ich hatte ihn erst auf dem Arm, dachte, so sei er in der Menge sicherer. Aber dann kamen Männer, die haben mich eingekesselt und ihn erdrückt.« Mehr kriegen Mausi und ich nicht mit. Im Stehen, dicht aneinandergelehnt, schlafen wir ein.
Der Weg Richtung Dresden zieht und zieht sich. Irgendwann kommen wir zu einer riesigen Halle, wo wir mit unglaublich vielen Menschen Unterschlupf finden. Zu dritt liegen wir auf einer Matratze, Manni schläft in seinem maroden Wägelchen. Seine »Amme« haben wir leider im Gewirr aus den Augen verloren, aber in der Halle gibt es Milchpulver und Wasser. Dieses Wasser ist bis heute das beste, das ich je getrunken habe. Mein Überlebens-Wasser.
Wir bleiben drei Tage dort. In der letzten Nacht wache ich auf, laute Stimmen haben mich geweckt. Lichter gehen an, Menschen fallen sich um den Hals, lachen, weinen, singen. »Der Krieg ist vorbei«, sagt Mama und schaut, als könne sie es selbst nicht glauben. Lächelnd hebt sie unseren kleinen Bruder aus seinem Wagen, holt ihn in unsere Mitte.
Es ist der 8. Mai 1945.
Zurück in Berlin können wir nicht gleich in unsere zwei Zimmer. Die sind von fremden Menschen besetzt. Deshalb ziehen wir vorübergehend in die Wohnung von befreundeten Nachbarn, die noch außerhalb auf dem Land untergekommen sind.
Nach knapp zwei Wochen ist unser Zuhause wieder frei. Als Mama den Schlüssel in die Wohnungstür steckt, bin ich aufgeregt. Doch schon beim Hereinkommen fühle ich mich geborgen und angekommen. Fast andächtig streiche ich mit der Hand über den Küchentisch, den Stuhl in der Ecke, meine Lieblingstasse im Schrank.
»Ich komme mir vor wie einer der kleinen Vögel vor unserem Haus, der aus dem Nest gefallen ist und irgendwie wieder zurückfindet«, sage ich zu Mausi.
Sie nickt. »Ich mir auch.«
Mama hört unsere Worte. Und sie, die ihre Emotionen fast immer unter Kontrolle hat, drückt uns ganz fest an sich und sagt leise: »Jetzt fehlt nur noch Papa.«