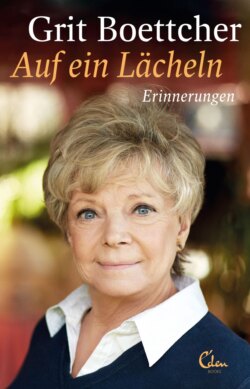Читать книгу Auf ein Lächeln - Grit Boettcher - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Morgen ist ein neuer Tag
ОглавлениеDie Woche darauf blättere ich die Zeitung vom Vortag durch, die uns ein Nachbar immer vor die Tür legt. Auf der vorletzten Seite fällt mir eine rot umrandete Anzeige ins Auge: »Suche Talente! Adrienne Mirau Ballett«.
Wie elektrisiert zeige ich die Annonce meinen Eltern.
»Und du glaubst, du bist ein Talent?«, fragt meine Mutter lächelnd.
»Ja«, sage ich sofort. »Ja, das glaube ich.«
»Dann versuch’s«, sagt Mama und streicht mir über den Kopf. »Viel Glück!«
»Wenn’s klappt, können wir das aber leider nicht bezahlen«, mischt sich Papa ein.
»Das macht nichts«, erwidere ich ganz Feuer und Flamme. »Das kriege ich irgendwie schon hin.«
Die nächsten Tage höre ich mich in unserem Viertel um, ob irgendwo eine Aushilfe gesucht wird. Zusätzlich knöpfe ich mir Anzeigen und Aushänge vor. Ich habe Glück. Im Nu finde ich zwei Stellen. Bei einer alten Dame, einer früheren Schauspielerin, putze ich für vier Mark die Stunde. Und im Salon Görst, in dem ich als Modelchen angefangen habe, wasche ich im Lauf der Zeit Hunderten von Frauen die Haare. Meine Finger sind dünn und drahtig und damit offenbar genau richtig für die Kopfmassage. Oft loben die Kundinnen mich. Bald darf ich auch die Farbe auftragen und, wenn es besonders voll ist, auch mal die Wickler eindrehen. Auskämmen darf ich im Salon nicht – dafür daheim bei Mama und Mausi.
Klar, dass die Schule zu kurz kommt. Aber nicht nur bei mir. In diesen Überlebensjahren versuchen viele Jugendliche, nebenher Geld für ihre Familien und sich selbst zu verdienen. Und die Lehrer drücken meist beide Augen zu.
Ein bisschen aufgeregt rufe ich bald bei dem Ballettstudio an. Frau Mirau geht selbst an den Apparat. Sie hat eine sympathische Stimme und lädt mich für den nächsten Nachmittag zum »Kennenlernen« ein. Ich stelle sie mir in einem Trikot oder in Strumpfhosen vor. Falsch gedacht. Sie begrüßt mich in einem Glockenrock mit Bluse und Jacke. Dazu trägt sie Schlappen, besser gesagt Schläppchen. Die behält sie auch beim Vormachen an.
Sie zeigt mir ein paar Schritte. Als ich sie wiederhole, lobt sie meine Haltung und meinen Körperbau. »Je öfter du zum Üben kommst, umso schneller merkst du erste kleine Erfolge«, sagt sie beim Abschied. Was der Unterricht kostet, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls kann ich ihn mir leisten. Das ist für mich mit meinen 14 Jahren die Hauptsache.
Meine Eltern beglückwünschen mich herzlich.
»Pass aber auf, dass du dich nicht übernimmst«, sorgt sich Mama, und Papa nickt.
»Vergiss bei allem das Essen nicht, Grit. Du bist eh schon zu dünn.«
»Ich krieg das schon hin.«
Gesagt, aber nicht getan. Denn zum Essen komme ich in dieser Zeit kaum. Wenn ich nach der Arbeit vom U-Bahnhof zur Ballettschule Ecke Bundesallee gehe, muss ich an einer Patisserie vorbei. Da gönne ich mir jedes Mal eine Marzipan-Praline. Manchmal mache ich mir daheim dann noch Makkaroni mit Rührei und Tomatenmark. Aber meist habe ich keinen Appetit, sondern bin nur noch müde.
Frau Miraus Schule ist in einer alten Villa im Hochparterre untergebracht. Mindestens zwei Stunden bin ich täglich dort und übe. Im Steppen und auf Spitze bin ich schnell richtig gut. Dass ich unter den Elevinnen auffalle, liegt aber mehr an meinem Trikot. Während alle anderen in Schwarz trainieren, schwirre ich wie ein bunter Vogel herum. Nicht ganz freiwillig, sondern eher aus der Not heraus. Mein Anzug besteht aus vielen Wollresten – und wächst mit. Wenn er zu eng wird, trennt Mama, eine wunderbare Strickerin, ihn wieder auf, verlängert ihn und näht ihn neu zusammen. Auslachen tun mich die »Schwarzen« deshalb nicht. Und wenn, wäre es mir auch egal.
An Silvester hat unsere Ballettgruppe einen Auftritt in einem Hotel am Ku’damm. Unsere Eltern sind auch eingeladen, sie haben einen kleinen Tisch für sich. Das Orchester spielt gängige Schlager wie O’ Cangaceiro von Zaubergeiger Helmut Zacharias oder Es liegt was in der Luft mit Mona Baptiste und Bully Buhlan als Interpreten. Wir Mädchen steppen in glitzernden Kostümen, tanzen mit Kastagnetten und verabschieden uns mit einem Spagat.
Eine Viertelstunde vor Mitternacht sind wir wieder umgezogen und bei unseren Familien. Als Papa mit Mama aufs Parkett verschwindet, bittet mich ein Mann mit etwas schütterem Haar zum Tanz. Er sagt kein Wort und tanzt nicht so gut wie Papa, aber auch nicht schlecht. Als der Dirigent den Donauwalzer ankündigt, singen viele mit: »Donau so blau, so schön und blau.« Eine Minute vor Mitternacht bleiben wir wie alle anderen stehen und zählen mit: »50 … 49 … neun … null!« Korken knallen, und Feuerwerkskörper explodieren am Himmel. Ich halte Ausschau nach Papa und Mama, habe meinen Tänzer fast vergessen, da presst er plötzlich seine Lippen auf meinen Mund.
»Was soll denn das?«, fahre ich ihn an und laufe davon.
»Da hat mich einer geküsst«, sage ich atemlos, als ich bei meinen Eltern bin. Ich wische mir mit dem Handrücken über die Lippen und schüttle mich. »So habe ich mir meinen ersten Kuss nicht vorgestellt.«
»Mach dir nichts draus«, sagt Papa lachend. »Das gehört an Silvester einfach dazu.«
Ich druckse herum, möchte etwas fragen, traue mich aber nicht. Doch die Frage lässt mich nicht los: Was, überlege ich mir später im Bett, was, wenn ich jetzt ein Kind bekomme?
Ein paar Tage später erzählt mir Brigitte, eine Freundin, dass ihr Schwarm, der Fritz, sie an Silvester endlich geküsst hat. »Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe«, strahlt sie mich an. »Wir gehen jetzt miteinander.«
»Bist du nicht zu jung für ein Baby?«, platze ich heraus.
»Ein Baby?« Irritiert schaut sie mich an. »Geht das so schnell?« Sie ist genauso wenig aufgeklärt wie ich, merke ich und zucke die Schultern.
»Könnte ja sein. Genau weiß ich das auch nicht.«
»Ich frage meine Cousine«, sagt Brigitte. »Die hat schon zwei Kinder.«
Die Antwort der Cousine fällt dann recht kurz aus: »Da muss mehr zwischen Mann und Frau passieren.«
Erleichtert hake ich das Thema ab und konzentriere mich nun noch mehr aufs Ballett. Nach einer Matinee taucht Frau Mirau mit einem Mann ungefähr Mitte dreißig auf. Er heißt Siegfried, nennt sich Sieg, ein grau melierter Lulatsch, der sich für den Größten hält und Modell-Lehrer ist. Er hat ein paar Aufführungen von uns gesehen und möchte ein paar Mädchen nebenher für Modepräsentationen engagieren und uns dafür schulen.
Adrienne Mirau ist es recht. »Das ist eine zusätzliche Werbung für mein Studio. Deshalb, ihr Süßen, legt euch ins Zeug. Für euch und für mein Studio.«
Da ich als Kleinste und Dünnste immer jünger geschätzt werde, rechne ich mir keine Chancen aus. Doch Sieg möchte mich dabeihaben. Der Unterricht findet bei ihm zu Hause am Olivaer Platz statt. Im Wohnzimmer wird der Tisch zur Seite gestellt, dann geht’s los. Ein Mädel nach dem anderen – ein zweites passt nicht rein. Drehen und Hüfte einknicken, die Arme nicht schlenkern, lächeln.
Nach fünf, sechs Proben treten wir da und dort auf. Wir bekommen jede zehn Mark und haben Spaß. An einem Freitag im Sommer treten wir im Modesalon von Robbie Buer auf, kommen durch eine Tür rein, machen drei, vier Hüftknicke und verschwinden durch eine andere Tür wieder. Ich präsentiere Größe 34 und mache den Anfang.
Nach der Schau sitze ich noch kurz mit ein paar Mädchen auf dem Boden. Sie wollen etwas unternehmen, ich möchte lieber nach Hause. Mama ist allein. Papa ist übers Wochenende mit Manni bei Verwandten und hilft ihnen beim Umzug. Und Mausi hat Nachtdienst, sie wird Krankenschwester.
Es ist sehr schwül. Der Himmel draußen wird immer schwärzer. Ein Gewitter liegt in der Luft. Eine Dunkelhaarige, die ein paar Jahre älter als ich ist und nur ab und zu dabei, kommt zu mir. »Du wohnst doch in Spandau«, sagt sie. »Ich werde abgeholt. Wir können dich mitnehmen und unterwegs absetzen. Dann bleibst du trocken.«
»Nein danke«, erwidere ich. »Bis zur U-Bahn schaffe ich es schon noch.« Wir lassen keine Fremden in die Wohnung und steigen auch nicht in deren Autos, das haben Mausi und ich schon früh gelernt. Und diese Schwarzhaarige ist mir fremd. Ich weiß noch nicht mal ihren Namen.
Kaum ist sie verschwunden, donnert es draußen. Blitze zucken. Prompt taucht die Dunkelhaarige wieder auf. »Willst du immer noch zu Fuß zur U-Bahn?«
Ein Blick aus dem Fenster, und ich verdränge Mamas Warnung. »Überredet«, sage ich und greife nach meiner Tasche. Der Wagen wartet schon. Der Fahrer nickt mir kurz zu. Er ist so um die dreißig und spricht mit Akzent. Müde lehne ich mich hinten in meinem Sitz zurück, bin froh, dass ich nicht im prasselnden Regen unterwegs bin. Ehe ich michs versehe, schlafe ich ein.
Als der Wagen stoppt, wache ich wieder auf. Die Schwarzhaarige dreht sich zu mir um. »Tut mir leid, ich habe was vergessen. Ich steige jetzt aus.«
»Ich komme mit.« Schlagartig habe ich so ein komisches Gefühl und möchte auf keinen Fall mit dem Kerl am Steuer allein sein.
»Quatsch«, erwidert die Dunkelhaarige. »Mein Freund bringt dich schnell nach Hause.«
Weg ist sie. Ein paar Minuten später halten wir vor einem Haus mit rostfarbenen Klinkern. »Hier wohne ich nicht«, sage ich.
Der Mann mustert mich im Rückspiegel. »Ich muss kurz was erledigen, dann geht’s weiter.« Er öffnet die Wagentür. »Nimm deine Tasche mit, falls es doch länger dauert.«
Unsicher steige ich aus und folge ihm, vorbei an einem bellenden Kettenhund. Im ersten Stock ist eine Tür offen. Und schon werde ich dort hineingeschoben. Ich sehe ein Sofa, ein breitschultriger, beleibter Typ sitzt darauf. Er trägt kurze Hosen zum ärmellosen Hemd, winkt mich heran und verzieht die Lippen zu einem Lächeln. Aber seine Augen sind kalt, sie taxieren mich. Blicke, wie ich sie schon einmal auf unserer Flucht zurück nach Berlin erlebt habe.
Wie damals wird mir etwas schwindlig. Ich will weg. Sofort. Doch da ist der Fremde schon bei mir, fasst mich fest am Arm und zieht mich zur Couch. »Hab dich nicht so«, höre ich ihn sagen. Was dann passiert, kann und will ich bis heute nicht in Worte fassen.
Irgendwann ist er weg. Ich habe nicht die Kraft, aufzustehen. Möchte einschlafen und nie wieder aufwachen. Wie von Weitem höre ich die Stimme des Fahrers. »Nimm deine Tasche und verschwinde«, herrscht er mich an. »Beeil dich.«
Irgendwie schleppe ich mich die Treppe runter, wieder an dem kläffenden Hund vorbei. Unten auf der Straße suche ich meinen Geldbeutel. Er ist weg. Ohne Fahrschein und ohne Geld komme ich nicht nach Spandau. Um mich herum ist alles dunkel, kein Mensch ist unterwegs. Aber noch mal zurück in dieses Schreckenshaus?
Ich habe keine andere Wahl. Vor der Haustür steht der Fahrer, den Arm um eine Frau mit einer weit geöffneten Bluse gelegt. Ich drehe den Kopf zur Seite, sage stockend: »Mein Portemonnaie ist weg. Ich brauche Geld für die Fahrkarte.«
»Warte.« Er verschwindet mit der Frau, kommt allein zurück und gibt mir einen Schein. »Und jetzt hau ab!«
Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, also gehe ich einfach in die Richtung, aus der wir gekommen sind. Irgendwann erreiche ich eine U-Bahn-Station und begreife, dass ich im Osten bin. Weit weg von Spandau. Nach einer kleinen Ewigkeit kommt die Bahn. Sie scheint leer. Ich muss in Ruhleben aussteigen, dann mit dem Bus weiterfahren, hämmert eine Stimme in mir. Sofort hämmert eine andere zurück: »Du gehörst da nicht mehr hin, du gehörst nirgends hin. Du bist eine Schande!« Taumelnd lehne ich mich im U-Bahn-Waggon neben die Tür, suche einen Halt und taste nach dem Griff. In meinem wirren Kopf keimt ein Gedanke: Wenn ich die Tür öffne, mich einfach rausfallen lasse, ist alles vorbei: die Schande, die Scham, die Schmerzen. Mit letzter Kraft und beiden Händen ziehe ich die Tür einen Spalt auf, spüre die kühle Nachtluft …
… und plötzlich spüre ich noch etwas anderes. Arme umfassen mich, reißen mich zurück. Kein Luftzug mehr, die Tür ist wieder zu. Wie von weit her höre ich eine Stimme, tief und freundlich: »Mach so was nie wieder!«
Es dauert eine Weile, bis ich realisiere, wem die Stimme gehört. Der Mann ist weißhaarig, hat ein zerfurchtes Gesicht und helle, freundliche Augen. Er zieht mich zu einem Sitz und reicht mir seine Wasserflasche. Nach ein paar Schlucken fange ich an, zu zittern. Er hängt mir seine Jacke über die Schultern. »Was immer dir passiert ist, denke daran: Morgen ist ein neuer Tag.« Er beugt sich vor und sucht meinen Blick. »Das habe ich von klein auf meinen Kindern gesagt. Meiner Tochter und meinen Söhnen. Für meine Jungs gibt es kein Morgen mehr. Sie haben den Krieg nicht überlebt.«
Seine Stimme zieht mich in ihren Bann. »Das tut mir leid«, sage ich leise.
»Danke«, erwidert er. »Aber meine Botschaft für dich ist: Du lebst. Sei froh und mach was daraus.«
Er steigt mit mir in Ruhleben aus, sucht eine Telefonzelle. »Ruf zu Hause an. Sag, dass ich dich bis nach Spandau bringe. Vielleicht kann dich da jemand abholen.«
Mama ist am Telefon. Ich kann nur stammeln: »Bring eine Hebamme mit.«
Meine Mutter stößt einen Schrei aus. »Du, du … Flittchen!« Kraftlos lasse ich den Hörer baumeln. Der Mann greift danach, spricht mit Mama.
Als wir mit dem Bus ankommen, ist sie schon da, läuft auf mich zu und umarmt mich, als hätten wir uns Jahre nicht gesehen. »Mein Liebes, bitte verzeih mir. Ich habe das nicht so gemeint. Aber ich hatte solche Angst um dich. Niemand hat gewusst, wo du bist. Nur, dass du mit jemandem weggefahren bist.«
Lange halten wir uns gegenseitig fest.
»Ich störe nur kurz.« Die Stimme des weißhaarigen Mannes, meines Schutzengels, wie Mama ihn später nennt, holt uns zurück in die Gegenwart. Er verabschiedet sich. Im Gehen dreht er sich noch einmal zu mir um: »Denk dran, Grit: Morgen ist ein neuer Tag!«