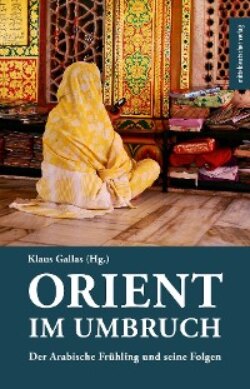Читать книгу Orient im Umbruch - Группа авторов - Страница 9
Afghanistan – Politik der Scheinheiligkeit
ОглавлениеAfghanistan steht vor einer unsicheren Zukunft. Die Kampftruppen der NATO-Staaten hinterlassen bei ihrem Abzug 2014 ein innerlich zerrissenes Land. In verschiedenen Provinzen herrscht Bürgerkrieg, der in den vergangenen Jahren weder militärisch noch politisch beendet werden konnte. Die politische Elite bilden mehrheitlich ehemalige Kriegsfürsten, die sich während der 13-jährigen Einmischung ausländischer Staaten schamlos bereichert haben. Sie nutzten ihre Machtpositionen, um Teile der internationalen Hilfen in ihren Besitz zu bringen.
Diese weltweit beispiellose Korruption hat die Kluft zwischen den staatlichen Institutionen und der Bevölkerung vergrößert und den unterschiedlichen Gruppen von Aufständischen in die Hände gearbeitet. Da sich ein Ende von Misswirtschaft, Veruntreuung und Bestechung nicht abzeichnet und auch von den ausländischen Gebern errichtete Kontrollinstitutionen abgebaut werden, bedeutet der Rückzug von fremden Soldaten und Entwicklungsspezialisten für die Bewohner der ländlichen Regionen eine Gefährdung der in den vergangenen 13 Jahren erzielten geringen Verbesserungen des Lebensstandards. Zwar werden die internationalen Geberländer ihre zivile Hilfe in einem kleineren Maße weiterführen, doch diese Projekte können die Auswirkungen der Misswirtschaft auf die ländliche Bevölkerung nur abschwächen, jedoch keinen Wirtschaftsaufschwung im Lande auslösen.
Somit steht Afghanistan als ein Beispiel für das Scheitern westlicher Entwicklungspolitik. Trotz des Einsatzes von Hunderten von Milliarden Dollar wurden weder die sicherheits- noch die entwicklungspolitischen Ziele erreicht. Dabei hatte sich die internationale Gemeinschaft nach dem Sturz der Taliban im Krieg im Herbst 2001 als Ziel den Aufbau einer Zivilgesellschaft gesetzt und wesentlich geringere Ausgaben erwartet. Doch bereits die Konferenz auf dem Petersberg bei Bonn und die kurze Zeit später erfolgende Aufstellung der Internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe (International Security Assistance Force, ISAF) der NATO-Staaten zeigten, dass die internationale Gemeinschaft die Probleme beim Wiederaufbau Afghanistans unterschätzt und dabei falsche Prioritäten gesetzt hatte.
Unter den 28 afghanischen Delegierten, die an der Konferenz (vom 27. November bis 5. Dezember 2001) teilnahmen, befanden sich keine Vertreter, Anhänger oder Sympathisanten der gestürzten Taliban-Regierung. In einem Stufenplan wurde auf dem Petersberg die Bildung demokratischer Strukturen geplant und der von den USA favorisierte Hamid Karzai als künftiges Staatsoberhaupt bestimmt. Die Entsendung der ISAF-Kontingente verschaffte der NATO zwar ein neues Aktionsfeld und eine aktuelle Legitimität, schuf aber die Voraussetzungen dafür, dass eine verfehlte Aufbaupolitik durch militärischen Einsatz abgesichert und vor einem frühen Scheitern bewahrt wurde.
Diese der Logik der Waffen folgende Politik, die auf ein militärisches Vorgehen setzte und 2001 derjenigen der US-Regierung unter Präsident George W. Bush entsprach, konnte bis zum Abzug der Kampftruppen nicht überwunden werden. Deutschland beteiligte sich vor allem aus Rücksicht auf die USA an einer derartigen Afghanistan-Politik, ohne das eigene Ziel des Aufbaus zivilgesellschaftlicher Strukturen nur ansatzweise verwirklichen zu können. Gleichzeitig war die Koalition von Sozialdemokraten und Grünen aber nicht bereit, genügend finanzielle Mittel für die Erreichung dieses Ziels bereitzustellen. So verpflichtete sich die Regierung, für den Neuaufbau der afghanischen Polizei zu sorgen und die internationalen Bemühungen hierfür zu koordinieren. Für das Programm stellte das Auswärtige Amt jedoch jährlich gerade einmal zwölf Millionen Euro bereit.
In den Monaten nach dem Sturz der Taliban war den Verantwortlichen in Berlin nicht klar, worauf sich Deutschland in Afghanistan einlassen würde. Ihnen fehlte auch der politische Wille, eine eigenständige Politik gegenüber Afghanistan zu entwickeln. Damit war auch die deutsche Politik letztlich vom militärischen Einsatz geprägt, und dessen Kosten betrugen nach den Schätzungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin jährlich bis zu drei Milliarden Euro. Damit kommen die Wissenschaftler des Instituts zu einem anderen Ergebnis als die Parteien, die im Bundestag den Kriegseinsatz am Hindukusch beschlossen und jährlich verlängert haben. Sie folgten den Ansätzen der Bundesregierung, die die Zusatzausgaben für den Bundeswehreinsatz zu Beginn mit 300 Millionen Euro jährlich veranschlagte. Nach jährlichen Steigerungen wurden für das Jahr 2010 eine Milliarde Euro genannt.
Bereits der Afghanistan-Krieg im Herbst 2001 wurde von der Regierung in Berlin nur halbherzig unterstützt, weil es Vorbehalte gegen den „Krieg gegen den Terror“ gab, wie er von der US-Regierung geführt wurde. Schließlich hatten die USA in den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts während des afghanischen Widerstandskrieges gegen die Sowjetarmee mit den Mujaheddin-Gruppen in Pakistan ein Netzwerk islamischer Glaubenskämpfer mit aufgebaut, ausgerüstet und finanziert, in dem die al-Qaida verwurzelt war. Im Krieg gegen diese Gruppierung wurde Afghanistan ein erstes Opfer.
Das Land wird wegen der weitgehend gescheiterten Politik der von den USA dominierten internationalen Gemeinschaft auf Jahre auf ausländische Hilfe angewiesen sein. Unter westlicher Planung wurde ein Sicherheitsapparat von allein mindestens 350.000 Soldaten und Polizisten aufgebaut, den Afghanistan aus eigener Kraft nicht bezahlen kann. Die Unterhaltung von Militär und Polizei erfordert in den kommenden Jahren jeweils vier Milliarden Dollar. Allein dieser Betrag übersteigt den Resthaushalt des Landes. Wie kläglich der zivilgesellschaftliche Ansatz gescheitert ist, wird auch daran deutlich, dass die afghanische Armee von ausländischen Beratern fast ausschließlich auf den Einsatz im Inneren vorbereitet wurde.
Die künftige Finanzierung dieses Sicherheitsapparates konnten die USA bei den langwierigen Verhandlungen über das Abkommen zur Stationierung ausländischer Truppen nutzen, um sich Privilegien für ihre Armeeangehörigen und die Mitarbeiter ziviler Sicherheitsfirmen zu sichern. Vor allem die Immunität ausländischer Soldaten und Berater sowie die genaue Dauer des Abkommens und die Befugnisse von Spezialeinheiten waren umstritten. Selbst in Kabul stationierte Diplomaten hatten keine Kenntnis von den wichtigen Details bei den monatelangen Verhandlungen. Es blieb auch unklar, ob die USA ein mögliches Abkommen zwischen Afghanistan und der NATO über den weiteren Aufenthalt von Militärberatern und die Fortsetzung von Militärhilfe akzeptieren würden.
Karzai hatte sich im November 2013 geweigert, das damals ausgehandelte Abkommen zu unterschreiben. Auch wenn der größte Teil der politischen Elite des Landes diesem zustimmte, wollte sich der Präsident durch seine Blockade die Möglichkeit für eine Friedensvereinbarung mit den Oppositionsgruppen erhalten. Karzai nutzte die verbleibenden Monate seiner Amtszeit nicht nur für Verhandlungen mit den Taliban, sondern auch zu Kontakten mit Russland, Indien, China und weiteren Staaten in der Region, um deren Zahlungsbereitschaft zu ergründen, falls sich die westlichen Staaten weigern sollten, den Unterhalt der afghanischen Sicherheitskräfte auch künftig zu subventionieren. Gleichzeitig konnte Karzai mit der Verweigerung seiner Unterschrift auch innenpolitisch an Einfluss gewinnen. Er festigte seine Stellung unter den Paschtunen, die eine weitere Stationierung ausländischer Soldaten ablehnen. Mit der Kritik an den fremden Truppen wegen der hohen Zahl der Zivilopfer vor allem bei nächtlichen Einsätzen oder bei Flugzeug- und Drohnenangriffen sicherte sich der Präsident Zustimmung bei nahezu allen Afghanen. Dabei lenkte er davon ab, dass im Jahre 2013 afghanische Sicherheitskräfte mit 194 nahezu doppelt so viele Zivilisten getötet haben wie die ausländischen Soldaten. Nach Angaben der UNO starben etwa drei Viertel (2.311) der insgesamt 2.959 Menschen durch Angriffe der Regierungsgegner. Ausländische Soldaten töteten mindestens 92 Zivilisten.
Die Ablehnung der fremden Truppen wuchs auch so schnell, weil wichtige Bereiche der zivilen Hilfen auf die Erfüllung der Bedürfnisse dieser Truppen ausgerichtet waren. Vor allem beim Straßenbau war dies auffällig. Allein hierfür stellten die USA vier Milliarden Dollar bereit. Doch das seit 2002 entstandene Straßennetz ist bereits nach dem Abzug der fremden Truppen zu einem großen Teil wieder verfallen. Mittel für Reparaturen und Instandhaltung fehlen. In Afghanistan haben die Fehlschläge Ausmaße in einer nicht vorstellbaren Dimension: Brücken stürzten ein oder wurden wie viele Straßen nie fertig gebaut, neu errichtete Schulen stehen leer, weil Lehrpersonal fehlt, Krankenhäusern fehlen (nicht lange nach ihrer Einweihung) Medikamente, Finanzhilfen für Ministerien verschwinden in dunklen Kanälen, das Chaos verschlingt vieles mehr. Oft verschlangen die Kosten für die Gehälter und die Sicherheit der ausländischen Spezialisten und ihrer afghanischen Helfer bis zu 90 Prozent der eingesetzten Mittel. Deshalb fehlten dann oft die Mittel für die Verwirklichung von Projekten im Hinterland, fern der Hauptstadt Kabul und den Hauptstädten der Provinzen. Zudem erfolgten Projekte für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in den ländlichen Regionen meist nur im Umfeld der Stellungen fremder Truppen.
Dabei wurden die Soldaten aus den NATO-Staaten und internationale zivile Helfer nach dem Sturz der Taliban von der Bevölkerung freundlich aufgenommen. Auch in abgelegenen Landesteilen arbeitende ausländische Helfer waren nicht gefährdet. Erst ab 2004 gab es den Stimmungsumschwung. Seither werden Regierung und Ausländer für gescheiterte Projekte und Unterentwicklung verantwortlich gemacht. Zuerst wurden die Ausländer hinter vorgehaltener Hand beschuldigt, die eigentlich für die Afghanen bestimmten Gelder selbst aufzubrauchen, später kam es zu immer offenerer und direkter Kritik an den Fremden und den afghanischen Beamten und Politikern, die mit ihnen zusammenarbeiteten.
Bis heute wird Ausländern eine Mitverantwortung an den Fehlplanungen, der Korruption und der Verschwendung von Milliarden von Hilfsgeldern angelastet. Deshalb treten Soldaten und Spezialisten seit Jahren immer seltener in der Öffentlichkeit auf und meiden die Straßen der Orte, in denen sie stationiert sind oder arbeiten. Aus Angst vor Anschlägen aufständischer Gruppen (unterschiedliche Fraktionen der Taliban) und der immer deutlicher werdenden Fremdenfeindlichkeit verlassen Ausländer ihre Unterkünfte kaum noch. Nur selten werden Hilfsprojekte in den rund 40.000 Dörfern des Landes ausgeführt, obwohl in ihnen etwa drei Viertel der 30 Millionen Afghanen leben.
In diesen vernachlässigten Regionen können die unterschiedlichen Taliban-Gruppen ihre Kämpfer rekrutieren und deren Angriffe gegen die Sicherheitskräfte der Regierung vorbereiten. Die Organisationen bauen dabei auf die traditionellen Wertesysteme und die tiefe Gläubigkeit vor allem der Paschtunen in Süd- und Ostafghanistan, um gegen die Regierung in Kabul zu mobilisieren. Oft entscheiden sich junge Männer auch für die Taliban, weil sie eine bessere und regelmäßigere Bezahlung als einfache Polizisten von der Regierung erhalten, deren Unzufriedenheit so groß ist, weil sie in der Regel schlecht ausgerüstet sind und oft unter unfähigen und korrupten Offizieren leiden.
Diese Probleme beim Versuch, eine Zivilgesellschaft in Afghanistan mit dem Einsatz von Soldaten aufbauen zu wollen, kommen nicht überraschend. Seit etwa 2.400 Jahren gibt es in dem Land eine „erfolgreiche Tradition“, ausländische Truppen aus dem Land zu vertreiben. Warum die verantwortlichen Politiker der NATO-Staaten dieser Vorgeschichte nicht die notwendige Beachtung schenkten, könnte darin begründet liegen, dass die Afghanistan-Einsätze auch aus innen- sowie bündnispolitischen Erwägungen erfolgten und die Probleme dort schön geredet wurden, statt Konsequenzen aus den zunehmenden Schwierigkeiten zu ziehen.
Ähnlich verhält es sich bei der Korruption. Diese gibt es in Afghanistan seit alters her – aber in unterschiedlichen Formen. Als Bakschisch dient sie zur Aufbesserung der schlechten Bezahlung und ähnelt einer Spende. Doch bereits beim Polizisten, der bei einem Verkehrsvergehen keine Geldbuße verhängt, sondern vom Verkehrssünder einen US-Dollar fordert und erhält, ist die Grenze überschritten. Statt eine Leistung zu belohnen, wird mit der Zahlung eine Behördenentscheidung verändert oder die Zahlung eines Anteils von überhöhten Leistungen erpresst. Für den Korrumpierten handelt es sich in allen Fällen um die Aufbesserung seines Monatsgehalts, von dem er mit seiner Familie gar nicht leben kann. Nur hat die Korruption in den vergangenen Jahren ein in der Geschichte des Landes beispielloses Ausmaß erreicht und als Entwicklungsblockade gewirkt. Verantwortliche für vom Ausland finanzierte Hilfsprojekte waren gewohnt, Ausgaben für Korruption oder Zahlungen an Miliz-Kommandeure oder Aufständische in ihren Berichten zu verstecken oder unter irreführenden Rubriken zu buchen. Nur wurden damit auf Kosten der Projekte Empfänger gestärkt, die auch künftig als Entwicklungsbremsen agieren, um sich derartige Zahlungen zu sichern. Von afghanischer Seite wurde ebenfalls eine Technik entwickelt, Geldgebern Aufstellungen zu liefern, in denen falsch aufgewendete, verschwundene Mittel oder durch Korruption verloren gegangene Gelder verschleiert werden.
Dabei hat Afghanistan Voraussetzungen für eine dauerhafte Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Das Land verfügt über genügend Rohstoffvorkommen, um auf Dauer Entwicklungsprojekte finanzieren zu können. Schon die sowjetische Führung träumte davon, den enormen Ausgaben für den Afghanistan-Krieg in den achtziger Jahren durch Billigimporte afghanischer Rohstoffe etwas entgegensetzen zu können. Diese alten Pläne bildeten den Ausgangspunkt für modernere Untersuchungen, bei denen die enormen Reserven an Erzen wie Eisen, Kupfer, Lithium und Gold sowie Brennstoffen (Gas und Öl) bestätigt wurden.
Doch bis heute werden diese Rohstoffvorkommen nicht ausgeschöpft. Statt deren Nutzung schrittweise vorzubereiten, wurden immer wieder Großprojekte geplant, die sich später als undurchführbar erwiesen. Wegen der afghanischen Hochgebirge und dem fehlenden Seezugang des Landes müssen gewaltige logistische Probleme gelöst werden. Zudem fehlen die Infrastruktur und die Erfahrungen, Bodenschätze zu fördern. Bedeutung für das tägliche Leben wird der unterirdische Reichtum erst in weiter Zukunft gewinnen. Ein Beispiel für die Probleme zeigt sich bei dem Abbau der gewaltigen Kupfervorkommen südöstlich der Hauptstadt Kabul. Bereits 2007 erhielt die chinesische „Metallurgical Group Corporation“ den Zuschlag für diese weltweit größten noch nicht geförderten Kupfervorkommen.
Für die Rechte an der Ausbeutung der Lager wollte die Firma insgesamt 3,4 Milliarden US-Dollar zahlen. Interessenten aus Europa, Kanada, Russland und Kasachstan gingen leer aus, weil sie eine Milliarde weniger boten. In Kabul wurde die Entscheidung für die Chinesen auch damit begründet, dass Tausende von Arbeitsplätzen entstehen und aus China Infrastrukturprojekte im Wert von Hunderten von Millionen US-Dollar finanziert würden.
Doch bereits kurz darauf folgte die Ernüchterung. Statt große Anlagen im Lande zu bauen, plante die Firma einen Transport der geförderten Erze nach China, um sie dort weiter zu verarbeiten. Bis 2014 wurden jedoch auch diese Pläne nicht verwirklicht. Die Regierung in Kabul erhielt nur einen Teil der erwarteten Gelder. Das Gelände der Aynak-Mine ist zwar eingezäunt und wird von afghanischen Soldaten bewacht. Erste Vorarbeiten, das Kupfer im Tagebau zu fördern, wurden wieder ausgesetzt. Die von der chinesischen Firma zugesicherte Verbesserung des Lebensstandards der betroffenen Bevölkerung im Umfeld der Mine ist nicht zu spüren. Möglicherweise wird das Abkommen widerrufen.
So oder ähnlich könnten sich auch Projekte für die Gewinnung anderer Rohstoffvorkommen entwickeln. Nur der damalige Minister, zu dessen Amtszeit der Vertrag mit der chinesischen Firma geschlossen wurde, dürfte nichts bereuen und frohlocken, obwohl er entlassen wurde. In Kabul halten sich hartnäckig Gerüchte, Mohammed Ibrahim Adel habe aus China 30 Millionen Dollar erhalten. Doch eine Anklage wurde nicht erhoben. Auch Planungen, afghanische Öl- und Gasvorkommen zügig zu fördern, ziehen sich in die Länge. Statt eines erhofften Aufschwungs prägen chaotische Zustände die afghanische Wirtschaft im Jahr des Abzugs der Kampftruppen, ohne dass sich auch nur eine Beruhigungsphase abzeichnet.
Allein die Drogenproduktion boomt und bildet weiterhin die Haupteinnahmequelle des Landes und macht Afghanistan damit zu einem Drogenstaat. Statt eines Rückgangs der Produktion haben der Sturz der Taliban-Regierung und die Stationierung der NATO-Truppen eine Ausweitung des Mohnanbaus gebracht. Auch 2013 war der Anstieg der Anbaufläche ungebrochen. Die Produktion des braunen Saftes, der durch das Anritzen der Kapseln des Schlafmohns gewonnen wird, untergräbt auch den afghanischen Staat und trägt einen entscheidenden Anteil daran, dass bis heute kein moderner Staat in Afghanistan aufgebaut wird. Die Drogenwirtschaft lähmt die Entwicklung. Bis auf Weiteres wird Opium mit Abstand das wichtigste Produkt des Landes bleiben. Etwa 90 Prozent des weltweit produzierten Opiums werden in Afghanistan durch Mohnanbau gewonnen. Ganze Landstriche sind zur Zeit der Blüte in ein rotes oder weißes Blumenmeer getaucht.
Von 2001 bis 2011 ist die Opium-Produktion um das 30fache auf 5.800 Tonnen gestiegen. 2013 wurden bereits auf mindestens 200.000 Hektar Schlafmohn angebaut, was gegenüber 2011 eine Steigerung von 50 Prozent und gegenüber 2001 eine von 2.600 Prozent bedeutet. Da die Bauern immer noch etwa das Zehnfache verdienen, wenn sie Mohn statt Weizen anbauen, dürfte der Trend anhalten, zumal die Kampagnen zur Umstellung der Produktion zurückgehen und auch das afghanische Antidrogenministerium immer weniger unterstützt wird (2013 nicht einmal zehn Prozent der angestrebten internationalen Unterstützung).
Viele Politiker, Militärs oder Journalisten haben seit Jahren den Eindruck erweckt, als ob allein die Taliban für den Anstieg der Opiumproduktion die Verantwortung trügen. Doch in Afghanistan hat sich in den vergangenen 35 Jahren eine Drogenindustrie entwickelt, die aus einem Geflecht von Bauern, Händlern, Beamten und Politikern besteht. Die Drogenmafia unterhält gleichzeitig Verbindungen zu den Taliban und Regierungsbeamten. Geistliche freuen sich, wenn sie von den Bauern höhere Steuern erhalten, wenn diese Mohn statt Weizen anpflanzen. Mitarbeiter der Drogenbanden versorgen die Bauern mit Saatgut und vermitteln Kredite auf den Ernteertrag.
In den von ihnen kontrollierten Gebieten sichern die Taliban-Milizen die Mohnfelder. Sie kassieren ein Zehntel der Erträge oder Einnahmen von Bauern, Händlern, Schmugglern und Drogenbaronen. Die Aufständischen fördern den Anbau von Drogen, weil er ihnen Geld bringt. Aber dies ist nur ein Teil des Einkommens der Taliban. Jahrelang waren zum Beispiel die Einnahmen aus von den US-Streitkräften gezahlten Schutzgeldern für die Transporte zur Versorgung der Truppen deutlich höher. Ähnlich wie beim Rauschgift gibt es auch im Bereich des Nachschubs für ausländische Truppen ein Geflecht von profitierenden Personen und Organisationen, das vom Umfeld der Spitzenpolitiker in Kabul über Stammesführer, Milizkommandeure bis zu Aufständischen und Taliban-Kommandeuren reicht. Es führt in eine falsche Richtung, nur die Taliban für diese Missstände verantwortlich zu machen. Die Probleme sind Teil der seit 30 Jahren entwickelten Kultur von Filz, Korruption und Kriminalität.
Nach dem Einmarsch der sowjetischen Soldaten (1979 – 1989) wurde der Widerstand von den USA ausgerüstet und mit Geld unterstützt. Zwischen den USA, Saudi-Arabien und damals den Vereinigten Arabischen Emiraten bestand eine enge Kooperation, die sich in ähnlicher Form seit Frühjahr 2011 bei der Unterstützung für die syrischen Aufständischen zeigt. Während des Krieges gegen die Sowjetarmee wurde die Produktion von Drogen zu einer bedeutenden Einnahmequelle des afghanischen Widerstandes. Der pakistanische Geheimdienst ISI und die CIA rüsteten die Aufständischen mit Waffen aus und halfen den Führern von sieben Mujaheddin-Gruppen beim Transport und der Vermarktung von Drogen. Von ihnen bekleiden viele seit 2001 Schlüsselstellungen in Kabul.
Das System von Produktion, Transport und Verkauf der Drogen bestand bereits Jahre vor Gründung der Taliban. Kontrolliert wurde es von Politikern und Kriminellen, die bis heute zentrale Bedeutung auf die afghanische Politik ausüben und deren Einfluss nach dem Abzug der ausländischen Kampftruppen weiter steigen dürfte. Dieses Drogenkartell hat kein Interesse an der Entwicklung einer Zivilgesellschaft, dem Aufbau eines funktionierenden Gesetzesapparates und einem Erstarken anderer Wirtschaftszweige, die sich zu einer Konkurrenz des Drogensektors entwickeln könnten.
Pläne zur Stärkung des Anbaus alternativer Produkte werden nur verwirklicht werden können, wenn die Regierung in Kabul sie bezahlt und die Rahmenbedingungen für eine Erneuerung der afghanischen Wirtschaft entwickelt. So bilden Unsicherheit und fehlende Stabilität nicht nur den Nährboden für die Drogenwirtschaft, sondern sind gleichzeitig deren Ergebnis. An diesem verhängnisvollen Kreislauf dürfte sich bis auf Weiteres nichts ändern. Im Bereich des Kampfes gegen die Drogenproduktion hat die internationale Gemeinschaft nichts erreicht, sondern sogar schwere Rückschläge eingesteckt. 13 Jahre lang wurde sogar die Chance vertan, in Afghanistan eine Industrie für die Herstellung von auf Opium basierenden Schmerzmitteln aufzubauen.
Korruption und Drogenproduktion bedeuten für die weitere Entwicklung des Landes eine schwere Hypothek. Das allmähliche Versiegen der weltweiten Hilfszahlungen wird die Chancen für einen schnellen gesellschaftlichen Wandel und eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse verringern. Gleichzeitig bietet der Abzug der ausländischen Soldaten auch die Chance für einen Rückgang der Spannungen. Demgegenüber sind bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen regionalen Kriegsfürsten zu erwarten, weil die Aufteilung des Landes zwischen den verschiedensten Interessengruppen zum Teil gewaltsam erfolgen dürfte.
Die bedeutende Stellung der alten und neuen regionalen Machthaber in den Institutionen in Kabul dürfte jedoch einen neuen Bürgerkrieg verhindern, weil diese korrupte Elite Interesse daran hat, ihre in den vergangenen Jahren aufgehäuften Vermögenswerte zu sichern. Zwar ist ein großer Teil dieses Reichtums im Ausland angelegt, aber die Kriegsfürsten und Spitzenpolitiker haben auch im Lande investiert. Und dieser Besitz wäre im Falle extremer Gewalt gefährdet. Zudem dürften in einem Bürgerkrieg auch die bereits vor Jahren zugesicherten Zahlungen für zivile Hilfe ausbleiben. Und die bildeten in den vergangenen Jahren eine der Hauptquellen der Bereicherung.
Zahlungen aus dem Ausland haben in Afghanistan nur zu oft eine gleichzeitig entwicklungshemmende Wirkung. Denn gelänge es Behörden durch Einsatz aller Mittel, Missstände zu beseitigen, würde einer der Gründe für künftige Zahlungen – nämlich der Missstand – entfallen. Auch aus diesem Grunde fehlt Mitarbeitern in Bürokratien der Anreiz, die Mittel effektiv zu nutzen. Insbesondere weil diese Beamten sich ja gerade wegen der ins Land fließenden Devisen in den vergangenen Jahren einen gewissen Lebensstandard aufbauen konnten. In den vergangenen Monaten berichteten ausländische Experten trotz des Rückgangs der Hilfen über anhaltende Korruption. Dies liegt auch daran, dass das Geld, das von Beamten und Staatsangestellten in den mittleren Rängen durch Korruption abgezweigt wurde, vor allem konsumiert und nicht investiert wurde. Die Bedingung der Regierung in Kabul, künftige Entwicklungsprojekte stärker über staatliche Institutionen abzuwickeln, muss auch vor diesem Hintergrund gesehen werden.
Die weitere Afghanisierung der staatlichen Institutionen in den kommenden Jahren könnte auch eine Chance bieten, ein Nebeneinander unterschiedlichster Gruppen zu schaffen und für die junge Generation weitere Freiräume zu öffnen. Bisher hat sich die junge Generation nicht selbstständig artikuliert, sondern in der Regel bekannten Politikern untergeordnet. Doch zunehmende Arbeitslosigkeit und fehlende Auswanderungsmöglichkeiten könnten das ändern. Mit großem Interesse haben junge Afghanen die Proteste in Tunesien und Ägypten verfolgt, die zum Sturz der Diktatoren in diesen Staaten führte.
Gerade junge Intellektuelle sehen im syrischen Bürgerkrieg ein abschreckendes Beispiel. Vor allem in den großen Städten wird die junge Generation darauf bestehen, dass es auch künftig in Afghanistan Wahlen gibt. Denn in ihren Augen bieten sie die beste Chance, politische Verhältnisse zu ändern. Und bei einem Durchschnittsalter der Bevölkerung von 18 Jahren gehört den jungen Menschen die Zukunft, auch wenn heute die Alten an den Hebeln der Macht sitzen. Die ausländischen Mächte haben bei ihrem Eingreifen in Afghanistan nicht die Gelegenheit für einen Generationswechsel in den Schlüsselstellungen der Macht genutzt, sondern die Zusammenarbeit mit umstrittenen Altpolitikern gesucht. Doch die Globalisierung bringt diese Möglichkeiten, insbesondere wenn die Staaten des Westens aus ihrem Scheitern in Afghanistan die richtigen Lehren ziehen. Sie dürfen das Land nicht als Standort nutzen, um ihre Interessen in Zentral- oder Südostasien durchzusetzen. Doch wäre auch eine völlige Abwendung falsch, weil Afghanistan dann den Übergriffen der Nachbarstaaten preisgegeben werden würde. Zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit gibt es keine Alternative.