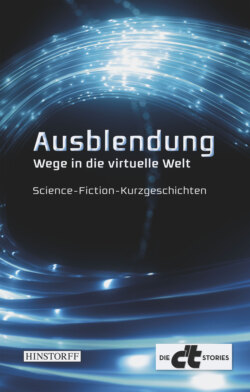Читать книгу Ausblendung. Wege in die virtuelle Welt - Группа авторов - Страница 7
Schnapp sie alle!
ОглавлениеEs passiert nicht jede Nacht, dass man von einer leuchtenden Kreatur geweckt wird, die mitten im Schlafzimmer schwebt, aber als ich die Augen öffne, erhellt eine Banshee den Raum. Weißes Haar weht um ein zerfurchtes Gesicht, Fetzen ihres Kleides flattern in alle Richtungen. In den Augenhöhlen und aus dem weit aufgerissenen Mund heraus blinken mir kleine Quadrate entgegen. Pixelfehler.
„Geh ins Bett“, murmele ich ins Kissen.
„Aber Mama!“, sagt Dimitri. „Bansheestaub fehlt mir noch!“
Immerhin hat er den Ton ausgestellt – die Kreatur kreischt, ohne dass etwas zu hören ist. Trotzdem hat mein Sohn um diese Uhrzeit nicht in meinem Türrahmen zu stehen. Morgen ist Schule. Ein Blick genügt und er lässt sein Handy sinken. Das Hologramm verschwindet.
Ich kann froh sein, dass er zu jung war, als ähnliche Trends zum ersten Mal aufkamen. Kinder liefen auf der ganzen Welt durch die Gegend, um digitale Monster einzufangen. Was damals lediglich auf Displays angezeigt wurde, wird heute für alle sichtbar in die Luft projiziert. Kein Wunder, dass SpriteMania GO alle App-Charts anführt. Die Elfen und Kobolde des Spiels, deren magischen Staub man sammeln soll, könnten kaum lebensechter sein.
„Karlo aus der 4b hat sogar schon eine Trophäe freigeschaltet“, klagt Dimi am Frühstückstisch. „Weil er über 50 verschiedene Sprites getroffen hat! Das schaff ich nie! Und ich brauche unbedingt noch Gnomenstaub!“
Ich nicke – aber erst später, als er schon längst in der Schule ist und der Computer in meinem Home-Office mit dem Kompilierlauf für meinen Code beschäftigt ist, nutze ich die Wartezeit, um mehr herauszufinden. Hunderte Artikel berichten vom Erfolg der App, die so effektiv dafür sorgt, dass mehr und mehr Kinder ihre Zeit an der frischen Luft verbringen. Cottingley Games, das Studio hinter dem Spiel, weist darauf hin, dass Sprite-Jäger die Straßenverkehrsordnung beachten und keine Privatgrundstücke betreten sollen, doch natürlich steigen Kinder trotzdem über Stacheldrahtzäune und laufen in einsturzgefährdete Gebäude.
Im Radio heißt es, dass die Anzahl der Auffahrunfälle sich verdoppelt hat, seitdem überall Kinder Ampeln ignorieren, um schneller zu erreichen, was ihr Radar ihnen anzeigt. Gruppen mit Hunderten von Spielern versammeln sich um seltene Sprites und blockieren ganze Straßen, halten nachts müde Anwohner wach und müssen regelmäßig von der Polizei nach Hause geschickt werden. Für all das ist im Grunde Cottingley Games verantwortlich.
In Großstädten sind bereits erste Spieler überfallen und dazu gezwungen worden, per Tauschfunktion ihren kostbaren Staub herzugeben. Und an Schulen entwickelt sich SpriteMania GO mehr und mehr zum Statussymbol.
Jeden Tag, wenn ich Dimitri abhole, ist der Schulhof voll mit Kindern, die mit ihren Handys in alle Richtungen zielen, bis sie das haben, was sie suchen. Sobald ihre Holobeamer die Kreaturen erscheinen lassen, tippen sie auf den Touchscreens herum, um den Sprites ihren Staub abzunehmen und ihn in virtuelle Phiolen zu füllen. Die meiste Zeit stehen sie also wortlos glotzend um leuchtende Hologramme herum. Wie Motten um eine Glühbirne. Wie Betende um einen strahlenden Götzen. Den Mittelpunkt ihres Interesses bilden all die im Spiel verarbeiteten Waldwesen und Naturgeister aus verschiedensten Mythologien.
„Karlo sagt, er hat einen Faun getroffen!“, sprudelt Dimi gleich los, als er nach der Schule ins Auto einsteigt. „Das sind fast die seltensten! Danach kommt nur noch der Große Pan! Mama, wenn ich Staub vom Pan hab, dann bin ich der Beste!“
„Das wäre natürlich toll“, sage ich.
Wir sind keine Minute unterwegs, da vibriert sein Handy.
„Ein Gnom!“, schreit er und zeigt mir die GPS-Karte unserer Nachbarschaft. Auf einer der Straßen blinkt das Symbol für ein neues Sprite.
„Mama, wir müssen da hinfahren!“
„Wir fahren jetzt erst mal nach Hause“, sage ich.
„Du musst rechts abbiegen!“, ruft Dimi. „Du fährst ja dran vorbei!“
Wenn er seine Hausaufgaben fertig hat, sage ich, dann kann er vor dem Essen noch mal nach Gnomen suchen.
Wir biegen nicht ab. Sofort bricht Dimi in Tränen aus. Nicht das übliche Weinen, wenn er nicht bekommt, was er will. Er jault, als stünde das Ende der Welt bevor. Sein Schluchzen ist so stark, ich verstehe nur einen Bruchteil seiner Worte –„unbedingt“ und „brauch ich noch“ und immer wieder „Karlo“.
Ich nehme Dimitri in den Arm, bis er sich beruhigt hat. Er spricht nur noch wenig an diesem Abend, doch schon bald macht es „klick“ bei mir. Wer nicht den richtigen Staub gesammelt hat, hat auf dem Schulhof nichts mehr zu melden. Kinder ohne Smartphone haben bereits verloren. Kinder, die nur geringe Erfolge haben, werden ausgelacht, ausgeschlossen und dürfen bei den Müllcontainern spielen.
Gleich am nächsten Tag rufe ich bei der Schule an. Ich spreche mit Lehrern und anderen Eltern, aber die Reaktion ist überall dieselbe: Die Kinder spielen doch nur. In einer Woche haben sich alle wieder vertragen. Doch ich sitze nicht tatenlos herum, während mein Sohn wie ein Aussätziger behandelt wird.
Nachdem Dimi sich das nächste Mal in den Schlaf geweint hat, schnappe ich mir sein Handy und kopiere mir das Installationsarchiv der App, um nach dem Quellcode zu suchen. Ich kann seine Staubphiolen nicht einfach füllen, doch nach Jahren in der Software-Entwicklung ist es kein Problem für mich, einen eigenen Server aufzusetzen und ihn mit Dimis Spieldatei zu verknüpfen. Der Befehl, der eine zufällig ausgewählte Kreatur auftauchen lässt, ist schnell gefunden und modifiziert – ab morgen bekommt mein Sohn das dazugehörige Signal doppelt so oft, vom Cottingley-Games-Server und von zu Hause.
Ich kann ihn weder vom Spielen abhalten noch das Verhalten der anderen Kinder ändern. Ich kann nur dafür sorgen, dass Dimi so schnell wie möglich alle Sprites trifft und den Trend hinter sich lassen kann. Ihn vergessen wie all die kompletten Sammelkarten-Sets und vollen Stickeralben, die sofort uninteressant wurden, als es nichts mehr zu erreichen gab.
Bevor Dimi am nächsten Morgen zur Schule fährt, trifft er schon auf zwei Pixies. Eine Woche später und er zählt bei jedem Essen neue Kreaturen auf, von denen ich noch nie gehört habe. Ich warte darauf, dass das Spiel endlich seinen Reiz verliert. Doch der Hype ebbt nicht ab.
Jedes zweite Geschäft in der Stadt verkündet im Schaufenster, dass man dort besonders guten Feenstaub finden könne. Cafés und Bars locken mit Rabatten und Gratisessen, wenn man vor Ort ein Selfie von sich mit einem Sprite macht und das Bild online stellt. Jeder Trend, der weit genug verbreitet ist, wird früher oder später für Marketing-Zwecke nutzbar gemacht.
All das wäre mir recht, doch die derzeitige Kindergeneration ist technikaffiner als ich dachte. Sobald Dimitris Mitschülern aufgefallen ist, dass ihm Kreaturen begegneten, die auf ihrem Radar gar nicht angezeigt wurden, haben sie sich seine Setup-Datei kopiert. So ist sie schließlich im Internet gelandet, und bevor ich wusste, was vor sich ging, hat mein Server Tausende Spieler mit zusätzlichen Sprites versorgt.
Als ich das nächste Mal mein Home-Office betrete, schlägt mir das Rauschen der Lüfter entgegen, die verzweifelt versuchen, die unter Volllast arbeitende Rechnerhardware zu kühlen. Die Anzeige, die darüber Aufschluss gibt, an welchen Orten das Signal meines Servers empfangen wird, braucht so viel Platz, dass ich sie über mehrere Monitore verteilen muss. Meine Spielversion, von der eigentlich nur mein Sohn profitieren sollte – inzwischen wird sie auf allen Kontinenten benutzt.
Auf der Suche nach Möglichkeiten, den Zugang der neuen Empfänger meines Signals einzuschränken, klicke ich mich durch all die kryptisch benannten Dateien der App, überfliege den Quellcode und entdecke Ansatzpunkte für Funktionen, die Cottingley Games in Zukunft integrieren will. Farbige Hologramme anstelle der weißen Lichtgestalten. Die Möglichkeit, Kreaturen gezielt anzulocken. Und eine Schnittstelle zur Kamerafunktion aller Handys, auf denen die App benutzt wird – nur dass diese Funktion offenbar schon jetzt vollständig im installierten Paket enthalten, wenn auch noch inaktiv ist.
Ich brauche zwei weitere Nächte, um eine Anwendung dafür zu schreiben, dann zeigen mir alle Bildschirme, was ich bereits befürchtet habe. In Hunderten kleinen Fenstern sehe ich, was die Kameras der Spieler gerade einfangen. Auf der Suche nach Sprites schwenken sie ihre Smartphones hin und her, filmen die Welt um sich herum, ihre Schlaf- und Badezimmer, ihre Mitmenschen, jeden Winkel ihres Alltags. Und das sind nur die Spieler, deren App mit meinem Server verknüpft ist.
Sprachlos starre ich all die Fenster an. Die meisten Spieler sind in den Städten unterwegs, riesige Werbetafeln bilden den Hintergrund jeder Sprite-Begegnung. Andere Fenster zeigen das Innere von Einkaufszentren und Shopping-Passagen. Offenbar tauchen in den Kleinstädten und Dörfern die wenigsten Kreaturen auf, direkt in Privathäusern noch weniger. Eines der Fenster präsentiert mir eine vertraute Umgebung. Der dazugehörige Spieler schwenkt sein Handy in meinem Wohnzimmer umher, dann in meinem Flur. Er bewegt sich auf mein Büro zu. Da klopft es auch schon.
„Mama!“, ruft Dimitri durch die Tür. „Darf ich kurz in den Garten? Da ist ein Imp! Danach geh ich auch gleich schlafen. Zähne geputzt hab ich schon!“
„Aber nur ganz kurz“, rufe ich zurück und lausche, wie seine Schritte in Richtung Haustür verschwinden.
Ich lasse mir nur die Live-Feeds aus der unmittelbaren Umgebung anzeigen und bekomme den Weg aus unserem Haus präsentiert, dann einen Rundumschwenk im Vorgarten, bis Dimis Holobeamer den Imp erscheinen lässt.
Natürlich steht davon nichts in den Geschäftsbedingungen des Spielherstellers. Cottingley Games hat die Möglichkeit, Millionen Spieler auszuspionieren, ohne dass irgendwer es bemerkt. Aber wozu?
Um das herauszufinden, konzentriere ich mich ganz auf die Bewegungen der Spieler. Ich starre meine Monitore an, wühle weiter im Quellcode, erweitere meinen Server, damit er der höheren Belastung standhält, und nutze jede freie Minute, um nach Neuigkeiten zu recherchieren. Die App nimmt derweil noch an Beliebtheit zu. Immer mehr Kinder installieren das Spiel, immer mehr Firmen investieren in den Sensationserfolg. Hersteller von Autos und Limonade ebenso wie Filmstudios und Modemarken.
Erst Tage später, als Dimi von einem Ausflug mit Freunden mit einer kostenlosen Brezel zurückkehrt, macht es „klick“ bei mir. Er hat das Gratisgebäck bekommen, weil er in einer Bäckerei ein Selfie mit einem Sprite gemacht hat.
Ein Blick auf die Live-Feeds in meinem Home-Office bestätigt meinen Verdacht. Wenn die Kinder ihre Handys schwenken, um Dryaden und Elementargeister zu finden, haben sie fast ununterbrochen Werbung vor Augen. In den kleinen Fenstern sehe ich Plakate und Schilder all der Investoren, vor deren Reklametafeln die begehrtesten Sprites auftauchen – ihre Logos und Produkte immer im Sichtfeld unwissender Kinder, damit diese das Erfolgserlebnis beim Spielen schon bald mit Dingen assoziieren, die sie gar nicht brauchen.
Zum ersten Mal begrüße ich es, dass meine Version der App sich so weit verbreitet hat. Die Funktion, Sprites gezielt an bestimmten Orten auftauchen zu lassen – innerhalb weniger Tage kann ich die Befehlszeilen modifizieren, um die Entwickler mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Jedes Mal, wenn die Kinder in Richtung einer Reklametafel gelockt werden, sorgt das Signal von meinem Server dafür, dass sie gleichzeitig in die entgegengesetzte Richtung gerufen werden.
Inzwischen sind es Zehntausende, die ich so lenken kann. Verführerische Nymphen locken sie in kleine Parks. Scharenweise folgen sie Trollen unter die Brücken der Stadt, wandern hinter Irrwischen her, bis weit und breit keine Werbung mehr in Sichtweite ist. Das „GO“ aus dem Spieltitel klingt mehr denn je wie ein Befehl. Und die Kinder folgen gehorsam. Ich bin so vertieft in das Treiben auf meinen Bildschirmen, ich höre Dimi erst, als er direkt im Türrahmen steht. Er zittert. Wasser rinnt an ihm hinab und tropft auf den Boden.
„Ich bin in den Bach gefallen“, sagt er.
Sofort stürme ich ihm entgegen, helfe ihm aus der nassen Kleidung, wickle ihn in dicke Decken, verabreiche ihm eine Tasse Kakao und stecke ihn ins Bett. Während ich dafür sorge, dass ihm wieder warm wird, erzählt er, dass er mit Freunden ein Sprite finden wollte, das ihm angezeigt wurde. Nur vom spärlichen Licht ihrer Handydisplays unterstützt, sind Dutzende Kinder im Dunkeln durch die Büsche und Sträucher des Stadtparks gestolpert, dann hat eine unerwartete Senke sie stolpern lassen. Die meisten von ihnen sind ins Wasser gepurzelt, einer von Dimis Freunden hat sich den Knöchel verstaucht. Vom digitalen Irrlicht ins Verderben gelockt.
In dieser Nacht führe ich niemanden auf unbekannte Pfade. Die Entwickler schicken ihre Spieler indessen weiter zu Reklametafeln in allen Winkeln der Welt.
Als Dimitri schläft, versuche ich, fernzusehen, um mich abzulenken, doch jede Menschenmenge, die ich sehe, erinnert mich an das Spiel. Die Nachrichten zeigen Truppenbewegungen in den Kriegsgebieten der Welt, und ich bilde mir ein, dass alle Soldaten ein Smartphone in der Hand halten und in Richtung seltener Waldgeister marschieren, deren Staub ihnen noch fehlt. Und niemand hält die Entwickler davon ab, tatsächlich Sprites auf Minenfeldern und hinter feindlichen Linien erscheinen zu lassen.
Ein Investor mit finsteren Absichten genügt und Massen von Kindern könnten an einen Ort gelockt werden, an dem jemand nur darauf wartet, das Feuer zu eröffnen. Opfer für einen Amoklauf zu finden war nie einfacher! Dass es für erfahrene Programmierer kein Problem ist, das Spiel für alle möglichen Zwecke zu missbrauchen, habe ich selbst mehr als deutlich bewiesen.
Dimi sucht schon bald weiter nach digitalen Heinzelmännern und Nixen, ich suche derweil all die Beweise zusammen, die verhindern können, dass die App jemals Werkzeug von Terroristen werden kann. Der Mail-Entwurf, in dem ich alles so erkläre, dass die Medien auch etwas damit anfangen können, hat die Adressen aller namhaften Zeitungen und Nachrichtensender in der Empfängerzeile. Im Anhang häufen sich meine Quellcode-Funde, Listen der Investoren und Screenshots ihrer Werbung neben den Hologrammen. Das Einzige, was ich noch brauche, sind Aufnahmen davon, wie Spieler an gefährliche Orte gelockt werden, während Cottingley Games durch illegale Kameras tatenlos zusieht. Mein Bildschirmrekorder läuft nonstop.
Ich bin zuversichtlich: Schon bald wird sich niemand mehr im Supermarkt vordrängeln, um einen Waldschrat an der Käsetheke zu erreichen. Die Gruppen von Kindern, die jetzt an roten Ampeln auf Autos klettern, um Feen mit leuchtendem Pixelschweif in die Luft zu projizieren, werden sich in ein paar Tagen wieder andere Beschäftigungen suchen.
Im Radio heißt es, neue Investoren hätten Interesse an der App bekundet. Tabakkonzerne und Brauereien. Es wird höchste Zeit, dass ich die Medien informiere. Zurück in meinem Büro beende ich mein Aufnahmeprogramm. Zum Schneiden bleibt keine Zeit, ich packe das gesammelte Filmmaterial unbearbeitet in den Mail-Anhang.
„Pan!“, ertönt plötzlich ein Schrei vom Flur her. Mit funkelnden Augen erscheint Dimi im Türrahmen. „Mama! In deinem Zimmer ist der Große Pan!“
Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, was er sagt. Das seltenste Sprite des Spiels – in meinem Büro. Das Signal kommt nicht von meinem Server.
Und schon klingelt es an der Tür. Die Live-Feeds auf den Monitoren zeigen, wie aus der ganzen Nachbarschaft Kinder zu unserem Haus pilgern. Wenn Pan ruft – der Hirtengott, der Ursprung des Begriffs „Panik“ –, dann kann kein Spieler weghören.
Das Klingeln wird stürmischer, schnell hämmern sie auch an der Tür. Ich höre Geschrei im Garten. Dann geht das erste Fenster zu Bruch. Auf den vielen kleinen Fenstern auf dem Bildschirm sehe ich, wie sie den Flur entlanglaufen. Wie sie durch das Küchenfenster krabbeln und auf Mülltonnen steigen, um über das Garagendach mein Büro zu erreichen. Kinder pressen sich gegen die Bürofenster, dann stürzen sie in einem Scherbenregen in den Raum. Andere stoßen die Tür auf. Wie Käferscharen strömen sie in das Zimmer. Wer zu Boden geht, landet auf Glassplittern. Bildschirme und Rechner werden zertrampelt. Und während der Raum sich mit aufgeregt kreischenden Kindern füllt, die meine Technik zerstören, kopiere ich die letzten Videodateien in den Mail-Anhang.
Die Kinder schubsen und treten sich, steigen aufeinander, drohen einander zu erdrücken, japsen nach Luft. Aus dem Augenwinkel sehe ich blutverschmierte Hände und Gesichter. Von irgendwo ertönt die Stimme von Dimitri.
„Ich hab ihn“, ruft er.
Ein kurzes Flackern, dann wird die Masse von einem riesigen Hologramm überragt. Ein gehörnter Mann mit Ziegenbeinen und Spitzbart, eine muskulöse, weiße Lichtgestalt, die bis an die Decke reicht und alle Anwesenden ehrfürchtig erstarren lässt: der Große Pan. Statt Panik zu verbreiten, sorgt er für absolute Stille. Und durch die Handys, die von der anderen Zimmerseite auf ihn gerichtet sind, sieht Cottingley Games mich und das geöffnete Mail-Programm. Den Finger auf der Maus, den Cursor über „Senden“. Natürlich wissen sie, was ich vorhabe. Sie haben Kameras auf der ganzen Welt.
Wir wissen, was du tust, teilen sie mir mit. Wir können dich finden, wo auch immer du bist.
Sie sorgen dafür, dass Pan den Kopf dreht. Sein Blick schweift über all die Kinder, die jederzeit wieder mein Haus verwüsten könnten. Er sieht mich direkt an. Ein vergeblicher Einschüchterungsversuch. Die zertrampelten Geräte können alle ersetzt werden.
Dann blickt Pan in Richtung meines Sohnes. An Dimitris Stirn klebt Blut.
Und es macht „klick“.