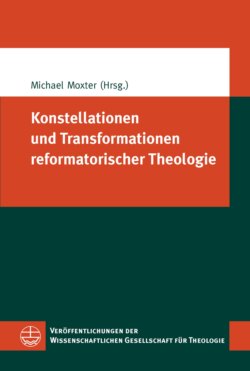Читать книгу Konstellationen und Transformationen reformatorischer Theologie - Группа авторов - Страница 9
DER DISKRETE CHARME DER REFORMIERTEN THEOLOGIE BEOBACHTUNGEN ZU EINEM SPEZIELLEN TYPUS THEOLOGISCHEN DENKENS Michael Beintker
ОглавлениеI.REFORMIERTE THEOLOGIE – IHR VERBREITUNGSGRAD
Theologie mit dem Attribut reformiert wird überall dort getrieben, wo es reformierte Kirchen gibt. Wie sich eine lutherische, katholische, orthodoxe oder anglikanische Theologie von ihren kirchlich-konfessionellen Kontexten her erfassen und darstellen lässt, so setzt auch die reformierte Theologie einen bestimmten Kirchentypus voraus, durch den sie geprägt wird und auf den sie sich forschend und lehrend bezieht. Das geschieht im übergeordneten Horizont der una sancta catholica et apostolica ecclesia, muss also weder auf eine konfessionelle Engführung noch auf eine konfessionalistische Versteifung hinauslaufen, obwohl es das – wie bei anderen konfessionell bestimmten Theologien auch – gegeben hat und immer wieder gibt.
In Deutschland existieren gegenwärtig drei Professuren, die ausdrücklich der Pflege reformierter Theologie gewidmet sind, eine in Göttingen (Martin Laube) und zwei in Münster (Anne Käfer und Christina Hoegen-Rohls). Daraus darf man freilich nicht folgern, dass man es nur in Göttingen und Münster mit reformierter Theologie zu tun bekommt. Im Herbst eines jeden Jahres tritt – in der Regel in Wuppertal – die Konferenz reformierter Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen zusammen. Das ist eine der wissenschaftlichen Diskussion verpflichtete Fachkonferenz, zu der deutsche reformierte Theologinnen und Theologen nach der Habilitation eingeladen werden. Von den etwa 50 Einzuladenden erscheinen regelmäßig 15 bis 20 Personen. Gemessen an der Minderheitensituation der Reformierten in Deutschland1 ist das eine erstaunlich hohe Repräsentanz. Zu diesem Kreis gehören unter anderen die Systematiker Magdalene Frettlöh, Matthias Freudenberg, Okko Herlyn, Marco Hofheinz, Christian Link, Georg Plasger, Michael Weinrich, Michael Welker, der Ethiker Karl-Wilhelm Dahm und der Autor dieses Beitrags, die Exegeten Rainer Albertz, Christina Hoegen-Rohls, Andreas Lindemann, Thomas Naumann. Als Reformierte verstehen sich auch Eberhard Busch, Otfried Hofius, Gisela Kittel, Ulrich Körtner, Ernstpeter Maurer, Jan Rohls und Klaas Huizing. So gesehen ist die reformierte Theologie akademisch gut vertreten und alles andere als ein Randphänomen.
Auf die Frage von Kollegen anderer Fächer, was man sich unter reformierter Theologie vorzustellen habe, habe ich meist geantwortet, dass es sich um eine theologische Richtung der evangelischen Theologie handele, bei der die Reformation in Westeuropa und die von ihr ausgehenden Wirkungen im Zentrum der Aufmerksamkeit stünden und die Themenstellungen und Forschungsgebiete vorstrukturierten. Die westeuropäische Allokation ist natürlich etwas einseitig. Schon im 16. Jahrhundert entstand im hungarophonen Raum eine selbstbewusste reformierte Kirche. Und auch in Asien, Afrika und Lateinamerika finden wir robuste reformierte Kirchen. Aber richtig ist doch, dass mit Zwingli und Calvin die alle anderen überragenden Reformatoren der reformierten Christenheit genannt sind und dass die reformatorische Bewegung von Genf aus nach Schottland und in die Niederlande ausstrahlte, um von dort aus ihren Weg in die presbyterianisch und/oder kongregationalistisch geprägte Welt des Westens zu nehmen und das zu beeinflussen und mitzuprägen, was man die westliche Zivilisation nennen kann.
Damit ist aber auch sogleich ein globales Problem der reformierten Theologie impliziert: Die in der nördlichen Hemisphäre von den akademischen Standards des Westens geprägte reformierte Theologie ist in der Weltgemeinschaft der reformierten Kirchen heute umstritten. Die theologische Reflexion, wie sie an den theologischen Fakultäten Europas und Nordamerikas gepflegt wird, steht unter dem Generalverdacht einer splendid isolation gegenüber den Konflikten zwischen Arm und Reich, Nord und Süd, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. So waren die Projekte des Reformierten Weltbunds in den vergangenen Jahrzehnten vornehmlich auf das Engagement für soziale Gerechtigkeit und die Option für die Armen ausgerichtet. Das auf der 24. Generalversammlung des Reformierten Weltbunds in Accra (2004) beschlossene »Bekenntnis des Glaubens im Angesicht von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit und ökologischer Zerstörung« sagt »Nein zur gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, wie sie uns vom globalen neoliberalen Kapitalismus aufgezwungen wird. Nein aber auch zu allen anderen Wirtschaftssystemen – einschließlich der Modelle absoluter Planwirtschaft –, die Gottes Bund verachten, indem sie die Notleidenden, die Schwächeren und die Schöpfung in ihrer Ganzheit der Fülle des Lebens berauben. Wir weisen jeden Anspruch auf ein wirtschaftliches, politisches und militärisches Imperium zurück, das Gottes Herrschaft über das Leben umzustürzen versucht, und dessen Handeln in Widerspruch zu Gottes gerechter Herrschaft steht.«2
Bei diesem hartnäckigen Insistieren auf sozialer Gerechtigkeit sind alle Formen theologischer Arbeit, die sich nicht unmittelbar der an der Not der Armen orientierten Reflexion sozialer Kontexte und der Überwindung sozialer Schieflagen verpflichtet wissen, in Verruf gekommen. Davon ist auch die Arbeit der wissenschaftlichen Theologie betroffen, wie sie an den Universitäten der nördlichen Hemisphäre betrieben wird. Sie steht bei vielen reformierten Kirchenleuten des Südens unter dem Verdacht, ein bürgerlicher Luxus zu sein, wenn sie nicht gleich als intellektuelles Herrschaftsinstrument zur Ablenkung von den wirklichen Weltproblemen eingestuft wird. Mit vergleichbaren Problemgefällen von Nord nach Süd haben sich auch andere Kirchen auseinanderzusetzen. Aber bei den Reformierten sind sie besonders heftig in Erscheinung getreten, was nicht zuletzt auch mit einem starken sozialethischen Interesse reformierter Theologie zusammenhängt. Erst in den letzten Jahren ist wieder das Bewusstsein für die Bedeutung theologischer Arbeit gewachsen. So hat man eingesehen, dass ökumenische Fortschritte nur durch geduldige theologische Studienarbeit erreichbar sind.
II.PLURALITÄT IHRER BEKENNTNISBESTIMMTHEIT
Reformierte Theologie ist also konfessionsbestimmte Theologie. Von Ausnahmen abgesehen – eine solche Ausnahme sind seit Mitte des 19. Jahrhunderts die reformierten Kantonskirchen der Schweiz – konstituiert sich die konfessionsbestimmende Identität reformierter Kirchen über ein oder über mehrere bestimmte Bekenntnisse, die in der jeweiligen Kirche in Geltung stehen. Dabei waltet die Vielfalt. Im Unterschied zu den lutherischen Kirchen kennen reformierte Kirchen keinen abgegrenzten und abgeschlossenen Bekenntniskanon. In besonderem Ansehen steht weltweit der Heidelberger Katechismus, aber das schließt ein, dass sich die einzelne reformierte Kirche auf ein besonderes Bekenntnis bezieht, das zumeist mit ihrer Entstehung oder doch der Überwindung einer kirchlichen Konfliktsituation ihrer Geschichte verbunden ist. Da sich das Bekennen nicht in der rezitierenden Vergegenwärtigung historischer Bekenntnisaussagen erschöpft, können auch Texte, die dem aktuellen Bekennen entspringen, den Charakter eines kirchlich rezipierten Bekenntnisses annehmen. Das gilt auf jeden Fall für die Barmer Theologische Erklärung von 1934 und in wachsendem Maße für das Bekenntnis von Belhar (1986), das der Barmer Theologischen Erklärung nachempfunden ist und die Einsichten von Barmen im Blick auf die Apartheidpolitik in Südafrika fortgeschrieben hat.
Die Bekenntnispluralität der reformierten Kirchen steht in einem bestimmen Verhältnis zu den Theologen, denen sie ihre entscheidende Prägung zu verdanken haben. Reformierte Kirchen im Horizont der Reformation Huldrych Zwinglis unterscheiden sich von denjenigen im Horizont der Wirkungen Johannes Calvins. Wer durch die Schweiz reist und nacheinander Gottesdienste in Zürich, Basel, Neuchâtel und Genf besucht, spürt das auf überschaubarem Raum. Zum eigentlichen theologischen Lehrer der reformierten Kirchen wurde Calvin, so dass man den Zwinglianismus als ein helvetisches, den Calvinismus hingegen als ein globales Phänomen bezeichnen kann. Wir müssen auf jeden Fall den Kirchentypus mit Zwinglianischer Prägung von demjenigen mit Calvinscher Prägung unterscheiden. Das unlängst erschienene »Cambridge Companion to Reformed Theology«3 führt als weiteren reformierten Klassiker Jonathan Edwards4 auf. In der Tat ist das amerikanische Reformiertentum ohne diesen großen Prediger und Theologen der Erweckung kaum zu denken.
Die Frage, welchem Typus die reformierten Kirchen und Gemeinden in Deutschland zuzuordnen sind, ist nicht leicht zu beantworten. Auf jeden Fall konnte hier der Zwinglianismus kaum Fuß fassen. Auch die Charakterisierung der deutschen Reformierten als Calvinisten ist schwierig; sie würde eigentlich nur für diejenigen Gemeinden zutreffen, in denen die »Confession de foi« in Geltung stand oder steht – also für die französisch-reformierten Gemeinden, die sich mit der Einwanderung der Hugenotten nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes bildeten. Man könnte bei den Reformierten in Deutschland vielleicht von einem Calvinismus à la Heidelberg sprechen, da sie durch die Schule des Heidelberger Katechismus gegangen sind, in der ihnen die Lehre von der doppelten Prädestination in äußerst abgemilderter Form beigebracht worden ist und auch die Ekklesiologie samt der disciplina ecclesiastica nicht sehr auffällig ist. Wenn man bedenkt, dass mit Zacharias Ursinus, einem der maßgeblichen Verfasser des Heidelberger Katechismus, manche Motive der Theologie Melanchthons in den Katechismus einfließen konnten, wäre auch die Rede von einem melanchthonisch bestimmten Typus des deutschen Reformiertentums möglich. Dann würde man sich der Lesart des nordhessischen Theologen Heinrich Heppe annähern, den Mitte des 19. Jahrhunderts die Pluralität reformatorischer Theologie und Frömmigkeit vor ihrem Eintritt in die Blockbildungen des konfessionellen Zeitalters beschäftigt hatte. Heppe stellte die These von einer eigenständigen, von Melanchthon geprägten deutsch-reformierten Kirche auf, die sich erst im Zuge der mit der Konkordienformel vollzogenen lutherischen Abgrenzungen dem calvinistisch-reformierten Konfessionstyp angenähert habe.5 Für die Zukunft versprach sich Heppe von der Wiederbelebung jenes ursprünglich melanchthonischen evangelischen Protestantismus einen aussichtsreichen Weg zur Union von Reformierten und Lutheranern.
Dort, wo reformierte Theologie als Lehrfach angeboten wird, werden auf jeden Fall die Bekenntnisentwicklungen der reformierten Kirchen und die Theologie des Heidelberger Katechismus behandelt. Eine Beschäftigung mit Zwingli ist wegen seiner Bedeutung für die alternative Entwicklung der reformatorischen Abendmahlslehre wichtig. Calvin und seinem Werk – das heißt seiner Theologie und seiner Konzeptionen für Kirchenrecht und -ordnung – gebührt die Rolle eines profilbildenden Schwerpunkts.
III.REFORMIERTE AKZENTE
Reformierte Theologie ist evangelische Theologie. Die Verbundenheit mit den anderen aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen und Theologien darf man nicht übersehen, wenn man nach den prägenden Besonderheiten der reformierten Kirchen und Theologien fragt. Ein auf Abgrenzung und Überbietung bedachter Konfessionalismus widerspricht der reformierten Auffassung von der Einheit der Kirche. Vor der Frage nach den spezifisch reformierten Akzentsetzungen hat immer zuerst die Frage nach dem gemeinsam Evangelischen zu stehen. Das Ergebnis lässt sich in summa so rekapitulieren:
Alle reformatorischen Kirchen wollten bewusst Kirchen des verkündigten Wortes sein und standen mehr oder minder kritisch zu den Vorgaben kirchlicher Tradition. Alle lehnten mehr oder minder deutlich die Hierarchie als kirchliches Gestaltungsprinzip ab und schätzten, jedenfalls verbal, das allgemeine Priestertum aller getauften Glaubenden. Alle fühlten sich dem befreienden Evangelium der Rechtfertigungsbotschaft verpflichtet und wussten, dass auch die Kirche irren kann und in gleicher Weise von der Vergebung lebt wie die, denen sie Vergebung zuspricht. In der hohen Wertschätzung des solus Christus, sola fide, sola gratia und sola scriptura gab und gibt es zwischen Reformierten und Luheranern keinen kirchentrennenden Dissens. Dieser brach erst – man denke an die Artikel des Marburger Religionsgesprächs von 1529 –6 in der Abendmahlsfrage auf.
Gleichwohl sind die unterschiedlichen Akzente im gemeinsamen Verständnis des Reformatorischen nicht zu übersehen. Der besondere reformierte Akzent besteht zweifellos darin, dass die reformierten Kirchen noch konsequenter als ihre lutherischen Geschwister Kirchen der Reformation sein wollten. Rein äußerlich erkennt man das daran, dass die Reformierten ganz bewusst auf einen Menschennamen in der Konfessionsbezeichnung verzichtet haben. Sie begriffen und begreifen sich als eine nach Gottes Wort reformierte Kirche.7 Damit ist zweierlei im Blick. Erstens: Es ist das Wort Gottes, nicht die menschliche Organisations- und Gestaltungslust, das die Kirche erneuert und zur erneuernden Umkehr ruft. Reformation und Erneuerung geschehen im Hören auf das Wort dessen, der der Herr der Kirche ist. Im Kirchennamen ist die Grundregel aller kirchlichen Erneuerung festgeschrieben. Und zweitens: Reformation und Erneuerung sind ein andauernder, die Kirche stets begleitender Prozess; die Reformation geht weiter, begleitet die Kirche auf ihrem Weg durch die Zeiten als kritischer Schrittmacher zu neuen Stationen, Kontexten, Herausforderungen. Der vielzitierte Satz ecclesia est semper reformanda8 trifft dieses Selbstverständnis ziemlich genau. Konsequenter reformatorisch bedeutete auch konsequenter in der Abgrenzung von Rom – dies übrigens bis in die Liturgie und die Gestaltung des Kirchenraums hinein. Darin war dann auch eine identitätsbestimmende Unterscheidung vom konfessionsverwandten Luthertum impliziert, nach der die Lutheraner bisweilen als auf halbem Wege stehengebliebene Evangelische betrachtet werden konnten.
Das Bemühen, konsequenter reformatorische Kirche zu sein, wirkte deutlich profilierend. Man wollte das Wort Gottes konsequenter hören, deshalb hörte man es von Anfang an in der Einheit der Bibel Alten und Neuen Testaments. Reformierte Theologie betont stärker die Einheit der Schrift als die diese Einheit in Schwingung versetzende Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Sie unterscheidet, aber scheidet nicht, deshalb der konstruktive paränetische Gebrauch des Gesetzes Gottes. Man wollte den neuen Gehorsam der Christen energischer zur Geltung bringen und maß den Zehn Geboten (in ihrer ursprünglichen biblischen Zählung) großes Gewicht zu. Man widmete der Gestaltung des christlichen Lebens unter der Regie des tertius usus legis große Aufmerksamkeit. Die Rechtfertigung wurde mit Calvin final auf die Heiligung hingeordnet. Der Primat der Gnade kam wiederum in der Lehre von Gottes souveräner Gnadenwahl zum Ausdruck, die seit der Synode von Dordrecht (1618/19) als Identitätsmarker reformierter Orthodoxie gilt.
Bemerkenswert sind die Auffassungen zur Ordnung und Gestalt der Kirche. Die Gemeinden sollten wieder nach neutestamentlichem Vorbild gebaut werden. Calvin schuf deshalb das viergliedrige Amt von Pastoren, Lehrern, Ältesten und Diakonen. Seine Kirchenordnung sah die mündige Mitverantwortung der sogenannten Laien vor. Presbyterien und Synoden sollten in einem wohldurchdachten Zusammenspiel die Kirchenleitung ausüben. So entstand im 16. Jahrhundert die presbyterial-synodale Kirchenordnung. Leitungsämter wurden nach dem Rotationsprinzip besetzt; ein monarchisches Bischofsamt stand im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass alle Pastoren »unter einem einzigen Haupt, einzigen Herrn und einzigen allgemeinen Bischof, Jesus Christus« dasselbe Ansehen und die gleiche Macht haben »und dass aus diesem Grunde keine Gemeinde irgendeine Obergewalt oder Herrschaft beanspruchen darf«.9
Das Verhältnis zu den Instanzen der politischen Herrschaft war in der Regel ein kritisches. Oft genug war man Kirche im Widerstand und in der Leidensnachfolge gewesen und wollte sich möglichst unabhängig von staatlicher Bevormundung wissen. Es war zudem nicht nebensächlich, dass Zwingli und Calvin in Stadtrepubliken wirkten, wo nicht fürstliche Obrigkeiten, sondern gewählte Magistrate die Geschicke lenkten. Man kann durchaus von einer besonderen politischen Sensibilität der reformierten Kirchen in Westeuropa sprechen und ihnen einen nicht unwichtigen Anteil an der neuzeitlichen Plausibilisierung demokratischer Herrschaftsformen zuerkennen.
Dass alles zur Ehre Gottes geschehen müsse, kann als ein Zentralmotiv reformierter Theologie gelten. Calvins Genfer Katechismus von 1545 sieht in der Gotteserkenntnis den Sinn des menschlichen Lebens. »Er hat uns ja dazu geschaffen und in diese Welt gestellt, um in uns verherrlicht zu werden. So ist es nichts als recht und billig, daß unser Leben, dessen Ursprung er ist, wiederum seiner Verherrlichung diene« (Fragen 1 und 2). Wenn uns die Gotteserkenntnis fehlt, »sind wir trauriger dran als irgendein Tier« (Frage 4), so dass dem Menschen »nichts Schlimmeres zustoßen kann, als gottlos zu leben« (Frage 5).10 Der Mensch wird aus der Verkrampfung in sich selbst gelöst und in die Weite der Gotteserkenntnis geführt. Weil allein Gott wichtig ist, braucht er sich nicht mehr wichtig zu nehmen. Man glaubte, liebte, hoffte, man arbeitete, dachte und wirkte unter dem Vorbehalt, dass alles menschliche Tun der Ehre Gottes dienen müsse. Deshalb blieb man fast immer nüchtern gegenüber einem Zuviel an menschlichem Gepränge, auf charmante Weise respektlos und unbefangen gegenüber aufdringlichen Autoritäten und ruhmbedachten Selbstdarstellungen, auf eine erfrischende Weise voll trockenen Humors gegenüber Heiligenlegenden, heiligen Gefühlen oder Personenkult.
IV.VERÄNDERUNGEN REFORMIERTER LEHRPOSITIONEN – DAS BEISPIEL DER LEUENBERGER KONKORDIE
Konfessionen sind geschichtliche Phänomene und unterliegen dem Wandel. Die Lehrdifferenzen des 16. Jahrhunderts lassen sich nicht maßstabgetreu in die Welt des 21. Jahrhunderts übertragen – glücklicherweise, möchte man sagen. Es gibt freilich immer auch Kräfte, die die Verflüssigung konfessioneller Differenzen mit Argwohn betrachten und beharrlich an deren Festigung und Versteinerung arbeiten.
Wer jedoch die heutigen weltanschaulichen und religiösen Umbrüche in Kirche und Gesellschaft vor Augen hat, wird dazu neigen, die herkömmlichen innerevangelischen Lehrdifferenzen als Anachronismen zu betrachten. Wo der Glaube an Gott so grundsätzlich zur Frage wird, wie wir das heute beobachten, verlieren die spezifisch protestantischen, ja sogar die katholischen Einfärbungen dieses Glaubens spürbar an Gewicht. Der Lutheraner Dietrich Bonhoeffer, dessen Neuzeitdiagnosen und Thesen vom religionslosen Christentum zu denken geben, hatte im August 1944 ausdrücklich vermerkt, dass sich auf dem Boden der elementar gestellten Frage »Was glauben wir wirklich? d. h. so, daß wir mit unserem Leben daran hängen?«11 die interkonfessionellen Kontroversfragen als überholt erweisen. Er fügte hinzu: »[D]ie lutherisch-reformierten – (teils auch katholischen) Gegensätze sind nicht mehr echt. Natürlich kann man sie jederzeit mit Pathos repristinieren, aber sie verfangen doch nicht mehr. Dafür gibt es keinen Beweis, davon muß man einfach auszugehen wagen. Beweisen kann man nur, daß der christlich-biblische Glaube nicht von diesen Gegensätzen lebt und abhängt.«12
Ganz gewiss hat Bonhoeffer überzeichnet. Auch bei der Frage »Was glauben wir wirklich? d. h. so, dass wir mit unserem Leben daran hängen?« dürfte man rascher von den konfessionsverschiedenen Antwortperspektiven eingeholt werden, als man zunächst vermutet hatte. Aber Bonhoeffer hat richtig gesehen, dass sich die konfessionellen Unterschiede angesichts der sehr unterschiedlichen Reaktionsweisen der christlichen Kirchen und Theologien auf die religiösen Verdunstungs- und Transformationsprozesse im heutigen Europa relativieren und umformatieren.
Das konnte man schon im sogenannten Kirchenkampf des Jahres 1933 und dann auf dem Weg zur Barmer Theologischen Erklärung beobachten. Karl Barth sah in seinen Vorbemerkungen zur Kommentierung des Entwurfs des Betheler Bekenntnisses eine Zeit gekommen, in der sich die Unionsfrage neu stelle, weil Reformierte und Lutheraner gemeinsam dazu herausgefordert seien, der Häresie der Deutschen Christen zu begegnen, die Barth als ebenso konsequente wie primitive Spätfolge des Neuprotestantismus einschätzte.13 Im Oktober 1933 schrieb Barth: »Die ernsthaften Fronten laufen heute wirklich durch die Grenzen der beiden überkommenen Bekenntnisse quer hindurch.«14 Fast wortgleich sprach die Leuenberger Konkordie15 40 Jahre später von »neue[n], quer durch die Konfessionen verlaufende[n] Gegensätze[n]« (LK 5) und kommentierte dann die derzeitige Lage so: »Aufgrund ihres gemeinsamen Erbes müssen die reformatorischen Kirchen sich mit den Tendenzen theologischer Polarisierung auseinandersetzen, die sich gegenwärtig abzeichnen. Die damit verbundenen Probleme greifen zum Teil weiter als die Lehrdifferenzen, die einmal den lutherisch-reformierten Gegensatz begründet haben« (LK 40). Und: »Es wird Aufgabe der gemeinsamen theologischen Arbeit sein, die Wahrheit des Evangeliums gegenüber Entstellungen zu bezeugen und abzugrenzen« (LK 41).
Die Leuenberger Konkordie nennt drei theologische Konfliktherde, die im 16. Jahrhundert zu Verwerfungsurteilen zwischen Lutheranern und Reformierten und damit zu ihrer Trennung geführt hatten: die Abendmahlslehre, die Christologie und die Lehre von der Prädestination (vgl. LK 17).16 Eigentlich war es nur die Abendmahlslehre gewesen, die zunächst Luther und dann die Lutheraner zu vehementen Lehrverurteilungen gegenüber der reformierten Auffassung veranlasst hatte. Sodann war natürlich die Christologie als die hinter der Abendmahlslehre stehende und sie präformierende Leitperspektive tangiert.
Interessant ist der Umstand, dass die Differenzen in der Tauflehre keine explizite Rolle spielten. Denn auch im Taufverständnis hatte es in der Vergangenheit beachtliche Differenzen gegeben. Sie wurden nur deshalb nicht zum Gegenstand von Lehrverurteilungen, weil Lutheraner und Reformierte stets die jeweils vollzogenen Taufen anerkannt haben. Die sich an Calvin17 orientierende Tauflehre betrachtet die Taufe mit Wasser als Abbild der durch Christi Blut vollzogenen Reinigung des Menschen von der Sünde. Dabei tritt das für Lutheraner wichtige kausative Moment der Heilszueignung im Vollzug der Taufe zugunsten des erwählenden Handelns Gottes zurück. So stellt die Taufe nach reformierter Auffassung die Gotteskindschaft des Menschen nicht her, sondern bringt sie als bereits bestehend zum Ausdruck; sie dokumentiert sinnfällig die Zugehörigkeit des Menschen zum Gnadenbund Gottes. Gottes Ja wird im Vorgang der Taufe unverbrüchlich bezeugt und bekräftigt, aber es geht ihm voraus und ist nicht an ihn gebunden. Aus diesem Grund hat die reformierte Theologie die Nottaufe abgelehnt.
Wenn man auf diesem Hintergrund den Taufabschnitt der Leuenberger Konkordie liest, wird man sagen können, dass sich die Reformierten inzwischen einem kausativen Taufverständnis deutlich angenähert haben: In der Taufe nimmt Jesus Christus »den der Sünde und dem Sterben verfallenen Menschen unwiderruflich in seine Heilsgemeinschaft auf, damit er eine neue Kreatur sei« (LK 14). Hinter dieser beachtlichen Annäherung kann ein Wandel der Denkformen im Sakramentsverständnis konstatiert werden. Dieser Wandel wäre auf jeden Fall als ein Wandel vom Zeugnischarakter des Taufsakraments zum Zueignungscharakter zu beschreiben. Auf jeden Fall haben die europäischen Reformierten und Lutheraner mit der Leuenberger Konkordie ein gemeinsames Verständnis der Taufe entwickelt, das über die klassischen Lehrdifferenzen hinausgeht. Heute kann auf der reformierten Seite der mit der Zuwendung Gottes zum Einzelnen verbundene Aspekt der Heilszueignung anerkannt und damit auch dem von den Lutheranern immer hervorgehobenen Charakter der Taufe als der eines wirksamen Zeichens (signum efficax) des Versöhnungsgeschehens zwischen Gott und Mensch Rechnung getragen werden.
Wer die Debatten um die Prädestinationslehre im 16. und frühen 17. Jahrhundert genauer verfolgt hat, wird ein wenig erstaunt sein, dass die Konkordie auch an dieser Stelle von den »Verwerfungen der reformatorischen Bekenntnisse« (LK 26) spricht. Das war nicht sehr genau. Die Prädestinationslehre hat im Reformationszeitalter keine kirchentrennenden Wirkungen gehabt und war bis etwa 1560 bei unterschiedlichen Akzentsetzungen Gemeingut reformatorischer Theologie. Erst in der Folgezeit wurde sie zu einem beliebten Topos der gegenseitigen Konfessionspolemik.18 Regelrechte Lehrverurteilungen bieten dann die Canones der Dordrechter Synode von 1619.19 Verkompliziert wird die Situation noch dadurch, dass der Heidelberger Katechismus nur verhalten von der Prädestinationslehre spricht und keine Lehre von der doppelten Prädestination vertritt, während auf der Dordrechter Synode Reformierte gegen Reformierte gestritten haben. Dennoch standen nun Lehrverurteilungen im Raum, so dass es richtig war, dass die Leuenberger Konkordie zur Prädestination Stellung genommen hat. Sie betont den universalen Heilswillen Gottes (vgl. LK 25) und hebt gegenüber der Lehre von der doppelten Prädestination hervor, dass es uns das Christuszeugnis der Schrift verwehrt, »einen ewigen Ratschluß Gottes zur definitiven Verwerfung gewisser Personen oder eines Volkes anzunehmen« (LK 25).
In der Bibel wird von Erwählung gesprochen, ohne dass sogleich eine Symmetrie von Erwählung und Verwerfung unterstellt wird. So impliziert die Erwählung Israels nicht die Verwerfung der Völker, und mit der Erwählung der christlichen Gemeinde ist auch nicht automatisch die Verwerfung aller Nichtchristen ausgesagt. Die Konkordie verankert deshalb die Rede von der Erwählung im solus Christus: Über sie kann »nur im Blick auf die Berufung zum Heil in Christus gesprochen werden« (LK 24). Man kann hier festhalten, dass eine vertiefte Betrachtung der Soteriologie unter Beachtung des biblischen Redens von der Erwählung zu einer von Lutheranern und Reformierten gemeinsam verantworteten Revision der Lehre von der doppelten Prädestination geführt hat. Welche Rolle dabei die Revision der Erwählungslehre durch den reformierten Theologen Karl Barth gespielt hat, der sie bekanntlich als »Summe des Evangeliums«20 reinterpretierte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall dürfte Barths Neuinterpretation das Bewusstsein für »die Realität des universalen Heilswillen Gottes« (LK 25) gestützt haben. Kaum jemals ist vor seinem Neuentwurf von 1942 so klar gesagt worden, dass Gott Menschen erwählt, ohne gleichzeitig Menschen zu verwerfen, weil in der Erwählung Jesu Christi alle Menschen erwählt sind und in dem ihn am Kreuz treffenden Verwerfungsurteil die Verwerfung aller vollstreckt ist.21
Wenn wir die Aussagen zu Christologie und Abendmahlslehre betrachten, dann fallen wiederum markante Lehrfortschritte auf. Sie verdanken sich einem langen, über mehrere Stationen verlaufenden Gesprächsprozess, bei dem das Arnoldshainer Abendmahlsgespräch der Evangelischen Kirche in Deutschland die Schlüsselrolle spielte.22 Der lebendige Jesus Christus ist der Herr, der uns einlädt und sich uns in der Feier des Mahls schenkt. Die Kontroversen über seine Gegenwart konnten in dem Maße überwunden bzw. in ihrem kirchentrennenden Gewicht relativiert werden, indem man es lernte, den zum Mahl einladenden Christus als das handelnde Subjekt der Mahlfeier zu verstehen. Er vergegenwärtigt sich in seiner Person und schenkt sich uns »in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein« (LK 15 und 18). Dieser Sichtweise wurde die Frage nach dem Wie der sakramentalen Vergegenwärtigung Christi bewusst nachgeordnet. Das bedeutet, dass nun die personalen Denkformen bei der Deutung des Mahls die Regie übernehmen. Demgegenüber sind die auf Brot und Wein als Träger oder Zeichen der Christuswirklichkeit fixierten Denkformen in den Hintergrund getreten. Das hat man auf die Formel gebracht: Die Denkformen der Ontologie der Relation haben die Denkformen der Ontologie der Substanz bzw. des Seins oder des Dinges abgelöst.
Allen Beteiligten sei klar gewesen – so der Lutheraner Helmut Gollwitzer in seiner Erläuterung des Abendmahlsgesprächs von Arnoldshain –, dass wir es im Abendmahl »nicht mit einem Etwas, sondern mit ihm selbst zu tun [haben], mit ihm aber in seiner Einheit als dem Irdischen und dem Erhöhten, mit der Frucht seines Sterbens, mit dieser aber dadurch, daß wir seinem Sterben gleichzeitig werden, – mit ihm also in der einmaligen Leibhaftigkeit und Realität seines Sterbens und Auferstehens, durch die sein Wort Gegenwart ist«23. Diese Klärungen verdankten sich intensiver exegetischer Arbeit. Eine an der neueren Schriftexegese geschulte Überprüfung der tradierten Abendmahlslehren führte auf lutherischer und auf reformierter Seite zu Einsichten, die die herkömmliche Auslegung der Einsetzungsworte revolutionierten. Wer wissen möchte, ob und wie exegetische Diskurse die dogmatische Theoriebildung befruchten und verändern, kann dafür in den lutherisch-reformierten Abendmahlsgesprächen ein überzeugendes Paradigma finden.
Die christologischen Annahmen, die in der Vergangenheit häufig zu Gesprächsblockaden geführt hatten, sind mit Hilfe der personal-geschichtlichen Denkkategorien überwunden worden. So hat man erkannt, dass die räumlichen Vorstellungen, mit deren Hilfe man die Erhöhung des auferstandenen Christus zur Rechten Gottes des Vaters gedacht hat, der christologischen Wirklichkeit, um die es hier geht, nicht mehr angemessen sind. Dann aber ließ sich auch die Alternative zwischen der Ubiquität der menschlichen Natur Christi (so Luther) einerseits und der Auffassung, dass er »nach seiner menschlichen Natur jetzt nicht mehr auf der Erde ist«24 und deshalb nicht leiblich, sondern nur geistlich in den Gaben des Mahls präsent sein kann (so Calvin) andererseits, vermeiden. Die Reformierten haben sich von dem traditionellen Parallelismus zwischen leiblichem und geistlichem Essen gelöst, den sie als einen in der Schrift so nicht vertretenen Dualismus erkannten, und auf diesem Wege das Verständnis für die sakramentale Realität der Abendmahlsgabe verstärkt. Die räumlichen Kategorien erweisen sich als geschichtlich bedingte Denkformen, die die Theologie vor die Aufgabe stellen, »neu zur Geltung zu bringen, was die reformierte Tradition in ihrem besonderen Interesse an der Unversehrtheit von Gottheit und Menschheit Jesu und was die lutherische Tradition in ihrem besonderen Interesse an seiner völligen Personeinheit geleitet hat« (LK 22).
So lange das theologische Denken mit Raum- und Substanzvorstellungen arbeitete, konnte die Gegenwart Christi im Abendmahl kaum anders ausgesagt werden als in den Kategorien einer in Brot und Wein zu lokalisierenden Realpräsenz einerseits und in einer die himmlischen Materien geistlich vergegenwärtigenden Spiritualpräsenz andererseits. Das eucharistische Denken war an solche Denkmodelle gebunden, zu denen dann ja noch die Denkmodelle der Transsubstantiation einerseits und der anamnetischen Vergegenwärtigung andererseits hinzukamen. Immer ging es darum, so genau wie nur möglich die besondere Anwesenheit des Gekreuzigten und Auferstandenen im Vollzug des Mahls zu bestimmen. Aus diesem Grund sind die damaligen Verwerfungsurteile nicht einfach falsch gewesen und können retrospektiv »nicht als unsachgemäß bezeichnet werden« (LK 27). Sie sind aber heute »kein Hindernis mehr für die Kirchengemeinschaft« (ebd.), weil man die Abendmahlslehre gemeinsam weiterentwickeln konnte und nun zu einer Auffassung gelangt ist, in der die Verwerfungen von damals den heute in den Kirchen erreichten Stand der Lehre nicht mehr treffen (vgl. LK 26).
Das bedeutet: Die an Gemeinschaftsbeziehungen und nicht Materien orientierten personalen Denkformen der Abendmahlsauffassung der Leuenberger Konkordie lassen die klassische innerevangelische Kontroverse um Realpräsenz oder Spiritualpräsenz hinter sich, indem von der Person des sich in der ganzen Mahlfeier in bestimmter Weise, nämlich im Akt des Essens und Trinkens, vergegenwärtigenden Jesus Christus ausgegangen werden kann. Er ist in der ganzen Mahlfeier präsent – nicht nur in Brot und Wein, aber doch gebunden an ihren Verzehr (vgl. LK 19). Die Wahrheitsmomente der Realpräsenz und der Spiritualpräsenz gehen in der Personalpräsenz des Gekreuzigten und Auferstandenen auf. Das ist ein ganz beachtlicher Erkenntnisfortschritt, bei dem wir nicht nur besser verstehen, was im Abendmahl vor sich geht, sondern auch wieder näher bei der Deutung der Mahlfeiern in der neutestamentlichen Überlieferung sind.
Die Leuenberger Konkordie »läßt die verpflichtende Geltung der Bekenntnisse in den beteiligten Kirchen bestehen. Sie versteht sich nicht als ein neues Bekenntnis. Sie stellt eine im Zentralen gewonnene Übereinstimmung dar, die Kirchengemeinschaft zwischen Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes ermöglicht« (LK 37). Aber: Diese »im Zentralen gewonnene Übereinstimmung« bewegt sich lehr- und erkenntnismäßig auf einer Ebene, auf der gemeinsam Aussagen getroffen werden, die über die Aussagen der bisherigen Bekenntnisse hinausgehen und im gemeinsamen Hören auf die Schrift die kirchliche Lehre weiterentwickeln. Aus diesem Grund kann man sich nicht einfach auf die in den klassischen Bekenntnistexten eingenommenen Lehrpositionen zurückziehen. Man soll sie im Licht einer überkonfessionell betriebenen Lehrentwicklung spiegeln und so als Stationen eines Erkenntnisprozesses würdigen, der für neue Einsichten offen ist.
Man kann also nicht so tun, als seien die Reformierten bei ihren charakteristischen Lehrpositionen des 16. Jahrhunderts stehengeblieben. Wer an der durch die Leuenberger Konkordie begründeten Kirchengemeinschaft teilhat, wird die in ihr getroffenen Aussagen nicht übergehen und bei der Auslegung des Heidelberger Katechismus und anderer Bekenntnistexte nicht einfach auf den dort zu den Sakramenten, zur Christologie und zur Prädestinationslehre bezogenen Positionen beharren können. Das geschieht leider viel zu oft. Die Folge sind Ungleichzeitigkeiten in der Wahrnehmung dessen, was als reformiert zu betrachten ist. Gerade auf den Spuren Calvins, der immer wieder eine bestimmte Annäherung an die Abendmahlsauffassung der Lutheraner gesucht und verteidigt hat, wird man die Aussagen der maßgeblichen Bekenntnistexte des 16. und frühen 17. Jahrhunderts nicht zementieren. Wer das dennoch tut, wird den mit der Konkordie erreichten, gemeinsam gewonnenen Erkenntnisfortschritt ausschließlich am Wortlaut der Bekenntnistexte des 16. Jahrhunderts messen und eine Haltung an den Tag legen, die man – leider – als Bekenntnisfundamentalismus charakterisieren muss.
V.IMPULSE FÜR DEN HEUTIGEN THEOLOGISCHEN DISKURS
Es ist hier nicht der Ort, die Leistungen der reformierten Theologie in der Theologieschichte des 20. Jahrhunderts im Detail zu würdigen. Allgemein lässt sich sagen, dass die deutschsprachige reformierte Dogmatik zeitweise Weltgeltung erlangte. Das war im Wesentlichen drei Autoren zu verdanken, darunter gleich zwei Schweizern: Karl Barth, Emil Brunner und Jürgen Moltmann. Barth repräsentierte mit seinem Werk die einflussreichste Aufbruchs- und Erneuerungsbewegung der evangelischen Theologie seit Schleiermacher. Immer wieder gab er die Themen vor, die bis zum Ende der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die theologische Diskussion beherrschten. In Barths Kirchlicher Dogmatik vollzog sich ein fulminanter Umbau des protestantischen Lehrgebäudes, bei dem auch die herkömmlichen reformierten Spezifika wie die Christologie, die Erwählungslehre und die Sakramentslehre umfassend revolutioniert wurden. Bemerkenswert sind die Wirkungen, die Barth bei einigen lutherischen Theologen und bis weit in die katholische Theologie hinein erzielte.
Emil Brunner steht im Schatten Barths und scheint zunehmend in Vergessenheit geraten zu sein. Aber das ändert nichts an seiner Bedeutung. Wie Barth begründete Brunner die Theologie auf die Anrede Gottes an den Menschen, wollte aber der dialogischen Situation zwischen dem christlichen Glauben und dem neuzeitlichen Menschen anders und – wie er meinte – genauer Rechnung tragen. So hatte er eine Vorliebe für Fragestellungen, die er bei Barth nicht angemessen beachtet fand, und entwickelte damit so etwas wie eine Korrektivfunktion gegenüber den theologischen Lösungen Barths. Da er leichter zu verstehen war als Barth, fanden seine Arbeiten im angelsächsischen Bereich so viel Resonanz, dass er dort als der eigentliche Prototyp der dialektischen Theologie wahrgenommen wurde. Wesentliche Einsichten der dialektischen Theologie sind über Emil Brunner an die internationale Theologenszene vermittelt worden.
Jürgen Moltmann dürfte weltweit der meistgelesene evangelische Systematiker der letzten Generation sein. Einige seiner Bücher – vor allem die »Theologie der Hoffnung« (1964)25 und die »Ökologische Schöpfungslehre« (1985)26 – haben die Debatten in Theologie und Kirche regelrecht vorangetrieben. Sein Schreibstil führte aus der strengen Theoriesprache der Dogmatik hinaus und erleichterte eine breite Rezeption. Moltmann besitzt ein ausgeprägtes Gespür für die akuten Herausforderungen in Kirche und Gesellschaft und sucht die lebensverändernden Energien des Glaubens in den Leidensgeschichten dieser Welt zur Sprache zu bringen. Sein Einfluss auf das allgemeine Problembewusstsein einer bestimmten kirchlichen Öffentlichkeit ist freilich wesentlich stärker als seine Wirkungen auf die forschungsbasierte Theoriebildung im Fach.
In der Geschichte der evangelischen Theologie im 20. Jahrhundert hat die reformierte Theologie eine exponierte Rolle gespielt. Woran lag das? Waren es eher die äußeren Umstände, vielleicht auch ein wenig Providenz, die zu diesem Befund führten? War es das glückliche Zusammentreffen einer besonderen Begabung und eines für einen Paradigmenwechsel reifen Kairos? Oder kann man auch von einer der reformierten Theologie innewohnenden Tendenz zur Innovation, zur Überwindung erstarrter Theorieschemata sprechen, die sie unter bestimmten Bedingungen dazu disponiert, Initiativen zu ergreifen, wo andere abwarten, und beherzt auf neue Fragestellungen zuzugehen, wo andere zur Lösung theologischer Probleme lieber auf bewährte Theorieschemata und Erklärungsmuster zurückgreifen?
Barth hat mit einer häufig von ihm benutzten und so berühmt gewordenen Wendung davon gesprochen, dass die Theologie immer wieder neu mit dem Anfang anzufangen habe.27 Das ist ein Anstoß zur Neubesinnung und zum Stellen neuer Fragen und nicht das Fortschreiben von Überlieferungen. Er habe Theologie immer als »Entdeckungsreise«, nie als Verteidigung von alten Lehren oder kirchlichen Dogmen betrieben, erläuterte Jürgen Moltmann, um dann seinen Denkstil als experimentell zu charakterisieren – »ein Abenteuer der Ideen« – und für seinen Mitteilungsstil »die Form des Vorschlags« zu reklamieren.28 Er erläuterte das so: »Ich verteidige keine unpersönlichen Dogmen, ich äußere aber auch nicht nur meine persönliche Meinung: ich mache Vorschläge in einer Gemeinschaft. Die Sätze, die ich schreibe, sind darum ungesichert und – wie manche meinen – waghalsig. Sie sollen zum eigenen Denken herausfordern und natürlich auch zum sachlichen Widerspruch.«29
Dem Selbstverständnis einer nach Gottes Wort reformierten Kirche folgend, sieht sich reformierte Theologie an das Wort Gottes und an die dieses Wort bezeugenden Textwelten der Bibel gewiesen. In einer Diskurslandschaft, in der sich das Verhältnis der Systematischen Theologie zu Schriftauslegung und Exegese spürbar gelockert hat und sich die produktive Würdigung biblischer Texte als Entdeckungszusammenhang theologischer Erkenntnis nicht mehr von selbst versteht, möchte die reformierte Theologie für den Schriftbezug des theologischen Denkens eintreten und einem hermeneutisch engagierten Theologietyp den Vorzug geben. Michael Welker, für dessen Denken das interdisziplinäre Gespräch mit der Exegese programmatische Bedeutung gewann, und David Willis sahen den ökumenischen Beitrag der reformierten Theologie darin, »daß sie sich ruhig und beharrlich, kritisch und konstruktiv den vielen Versuchen widersetzt, das Wort Gottes zu entleeren und es unter die Herrschaft von Metaphysik, Moral, Mystik oder unter das Diktat des ›Zeitgeists‹ zu bringen«30. Es sei Aufgabe der reformierten Theologie, »den vertrauensvollen, kritischen und konstruktiven Dienst an Gottes Wort zu einer ›theologischen Haltung‹ werden zu lassen«31 und in den Pluralismen, Konflikten und Krisen der Zeit der befreienden, schöpferischen und erschließenden Kraft dieses Wortes Wege zu öffnen.
Eine Theologie, die sich in ihren Konzepten und Denkgewohnheiten immer wieder neu durch die Einsichten unterbrechen lässt, die aus der heutigen Begegnung mit den Textwelten der Bibel erwachsen, kann innovativ werden. Es sei an die dogmatischen Theorieschübe des 20. Jahrhunderts erinnert, von denen sich nicht wenige der reformierten Dogmatik verdankten: an die Neuformulierung des Verhältnisses von Gesetz und Evangelium, an die soteriologische Revision der klassischen Prädestinationslehre, an die differenzierte Weiterentwicklung der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre und der christonomen Begründung der Ethik, sodann an die Weiterentwicklung der Sakramentslehre, ferner an die Verortung der christlichen Hoffnung im Horizont der gesellschaftspolitischen Verantwortung der christlichen Gemeinde, an eine die mitreißende Dynamik von Gottes Geist neu entdeckende Pneumatologie oder an die theologische Würdigung des Segens. Man kann hier durchaus von biblisch instruierten Modernisierungspotentialen für die theologische Theoriebildung sprechen, die die theologische Arbeit auf jeden Fall vor intellektueller Erschöpfung und Vergreisung bewahren.
Auch die ökumenische Dimension theologischer Arbeit kann durch Impulse aus der reformierten Theologie gefördert werden. Zwar sind die maßgeblichen ökumenischen Dialoge zwischen der römisch-katholischen Kirche und den evangelischen Kirchen über die Theologen des Lutherischen Weltbunds gelaufen; es schien, als habe dieser auf dem ökumenischen Parkett die Sprecherfunktion für die evangelische Christenheit übernommen, zumal man in Rom dazu neigt, die Protestanten mit den Lutheranern zu identifizieren.
Dabei wäre die Entstehung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre (1999) durchaus konstruktiver und vielleicht auch weniger angespannt verlaufen, wenn man die Reformierten in die Ausarbeitung des Textes einbezogen hätte. Die reformierte Theologie denkt die Rechtfertigung des Sünders final von seiner Erneuerung her und dürfte an diesem Punkt einer berechtigten katholischen Intention entgegenkommen. Barths Interpretation der Rechtfertigungslehre und ihre Relektüre durch Hans Küng32 wie auch dann die schroffe Kritik Eberhard Jüngels an Barths christologischer Zentrierung der rechtfertigungstheologischen Kriteriologie33 haben das je auf ihre Weise belegt. Schon Calvin hatte unbeirrt am sola fide festgehalten, aber es zugleich wirksam vor dem Verdacht geschützt, der billigen Gnade Vorschub zu leisten. Und für die Heiligung des Gerechtfertigten war ihm der Gedanke eines Zusammenwirkens von göttlicher und menschlicher Aktivität geradezu konstitutiv, wie dann ja auch im 20. Jahrhundert in Barths Dogmatik das Konzept einer Partnerschaft zwischen Gott und Mensch zum Thema wird.
Perspektiven für die Ökumene bietet auch die reformierte Ekklesiologie. Es gibt zwar den von Confessio Augustana VII her formulierten Leitkonsens, dass pura doctrina evangelii und recta administratio sacramentorum die entscheidenden Kennzeichen der sichtbaren Kirche bilden. Dieser Konsens, der eine wichtige Voraussetzung der Leuenberger Konkordie geworden ist, wird von der reformierten Theologie bejaht. Aber sie würde deshalb die Frage nach Gestalt und Ordnung der Kirche nicht zu einem nachgeordneten Thema erklären. Seit jeher werden auch Fragen der Ordnung der Kirche und des Kirchenrechts als theologische Fragen erörtert. Die in der dritten These von Barmen behauptete Korrespondenz von Botschaft und Ordnung der Kirche34 lag ganz auf dieser Linie. In der explizit theologischen Würdigung von Ordnungsfragen trifft sich die reformierte Theologie mit der römisch-katholischen Auffassung, dass die äußere Gestalt der Kirche nicht als Adiaphoron behandelt werden kann. Sie gelangt dabei zu Konsequenzen, die in vieler Hinsicht einen Gegensatz zu den römisch-katholischen Auffassungen über Amt und episkopé der Kirche bilden. Aber der Zweitakt von verbindender theologischer Perspektive und zugleich Gegensatz im Verständnis des Amtes und der episkopé bietet die Gewähr, dass das ökumenische Gespräch spannend wird und nicht im Austausch von diplomatischen Formeln erstarrt.
Die Reformierten und ihre Bewunderer verweisen gerne auf die Einsichten reformierter Sozial- und Wirtschaftsethik, auf das reformierte Engagement für die soziale Gerechtigkeit, auf die reformierte Eindeutigkeit in der Friedensfrage, wie sie etwa 1982 in der Erklärung des Moderamens des Reformierten Bundes zum Ausdruck kam, oder auf den processus confessionis gegen die globale Ungerechtigkeit für die Solidarität mit den Armen, in dem sich die Reformierten auf Weltebene sehen. Hier ließen sich mannigfache Zeugnisse reformierter Parteinahme und Empörung anführen. Der politischen Leisetreterei kann man die Reformierten jedenfalls nicht bezichtigen.
Die Theologie kommt nicht umhin, zwischen der Programmsprache politisch-theologischer Manifeste und der ihr aufgegebenen Theoriearbeit zu unterscheiden. Beim Umgang mit den Weltproblemen muss sie die Geste des Prophetischen mit einem guten Maß an Differenzierung und Rationalität verbinden und so auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Beispielhaft für einen solchen Theoriestil der reformierten Sozialethik war die Wirtschaftsethik von Arthur Rich.35 Sie hat mit ihren Kriterienbildungen, Aufstellungen, Modellen und Strategien des Abwägens und Urteilens die Diskussionen im Fach und deutlich darüber hinaus angeregt und wohltuend instruiert. Richs Wirtschaftsethik entstand in Zürich. Man darf ihr nachsagen, dass auch Huldrych Zwingli mit seiner auf konstruktive Zuordnungen angelegten Unterscheidung von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit zu den Paten dieses Werks gehört.
Der Titel meiner Darlegungen spielt mit dem Titel des 1972 entstandenen Films von Luis Buñuel Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Buñuels surrealer Spott über die Dekadenz der High Society und die von ihm boshaft in Seidenpapier verpackten Skandale und Skandälchen der Elite haben möglicherweise bei manchem die Erwartung ausgelöst, mit diesem Vortrag sollte nun ein Buñuelsches Drehbuch für die reformierte Theologie geschrieben werden. Diese Erwartung habe ich gewiss enttäuscht. Aber dass die reformierte Theologie nicht ohne einen gewissen Charme daherkommt und dass diesem Charme, sofern er nicht vordergründig und aufdringlich in Erscheinung tritt, das Merkmal des Diskreten zugeordnet werden kann, das wollte ich denn doch zum Ausdruck gebracht haben.
1Die Zahl der Reformierten bewegt sich in Deutschland nach Angaben des Reformierten Bundes in Deutschland bei 1,5 Millionen Gemeindegliedern.
2Siehe http://www.reformiert-info.de/124-0-56-3.html, abgerufen am 27.02.2017.
3PAUL T. NIMMO/DAVID A.S. FERGUSSON, The Cambridge Companion to Reformed Theology, Cambridge University Press 2016.
4OLIVER D. CRISP, Art. Jonathan Edwards, in: a.a.O. NIMMO FERGUSSON, 148–162.
5Vgl. hierzu und zum Folgenden: HEINRICH HEPPE, Die confessionelle Entwicklung der altprotestantischen Kirche Deutschlands, die altprotestantische Union und die gegenwärtige confessionelle Lage und Aufgabe des deutschen Protestantismus, Marburg 1854, insbesondere 358–402.
6Vgl. GERHARD MAY (Hrsg.), Das Marburger Religionsgespräch 1529 (= Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 13), Gütersloh 1970.
7Vgl. dazu MATTHIAS FREUDENBERG, Reformierte Theologie. Eine Einführung, Neukirchen- Vluyn 2011, 14–16.
8Zu den Belegen vgl. THEODOR MAHLMANN, Art. Reformation, in: HWP 8, 416–427, 422. – Der Sache nach mag der Gedanke, dass die Kirche andauernder Reformation bedarf, älter sein. Das Aufkommen der bekannten Formel lässt sich erst für die Zeit nach dem 2. Weltkrieg beobachten: Wilhelm Schneemelcher und Karl Gerhard Steck hätten sie 1952 »geschaffen«, und Karl Barth habe sie dann 1953 übernommen (so MAHLMANN, ebd.; vgl. auch GOTTFRIED SEEBAß, Art. Reformation, in: TRE 28, 386–404, 393).
9So die Confessio Gallicana (1559/1571), Artikel 30: »Nous croyons tous vrais pasteurs, en quelque lieu qu’ilz soyent, avoir mesme authorité et esgale puissance soubs un seul chef, seul souverain et seul universel Evesque, Iésus Christ. Et pour ceste cause, que nulle église ne doit prétendre aucune Domination ou Seigneurie sur l’autre« (Reformierte Bekenntnisschriften 2/1, 26,9–12. Deutsche Übersetzung im Text nach: HEINZ LANGHOFF [Hrsg.], Von Paris über Potsdam nach Leuenberg. Dokumente zum Werden und Weg der reformierten Gemeinden in der DDR, Berlin 1984, 19).
10JOHANNES CALVIN, Der Genfer Katechismus von 1545, in: Calvin-Studienausgabe 2, Göttingen 1996, 1–135, hier: 17.
11DIETRICH BONHOEFFER, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, CHRISTIAN GREMMELS/EBERHARD BETHGE/RENATE BETHGE (Hrsg.) in Zusammenarbeit mit ILSE TÖDT (DBW 8), München 1998, 559.
12Ebd.
13Vgl. KARL BARTH, Bemerkungen zum Betheler Bekenntnis (1933), in: DERS., Vorträge und kleinere Arbeiten 1930–1933, MICHAEL BEINTKER/MICHAEL HÜTTENHOFF/PETER ZOCHER (Hrsg.), Zürich 2013, 422–477, hier: 427f.
14KARL BARTH, Abschied (1933), in: DERS., Vorträge und kleinere Arbeiten 1930–1933 [s. Anm. 13], 492–515, hier: 510.
15Die Leuenberger Konkordie (= LK) wird unter Angabe der Paragraphenziffer zitiert nach der Ausgabe: Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie)/ Agreement between Reformation Churches in Europe (Leuenberg Agreement), im Auftrag des Rates der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, MICHAEL BÜNKER/MARTIN FRIEDRICH (Hrsg.), Leipzig 2013, 45–55.
16Bei den nachfolgenden Darlegungen greife ich auf Ausführungen zurück, die ich bereits an anderer Stelle vorgetragen habe (vgl. MICHAEL BEINTKER, Der Wandel der Denkformen und die Hermeneutik der reformatorischen Bekenntnisse, in: MICHAEL BEINTKER/MARTIN HEIMBUCHER [Hrsg.], Verbindende Theologie. Perspektiven der Leuenberger Konkordie, Neukirchen-Vluyn 2014 [= Evangelische Impulse 5], 145–170, hier: 160ff.).
17Vgl. JOHANNES CALVIN, Institutio christianae religionis, 1559, IV,15–16 sowie WILHELM H. NEUSER, Die Tauflehre des Heidelberger Katechismus (TEH NF 139), 1967. Vgl. auch MICHAEL BEINTKER, Art. Taufe IV. Dogmatisch, 3. Evangelisch, b) Reformiert, in: RGG4 8, 74–75.
18Vgl. GOTTFRIED ADAM, Der Streit um die Prädestination im ausgehenden 16. Jahrhundert. Eine Untersuchung zu den Entwürfen von Samuel Huber und Aegidius Hunnius (BGLRK 30), Neukirchen-Vluyn 1970. Vgl. auch THEODOR MAHLMANN, Art. Prädestination, V. Reformation bis Neuzeit, in: TRE 27, 118–156, hier: 123–134.
19Vgl. Bekenntnisschriften der reformierten Kirche (=BSRK), 846–861.
20KARL BARTH, Die Kirchliche Dogmatik II/2, Zollikon-Zürich 1942, 1.
21So heißt es bei Barth: »in der Erwählung Jesu Christi, die der ewige Wille Gottes ist, hat Gott dem Menschen das Erste, die Erwählung, die Seligkeit und das Leben, sich selber aber das Zweite, die Verwerfung, die Verdammnis und den Tod zugedacht« (a.a.O., 177 [im Original teilweise hervorgehoben]). – Zu Barths Erwählungslehre vgl. HINRICH STOEVESANDT, Karl Barths Erwählungslehre als Exempel der »christologischen Konzentration« (in: MICHAEL BEINTKER [Hrsg.], Gottes freie Gnade. Studien zur Lehre von der Erwählung, Wuppertal 2004, 93–117).
22Eine Übersicht über die Entwicklungen im lutherisch-reformierten Abendmahlsgespräch von der altpreußischen Bekenntnissynode in Halle (1937) über die Arnoldshainer Abendmahlsthesen (1957/62) bis zur Leuenberger Konkordie einschließlich der wichtigsten Quellenauszüge bietet ECKHARDT LESSING, Abendmahl (BenshH 72), Göttingen 1993.
23HELMUT GOLLWITZER, Bericht über die von der Abendmahlskommission erarbeitete Erklärung, in: Zur Lehre vom heiligen Abendmahl. Bericht über das Abendmahlsgespräch der Evangelischen Kirche in Deutschland 1947–1957 und Erläuterungen seines Ergebnisses, München 1958, 19–34, hier: 28.
24Heidelberger Katechismus, Frage 47 (BSRK, 695, 2f.).
25JÜRGEN MOLTMANN, Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie, München 1964 (131997).
26JÜRGEN MOLTMANN, Gott in der Schöpfung. Ökologische Schöpfungslehre, München 1985 (52002).
27Barth hat stets daran gezweifelt, dass man in der Theologie einfach »von schon erarbeiteten Resultaten, von schon gesicherten Ergebnissen herkommen« könne (KARL BARTH, Einführung in die evangelische Theologie, Zürich 1962, 169). Eher sei man darauf angewiesen, »jeden Tag, ja zu jeder Stunde neu mit dem Anfang anzufangen« [ebd.]).
28JÜRGEN MOLTMANN, Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, Gütersloh 1995, 14.
29Ebd.
30MICHAEL WELKER/DAVID WILLIS, Zur Zukunft der Reformierten Theologie, in: DIES. (Hrsg.), Zur Zukunft der Reformierten Theologie. Aufgaben – Themen – Traditionen, Neukirchen-Vluyn 1998, 9–16, hier: 10.
31Ebd.
32Vgl. HANS KÜNG, Rechtfertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Mit einem Geleitwort von Karl Barth, Freiburg i. Br. 41957.
33Vgl. EBERHARD JÜNGEL, Das Evangelium von der Rechtfertigung des Gottlosen als Zentrum des christlichen Glaubens, Tübingen (1998) 52006, 15–26.
34Die dritte These der Barmer Theologischen Erklärung lautet: »Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern, in der Jesus Christus in Wort und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. Sie hat mit ihrem Glauben wie mit ihrem Gehorsam, mit ihrer Botschaft wie mit ihrer Ordnung mitten in der Welt der Sünde als die Kirche der begnadigten Sünder zu bezeugen, dass sie allein sein Eigentum ist, allein von seinem Trost und von seiner Weisung in Erwartung seiner Erscheinung lebt und leben möchte.« (Die Barmer Theologische Erklärung. Einführung und Dokumentation, MARTIN HEIMBUCHER/RUDOLF WETH [Hrsg.], Neukirchen-Vluyn 2009, 39).
35Vgl. ARTHUR RICH, Wirtschaftsethik, Grundlagen in theologischer Perspektive, Gütersloh 1984; DERS., Wirtschaftsethik, Marktwirtschaft, Planwirtschaft, Weltwirtschaft aus sozialethischer Sicht, Gütersloh 1990.