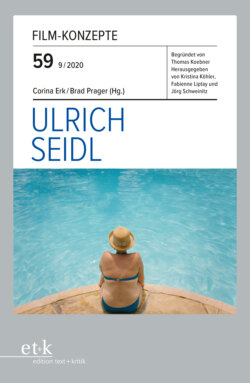Читать книгу FILM-KONZEPTE 59 - Ulrich Seidl - Группа авторов - Страница 8
III. Das scheinbar Dokumentarische und die Sozialkritik
ОглавлениеObschon Seidl sich selbst nicht als Dokumentarfilmer sieht, haben seine doku-fiktionalen Filme doch einen erheblichen Anteil an dokumentarischen Elementen und zeugen von einer gewissen Nähe zum direct cinema bzw. cinéma vérité.42 Denkbar weit entfernt vom classical cinema und unter Verzicht auf die Handlung vorantreibende plot points, erinnern Seidls Filme an Doku-Dramen, die sich einer gängigen Klassifizierung verweigern, wie sie etwa Bill Nichols in seiner weithin bekannten Studie zum Dokumentarfilm mit der Unterscheidung sechs verschiedener Modi des Dokumentarischen (poetic, expository, observational, participatory, reflexive, performative)43 vorgenommen hat. In Seidls Filmen ist keiner dieser Modi in Reinform realisiert. Vielmehr pflegt der Regisseur alle zugleich in verschieden gewichteten Mischformen, wenngleich, das ist allen Seidl-Filmen zu eigen, eine die Bilder kommentierende Stimme aus dem Off nie zu Gehör kommt. Seine Form des Dokumentarfilms wird daher als »Doku-Fiktions-Hybride«,44 als »präzise inszenierte(r) Ultrarealismus«45 bezeichnet. Seidls Ansatz ist der einer durchaus eigenständigen Verbindung von Fakten und Fiktionen, firmierend unter dem Schlagwort »Faction«.46 Weder direct cinema noch cinéma vérité lassen sich als Termini auf Seidls Filmwerk anwenden. Vielmehr gehört der Regisseur Seidl »einer Generation von Filmemachern an, die den Dokumentarfilm vom Dogma der faktographischen Repräsentation der Wirklichkeit befreien. Das Dokumentarische wird jetzt um fiktionale Formen erweitert; ›inszenierte Wirklichkeit‹ ist der Terminus dafür.«47
Über seine Hybride aus dokumentarischem und fiktionalem Film sagt Seidl selbst Folgendes: »Ich denke, meine Filme sind sehr artifiziell, weil sie durch meine Bildsprache stark geprägt sind. Ich nehme die Dinge, die passieren, also die Wirklichkeit, auf und bringe sie in einen Rahmen. Gleichzeitig versuche ich als Regisseur auch, die Dinge in Bewegung zu halten. Ich provoziere oder animiere die Darsteller, damit etwas vor der Kamera passiert, das nicht von vornherein festgelegt wurde.«48 Insofern interessiere es ihn nicht, »nur die Realität abzubilden, obwohl ich großen Wert auf Wirklichkeitsnähe und Authentizität lege. (…) Ich bin immer von zwei Richtungen ausgegangen: Das eine ist die Wirklichkeit, das andere die Künstlichkeit, eine Bildsprache, die ich für mich entwickelt habe, die etwas Unverwechselbares ist, die künstlich ist und trotzdem Authentizität hat.«49 Ohnehin ist es ein Irrglaube, man könne in und mit Dokumentarfilmen die Wirklichkeit 1:1 abbilden. Denn natürlich wird auch im Dokumentarfilm erzählt, es wird ausgewählt, gestaltet und interpretiert.
In seinen Filmen setzt Seidl häufig auf ein inszeniertes Laien-Schauspiel, wobei die Darsteller sich selbst in ihrer Rolle spielen. Aufwendige Castings gehen seinen Filmprojekten voraus; so wurden etwa für IMPORT EXPORT 1.500 Personen gecastet.50 Seidl pflegt dabei eine fordernde, die Grenzen der Darsteller auslotende Arbeitsweise, zwar in immer ähnlich zusammengesetzten Teams, aber durchaus autokratisch agierend.51 Ferner verzichtet der Regisseur auf ein fixiertes Drehbuch; bei seinem Vorgehen handelt es sich um experimentelles Filmemachen ohne vorher festgelegte Dialoge. Mal wird episodisch erzählt, mal linear, wie bei den Filmen der jeweils von einem Handlungsstrang dominierten PARADIES-Trilogie, während man gerade im dokumentarischeren Frühwerk vor allem »seriellen Montagen«52 begegnet. Vorab werden bei Seidl lediglich Szenenentwürfe fixiert, ansonsten setzt der Regisseur, der ausschließlich mit Atmo und diegetischer Musik arbeitet, auf das Improvisieren seiner Darsteller,53 perfektioniert zum Beispiel von der Schauspielerin Maria Hofstätter oder dem Laiendarsteller René Rupnik. Diese Selbstinszenierung der Protagonisten wirkt wiederum entlarvend, spielen die Darsteller doch ihr eigenes Leben. Seidl nutzt die Inszenierung, das Künstliche, um seine Sicht auf die Wirklichkeit zu zeigen. Aufgrund seiner Arrangements des stilisierten Sozialrealismus wird er mitunter mit Rainer Werner Fassbinder verglichen,54 wobei Seidls Kino in den stark überzeichneten Momenten geradezu surreal wirkt. Zugleich legt der Regisseur mit seiner Mischung aus Fakten und Fiktion, seiner offensiven Art und Weise, Filme zu machen, seine eigene Form politisch engagierten Kinos vor, ohne dabei Agitprop zu produzieren, der zum Handeln aufrufen würde. Stattdessen liefert Seidl Charakter- und Milieustudien, in denen er sowohl dokumentarisch arbeitet als auch einen deutlichen Stilwillen offenbart. Diese inszenatorischen Momente stehen dabei stets im Dienst von Seidls Aussageabsicht, so dass man seine Filme quasi als inszeniertes cinéma vérité titulieren könnte.
Sozial- und Milieustudie in GOOD NEWS
Die Kritik an den sozialen Missständen der bürgerlichen Gesellschaft steht im Mittelpunkt von Seidls Filmwerk, etwa die ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse wie in GOOD NEWS. Allerdings bildet Seidl diese Zustände lediglich ab, ohne sie aus dem Off oder in Interviews im Schuss-Gegenschuss-Verfahren zu kommentieren. Insofern geht es ihm vor allem um ein Aufzeigen des Status Quo, weniger um die revolutionäre Geste. Seidl fordert durch seine Methode der gezielten Provokation das Publikum dazu auf, sich zum Gezeigten zu positionieren und die eigene gesellschaftspolitische Haltung zu hinterfragen; dazu Seidl: »Ich möchte keine Filme machen, wo man sich als Zuschauer nicht selber sieht, wo man denkt, das ist ganz interessant, hat aber nichts mit meinem Leben zu tun. Sondern ich versuche Filme zu machen, bei denen sich der Zuschauer schämt, dass er auch zu dieser Welt gehört. Oder, positiv gesagt: Dass er seine Verantwortung sieht. Das ist ein produktiver Prozess, zwar unangenehm, aber er führt zur Erkenntnis.«55
Trist und trostlos wirkt der Alltag der Menschen am Rand der Gesellschaft im Seidl’schen Filmwerk, das letztlich stets Menschen in Systemen respektive Systemzwängen zeigt und Skizzen von Machtverhältnissen liefert, vergleichbar mit Michel Foucaults Überwachungsapparat im Panoptikum,56 sei es vom früheren MODELS über PARADIES: LIEBE bis hin zu SAFARI. Wenn Seidl das Grauen des Alltags, das harsche Leben mit dem Existenzialismus als philosophischem Hintergrund jedoch derart überzeichnet in Szene setzt, dann schimmert hinter diesem scheinbar allzu Normalen doch auch immer das Komische durch. Komik erwächst bei Seidls Filmen aus der Ernsthaftigkeit, mit der das Skurrile dargestellt wird.57 Seidl dazu: »Mir war immer wichtig, dass meine Filme auch Humor haben – noch besser ist es, wenn die Menschen lachen können und es ihnen im nächsten Moment kalt über den Rücken läuft: Ich will Schnittstellen finden zwischen Tragödie und Komödie.«58 Dem attestierten pessimistischen Ton und Zynismus seiner Filme tritt Seidl daher entgegen: »Meine Filme werden ja oft als pessimistisch bezeichnet, und damit meint man etwas Negatives. Für mich ist allerdings der Pessimist nicht zwangsläufig negativ, und der Optimist auch nicht bloß positiv. Im Gegenteil: Der Pessimist hat ja auch immer das Schöne vor Augen. Aber wenn ich mir die Welt so ansehe, muss ich mich schon fragen, warum ich Optimist sein sollte. Wenn man ein offenes Auge hat, kommt man an diesem Problem nicht vorbei.«59 Insgesamt lässt sich bei Seidls Filmen also nur von einer scheinbar nicht wertenden Neutralität sprechen, evoziert sein Werk aufgrund der genannten obsessiven Stilistik doch durchaus Wertungen.
All Eyes on Sex in IMPORT EXPORT?
Als obsessiv mag auch Seidls Fixierung auf das Thema Sexualität bezeichnet werden, das er immer wieder in Form expliziter Darstellungen ins Filmbild rückt. Exhibitionismus ist ein im Grunde durchgängiges Motiv in all seinen Filmen, sei es in BUSENFREUND mit dem Brust-Fetischisten René Rupnik, sei es in TIERISCHE LIEBE und der darin gezeigten Ausbeutung der Tiere durch die Menschen, sei es in dem den Sextourismus sowie die Vereinzelung des Menschen in den Blick nehmenden Film PARADIES: LIEBE sowie in IM KELLER mit der direkten Darstellung von Sadomaso-Szenen. Sexualität mag auch deswegen zu Seidls Kernthemen zählen, da seine Art des Filmemachens, die stets eine dokumentarische Komponente enthält, mit der Dokumentation realer Körper korreliert, die wiederum nie absolut fiktiv sein kann. So scheint es offensichtlich zu sein, dass Sex einen Filmemacher anzieht, der mit der Grenze zwischen Fiktion und Realität spielt. Zusammengefasst lauten die Seidl’schen Themen also: »Einsamkeit, Außenseiter, Prekariat; Tourismus, Triebleben und Religion; Liebespragmatismus, Narzissmus, Sadomasochismus; Dritte gegen Erste Welt, Menschen gegen Tiere, Ost gegen West und Land gegen Stadt; Prostitution, Spaßverordnungen und Stammtischmentalität.«60