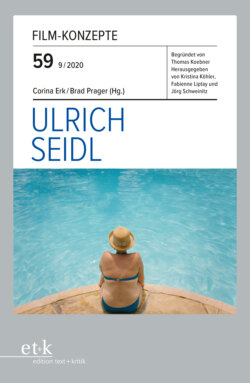Читать книгу FILM-KONZEPTE 59 - Ulrich Seidl - Группа авторов - Страница 9
IV. Kritik und Wertschätzung: Ulrich Seidl als auteur
ОглавлениеDie Methode Seidl spaltet das Publikum und brachte ihm seitens der Kritik immer wieder den Vorwurf der Ausbeutung der Dargestellten, das Eindringen in deren Privatsphäre, deren sie lächerlich machende Bloßstellung und der Sozialpornografie ein. Seidl selbst freilich verneint dies, er instrumentalisiere seine Protagonisten nicht: »Ich weiß natürlich, dass dies immer ein Punkt ist, der mir von einem Teil des Publikums vorgehalten wird, die mir vorwerfen, ich hätte das Gezeigte bewusst entstellt. Natürlich, ich spitze das Geschehen zu und unterstreiche es. Und durch die visuelle Reduktion wird es vielleicht noch pointierter oder klarer – aber grundsätzlich falsch wird es dadurch nicht.«61 Die Diskussion um sein Filmwerk entzündet sich vor allem an der Frage, ob das noch Wahrheitssuche sei oder schon Inszenierungsfetischismus. Geradezu milde bezeichnet Stefan Grissemann Seidl als »moralische(n) Filmemacher«,62 während es an anderer Stelle über ihn heißt, er sei »ein Moralist, ein bisschen vom Schlage eines Michel Houellebecq«.63 Die Reaktionen des Publikums reichen von Befremden über das Gezeigte bis hin zur Faszination des Ekels. Wieder andere schätzen das Radikale, das forsche(nde) Prinzip Seidls. Der als Regisseur menschlicher Abgründe bezeichnete Filmemacher, der von sich selbst den vielzitierten Satz »Ich bin kein Hochzeitsfotograf«64 sagt und dem es darum geht, wie er selbst zum Ausdruck bringt, »den Zuschauer zu berühren«,65 konfrontiert das Publikum mit den Grenzen der bürgerlichen Moralvorstellungen und fordert Positionierung ein.
Bei allen Diskussionen um Seidls Schaffen wird man eines mit Sicherheit festhalten können: Der Regisseur pflegt einen eigenen Stil, hat eine unverwechselbare Handschrift, anhand derer seine Filme wiedererkannt werden, und zwar »an den präzisen Bildkompositionen, seinen verstörenden Charakteren, einem zwischen Dokumentarismus und Fiktion strategisch unaufgelösten Naturalismus und nicht zuletzt auch an seinen Sujets. Seidls Generalthemen (Sexualität, Religion, Eifersucht, Machtfragen, Kolonialdenken, Konsumterror, Lebensunfähigkeit) werden im schwarzen Herz seines Kinos gebündelt, in seinem Überthema konzentriert: der Gottverlassenheit.«66 All dies erlaubt es, von Seidl als auteur zu sprechen, der ein konkretes Konzept hinter seiner Kunst verfolgt. Offen muss dabei letztlich bleiben, ob Seidl mit seiner Kritik an gesellschaftlichen Zuständen durch die Visualisierung eben jener Verhältnisse diese nicht auch affirmierend tradiert.
1 Stefan Grissemann, Sündenfall. Die Grenzüberschreitungen des Filmemachers Ulrich Seidl, Wien 2013, S. 14. — 2 Für Analysen von Seidls Werk bis zum Film JESUS, DU WEISST vgl. Florian Lamp, »Die Wirklichkeit, nur stilisiert«. Die Filme des Ulrich Seidl, Darmstadt 2009. Eine Untersuchung bis zur PARADIES-Trilogie liefert Grissemann, Sündenfall (s. Anm. 1). Analysen von GOOD NEWS (1990), MIT VERLUST IST ZU RECHNEN (1992) und IMPORT EXPORT (2007) liegen vor in Martin Brady und Helen Hughes, »Import and Export. Ulrich Seidl’s Indiscreet Anthropology of Migration«, in: New Austrian Film, hg. von Robert von Dassanowsky und Oliver C. Speck, New York 2011, S. 207–224. — 3 Lamp, »Die Wirklichkeit, nur stilisiert« (s. Anm. 2), S. 32. — 4 Für eine Detailanalyse des Films vgl. ebd., S. 35–65. — 5 Zit. n. Ulrich Weinzierl, »Von Kolporteuren und anderen Wienern. Ein entlarvender Dokumentarfilm. GOOD NEWS des Österreichers Ulrich Seidl«, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.3.1991, o. S. — 6 Zit. n. Birgit Schmid, »Forscher am Lebendigen. Porträt von Ulrich Seidl«, in: Filmbulletin (2003), H. 2, S. 46–55, hier S. 55. — 7 Anke Leweke, »Zungenkuss mit Hund«, in: Die Zeit, 2.6.2010, S. 49. — 8 Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 47. — 9 Zit. n. ebd., S. 48. — 10 Zit. n. Max Fellmann und Wolfgang Luef, »›Der Mensch will belogen werden‹«, in: SZ Magazin, 16.2.2015, S. 20–24, hier S. 24. — 11 Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 48. — 12 Josef Bierbichler, »›Er und der Valentin nehmen die Katastrophe Leben halt ernst‹«, in: Abendzeitung München, 23./24.3.2013, S. 23. — 13 Zum Weltbild in Seidls Filmen vgl. auch Matthias Frey, »The Possibility of Desire in a Conformist World. The Cinema of Ulrich Seidl«, in: New Austrian Film, hg. von Robert von Dassanowsky und Oliver C. Speck, New York 2011, S. 189–198. — 14 Vgl. hierzu den Beitrag von Sandra Kristin Knocke im vorliegenden Heft. — 15 Auch in PARADIES: GLAUBE hat Rupnik einen Kurzauftritt. — 16 Vgl. Michel Foucault, »Von anderen Räumen« (1967), in: Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, hg. von Jörg Dünne und Stephan Günzel, Frankfurt am Main 2018, S. 317–329. — 17 Vgl. hierzu den Beitrag von Jörn Glasenapp im vorliegenden Heft. — 18 Vgl. Marc Augé, Nicht-Orte, München 2014. — 19 Vgl. hierzu Justin Vicari, »DOG DAYS (HUNDSTAGE)«, in: Film Quarterly, Jg. 60 (2006), H. 1, S. 40–45, hier S. 40. Vgl. zum Film überdies Justin Vicari, »DOG DAYS. Ulrich Seidl’s Fin-de-siècle Vision«, in: New Austrian Film, hg. von Robert von Dassanowsky und Oliver C. Speck, New York 2011, S. 199–206. — 20 Vgl. Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 50. — 21 Vgl. hierzu den Beitrag von Fatima Naqvi im vorliegenden Heft. — 22 Vgl. Rüdiger Suchsland, »Ulrich Seidl über seine gemischte Arbeitsweise, über Religionskritik, die fortdauernde Autorität der Kirche und warum die Franzosen seine Filme nicht mögen«, in: artechock, 28.3.2013, https://www.artechock.de/film/text/interview/s/seidl_2013_2.html (letzter Zugriff am 29.4.2020), o. S. — 23 Vgl. zum Film IMPORT EXPORT, der von verschiedenen Seiten wissenschaftlich untersucht wurde, Helga Druxes, »Female Body Traffic in Ulrich Seidl’s IMPORT/EXPORT and Ursula Biemann’s REMOTE SENSING AND EUROPLEX«, in: Seminar, Jg. 47. (2011), H. 4, S. 499–519; Michael Goddard, »Eastern Extreme. The Presentation of Eastern Europe as a Site of Monstrosity in LA VIE NOUVELLE and IMPORT/EXPORT«, in: The New Extremism in Cinema. From France to Europe, hg. von Tanya Horeck und Tina Kendall, Edinburgh 2013, S. 82–92; Anca Parculescu, »IMPORT/EXPORT: Housework in an International Frame«, in: PMLA, Jg. 127 (2012), H. 4, S. 845–862; Nikhil Sathe, »Challenging the East-West Divide in Ulrich Seidl’s IMPORT EXPORT (2007)«, in: East, West and Centre. Reframing post-1989 European Cinema, hg. von Michael Gott und Todd Herzog, Edinburgh 2014, S. 65–78. — 24 Vgl. Stefan Grissemann, »Ordnungswidrige Weltdarstellungsweisen. Zu Ulrich Seidls alarmierenden Lebens- und Menschenbildern«, in: Kampfansage. Ulrich Seidls filmisches Werk, hg. von Stefan Grissemann, Wien 2017, S. 5–59, hier S. 21. — 25 Zit. n. ebd., S. 53. — 26 So heißt es im Paulusbrief: »Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Größte unter ihnen.« 1 Kor 13,13 EU. — 27 Vgl. hierzu den Beitrag von Brad Prager im vorliegenden Heft. — 28 Grissemann, »Ordnungswidrige Weltdarstellungsweisen« (s. Anm. 24), S. 5. — 29 Zum fotografischen Wesen der Filme Seidls vgl. Brad Prager, »Trophy Hunter. Ulrich Seidl’s Portraits and SAFARI«, in: New German Critique (2019), H. 138, S. 157–179 und Vicari, »DOG DAYS (HUNDSTAGE)« (s. Anm. 19), S. 40 sowie darüber hinaus den Beitrag von Jörn Glasenapp im vorliegenden Heft. — 30 Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 46. — 31 Vgl. Jacques Lacan, »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion, wie sie uns in der psychoanalytischen Erfahrung erscheint« (1948), in: Ders., Schriften I. Quadriga, Weinheim/Berlin 1986, S. 61–70. — 32 Vgl. zum Konnex von Fotografie und Voyeurismus insbesondere Susan Sontag, On Photography, New York 1977 sowie Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, New York 2003. — 33 Grissemann, »Ordnungswidrige Weltdarstellungsweisen« (s. Anm. 24), S. 19. — 34 Ebd. — 35 Marc Vetter, »Ulrich Seidl: Erforscher gesellschaftlicher Sumpfgebiete«, in: Rolling Stone, 27.4.2018, https://www.rollingstone.de/ulrich-seidl-erforscher-gesellschaftlicher-sumpfgebiete-1491059/ (letzter Zugriff am 29.4.2020), o. S. — 36 Rüdiger Suchsland, »Perverse Heilige im Dschungelcamp der gebildeten Stände«, in: artechock, o. A., https://www.artechock.de/film/text/kritik/p/paglau.htm (letzter Zugriff am 29.4.2020), o. S. — 37 Rüdiger Suchsland, »Rassismus für die Gebildeten unter seinen Verächtern«, in: heise online, 3.1.2013, https://heise.de/-3397091 (letzter Zugriff am 29.4.2020), o. S. — 38 Ebd. — 39 Ebd. — 40 Vgl. Catherine Wheatley, »Europa Europa«, in: Sight & Sound, Jg. 18 (2008), H. 10, S. 46–49, hier S. 46. — 41 Bierbichler, »›Er und der Valentin nehmen die Katastrophe Leben halt ernst‹« (s. Anm. 12), S. 23. — 42 Vgl. zu diesem Thema auch Anna Granatowska, »Between Documentary and Fiction. Authenticity and Voyeurism in the Cinema of Ulrich Seidl«, in: Images, Jg. 15 (2014), H. 24, S. 61–69; Florian Mundhenke, »Authenticity vs. Artifice. The Hybrid Cinematic Approach of Ulrich Seidl«, in: Austrian Studies, Jg. 19 (2011), S. 113–125; Catherine Wheatley, »Naked Women, Slaughtered Animals. Ulrich Seidl and the Limits of the Real«, in: The New Extremism in Cinema. From France to Europe, hg. von Tanya Horeck und Tina Kendall, Edinburgh 2013, S. 93–101. — 43 Vgl. Bill Nichols, Introduction to Documentary, Bloomington 2017. Vgl. zum Dokumentarfilm überdies Klaus Arriens, Wahrheit und Wirklichkeit im Film. Philosophie des Dokumentarfilms, Würzburg 1999; Manfred Hattendorf, Dokumentarfilm und Authentizität. Ästhetik und Pragmatik einer Gattung, Konstanz 1999; Kay Hoffmann (Hg.), Spiel mit der Wirklichkeit. Zur Entwicklung doku-fiktionaler Formate in Film und Fernsehen, Konstanz 2012; Kay Hoffmann (Hg.), Trau-schau-wem. Digitalisierung und dokumentarische Form, Konstanz 1997; Eva Hohenberger (Hg.), Texte zur Theorie des Dokumentarfilms, Berlin 2012; Thorolf Lipp, Spielarten des Dokumentarischen. Einführung in Geschichte und Theorie des nonfiktionalen Films, Marburg 2012; Thomas Schadt, Das Gefühl des Augenblicks. Zur Dramaturgie des Dokumentarfilms, Konstanz 2017; Dave Saunders, Documentary, London 2010. — 44 Grissemann, »Ordnungswidrige Weltdarstellungsweisen« (s. Anm. 24), S. 9. — 45 Ebd., S. 39. — 46 Vgl. hierzu Lamp, »Die Wirklichkeit, nur stilisiert« (s. Anm. 2), S. 23–27. — 47 Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 48. — 48 Zit. n. Grissemann, Sündenfall (s. Anm. 1), S. 27. — 49 Zit. n. ebd., S. 27 f. — 50 Vgl. Rüdiger Suchsland, »›Ich versuche, Bilder zu machen, die man noch nie gesehen hat‹. Ausbeutung, Lachen, Filme: Regisseur Ulrich Seidl unplugged«, in: artechock, 18.10.2007, https://www.artechock.de/film/text/interview/s/seidl_2007.htm (letzter Zugriff am 29.4.2020), o. S. — 51 Vgl. o. V., »Kontroverse und Mitgefühl. Was es bedeutet, mit Ulrich Seidl zu arbeiten: Erlebnisberichte von Komplizen und Mitstreiterinnen«, in: Kampfansage. Ulrich Seidls filmisches Werk, hg. von Stefan Grissemann, Wien 2017, S. 87–153. — 52 Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 49. — 53 Vgl. Grissemann, »Ordnungswidrige Weltdarstellungsweisen« (s. Anm. 24), S. 27. — 54 Vgl. o. V., »›Ein bisschen locker muss die Schraube schon sitzen‹. US-Regisseur John Waters spricht mit Stefan Grissemann über Seidls gnadenloses Kino, heitere Grenzüberschreitungen und die Legitimität der Blasphemie«, in: Kampfansage. Ulrich Seidls filmisches Werk, hg. von Stefan Grissemann, Wien 2017, S. 63–83, hier S. 73. — 55 Zit. n. Tobias Graden, »›Mir geht es um die Würde des Menschen‹«, in: Bieler Tagblatt, 21.1.2017, S. 2–3, hier S. 2. — 56 Vgl. hierzu Michel Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses (1975), Frankfurt am Main 2016. — 57 Zur Komik-Theorie Henri Bergsons, aufgrund derer sich das Lachen als Folge der Abweichung von gewünschtem Verhalten in Eintracht mit Sozialnormen erweist, vgl. Henri Bergson, Das Lachen. Ein Essai über die Bedeutung des Komischen (1900), Hamburg 2011. — 58 Zit. n. Grissemann, Sündenfall (s. Anm. 1), S. 20. — 59 Zit. n. ebd. — 60 Grissemann, »Ordnungswidrige Weltdarstellungsweisen« (s. Anm. 24), S. 51. — 61 Zit. n. ebd. — 62 Ebd., S. 11. — 63 Schmid, »Forscher am Lebendigen« (s. Anm. 6), S. 49. — 64 Zit. n. Constantin Wulff, »Eine Welt ohne Mitleid. Constantin Wulff über Ulrich Seidl«, in: Gegenschuss. 16 Regisseure aus Österreich, hg. von Peter Illetschko, Wien 1995, S. 240–255, hier S. 245. — 65 Zit. n. Grissemann, Sündenfall (s. Anm. 1), S. 22. — 66 Ebd., S. 8 f.