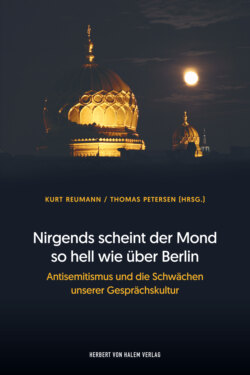Читать книгу Nirgends scheint der Mond so hell wie über Berlin - Группа авторов - Страница 8
THOMAS PETERSEN Wie antisemitisch ist Deutschland?
ОглавлениеEin neuer Antisemitismus?
Als am 9. Oktober 2019 ein Attentäter versuchte, in die Synagoge von Halle an der Saale einzudringen, um die dort zum Jom-Kippur-Gottesdienst versammelten Menschen zu ermorden, und, nachdem ihm dies nicht gelungen war, zwei Passanten auf der Straße erschoss, löste dies nicht nur Empörung und Entsetzen in Deutschland aus, sondern auch eine intensive öffentliche Diskussion um die Frage, ob der Antisemitismus in Deutschland zunimmt und ob man sich als Jude im Land noch sicher fühlen kann.1
Tatsächlich war der Anschlag von Halle zwar der mit Abstand schwerste, aber bei Weitem nicht der einzige antisemitische Vorfall in Deutschland in den letzten Jahren. Im April 2018 ging der israelische Student Adam Armoush, der aus einer arabischen Familie stammt, mit einer Kippa in Berlin spazieren. Die Kippa hatte ihm ein jüdischer Freund geschenkt mit dem Hinweis, er solle damit nicht auf die Straße gehen, denn das könne gefährlich sein. Armoush wollte das nicht glauben und das Gegenteil beweisen. Er irrte sich. In seinem eigenen Wohnviertel, dem vermeintlich so toleranten Prenzlauer Berg, kamen ihm junge Männer entgegen und beschimpften ihn als »Hurensohn«.2 Eine Videoaufnahme, die sich rasch im Internet verbreitete, zeigt, wie ein Mann unter ›Jehudi‹ (arabisch für ›Jude‹)-Rufen mit einem Gürtel auf ihn eindrischt.3
Dieser Vorfall machte die Öffentlichkeit darauf aufmerksam, welchen Anfeindungen Juden in Deutschland heute ausgesetzt sein können. Die Zahl solcher Ereignisse ist nicht gering: Im Dezember 2017 war der israelische Restaurant-Besitzer Yorai Feinberg in Berlin-Schöneberg auf der Straße minutenlang beschimpft worden.4 Schulen berichteten über Übergriffe auf jüdische Schüler, oft von Mitschülern arabischer Herkunft.5 Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Josef Schuster riet davon ab, in deutschen Großstädten die Kippa zu tragen.6 Allgemein scheint angesichts solcher Vorkommnisse der Eindruck vorzuherrschen, dass die Zahl der Übergriffe zunimmt. Die Zahlen des Bundesinnenministeriums sind in dieser Hinsicht allerdings nicht eindeutig: Im Jahr 2018 gab es in Deutschland 69 antisemitische Gewalttaten, davon 49 rechtsextremistisch motivierte. Das war im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren eine außergewöhnlich große Zahl, in den Vorjahren schwankten die Werte meist zwischen 30 und 40 mit insgesamt eher leicht abnehmender Tendenz, so dass sich noch nicht sagen lässt, ob die Zahl von 2018 eine Trendwende markiert oder nicht.7
Wichtiger als die Zahl der Gewalttaten – zumindest solange diese absolut betrachtet noch klein ist – ist aber das gesamtgesellschaftliche Klima, das, wenn es von einem zunehmenden Antisemitismus oder auch nur von einer wachsenden Akzeptanz antisemitischer Positionen gekennzeichnet wäre, judenfeindlichen Extremisten Schutz und scheinbare Rechtfertigungen für ihre Taten bieten und damit in Zukunft ein Sinken der Hemmschwelle und als Folge eine tatsächlich wachsende Gefährdung der jüdischen Bürger nach sich ziehen würde. So entstand aus gutem Grund unter dem Eindruck des Vorfalls von Prenzlauer Berg eine Debatte darüber, ob Deutschland mit der Zuwanderung Hunderttausender Menschen aus muslimischen Ländern ein wachsendes Problem mit ›importiertem‹ Antisemitismus bekomme.8 Gleichzeitig fehlte es aber auch nicht an Warnungen, wonach es unredlich sei, zu versuchen, das Problem den Einwanderern in die Schuhe zu schieben: Der Judenhass sei auch in der eingesessenen Bevölkerung nach wie vor weit verbreitet und nie überwunden worden.9
Der Nachhall des Dritten Reiches
Doch stimmt das? Eine aufschlussreiche Quelle sind hier die Repräsentativumfragen des Instituts für Demoskopie Allensbach, das seit seiner Gründung im Jahr 1947 praktisch von Anfang an auch den Nachklang der nationalsozialistischen Ideologie in der Gesellschaft einschließlich des mit ihr verbundenen Antisemitismus dokumentiert hat. Die erste Untersuchung zu diesem Thema stammt aus dem Frühjahr 1949.10 Diese und die nachfolgenden Umfragen aus den ersten Jahrzehnten nach Gründung der Bundesrepublik helfen, die derzeitige Lage einzuordnen. Sie bestätigen den Verdacht, dass der Antisemitismus in Deutschland nie verschwunden war, doch sie zeigen keine Hinweise darauf, dass er in der Gesellschaft als Ganzes in jüngerer Zeit zugenommen hätte, eher im Gegenteil.
Man kann annehmen, dass viele Menschen unter dem Eindruck der aktuellen antisemitischen Übergriffe dazu neigen, das Ausmaß des Antisemitismus in früheren Jahrzehnten zu unterschätzen. Dabei kann es eigentlich nicht verwundern, dass, wie die frühen Umfragen des Allensbacher Instituts zeigen, die nationalsozialistische Ideologie in der Bevölkerung noch viele Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus weit verbreitet war. Der Zusammenbruch des Regimes konnte nicht zur Folge haben, dass mit ihm auch das vorher über Jahrzehnte hinweg erlernte und eingeübte Weltbild gleichsam über Nacht verschwand. So konnte es nicht überraschen, dass in der erwähnten ersten Umfrage zum Thema Nationalsozialismus aus dem Jahr 1949 auf die Frage »Halten Sie den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die schlecht ausgeführt wurde?« knapp 60 Prozent mit »Ja« antworteten.11 Und als das Institut im Jahr 1950 die Frage stellte: »Welcher große Deutsche hat Ihrer Ansicht nach am meisten für Deutschland geleistet?«, nannten immerhin noch zehn Prozent der Befragten spontan den Namen Hitler, der damit an zweiter Stelle der Rangliste stand, allerdings mit deutlichem Abstand hinter Bismarck (35%).12 1955 stimmte eine deutliche relative Mehrheit von 48 zu 36 Prozent der Aussage zu, ohne den Krieg wäre Hitler einer der größten deutschen Staatsmänner gewesen. 1978 war immerhin noch knapp jeder Dritte (31%) dieser Ansicht.13
Dieser Nachhall des Nationalsozialismus zeigte sich auch in den Einstellungen der Bürger gegenüber Juden. Im August 1949 wurde gefragt: »Was würden Sie als Ursache des Antisemitismus bezeichnen: die Eigenheiten jüdischer Volksgruppen, die jüdische Religion, die antijüdische Propaganda oder was sonst?« Eine klare Mehrheit von 53 Prozent der Befragten führte daraufhin den Antisemitismus auf die »Eigenheiten jüdischer Volksgruppen« zurück, vertrat also zugespitzt formuliert die Ansicht, die Juden seien an ihrer Verfolgung im Grunde selbst Schuld gewesen.14 Da war es nur folgerichtig, dass sich in derselben Umfrage gerade 54 Prozent der Befragten zu der Aussage durchringen konnten, dass Deutschland gegenüber den noch lebenden deutschen Juden eine Pflicht zur Wiedergutmachung habe. 31 Prozent widersprachen der These sogar ausdrücklich.15 Im Dezember 1952 vertraten 37 Prozent der Westdeutschen die These, es sei für Deutschland besser, keine Juden im Land zu haben,16 1960 sagte eine relative Mehrheit von 45 Prozent, sie wäre nicht damit einverstanden, wenn ein Jude Bundeskanzler werden sollte.17
Betrachtet man die Umfrageergebnisse aus den Gründerjahren der Bundesrepublik zusammengenommen, wird deutlich, dass radikaler Antisemitismus auch damals nur die Position einer Minderheit war, doch man kann vermuten, dass dies auch in Zeiten der Weimarer Republik und selbst während des Nationalsozialismus der Fall gewesen war. Es wird aber auch klar, dass es bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung, und zwar über das ganze politische Spektrum hinweg,18 eine Art vagen Antisemitismus gab, eine ganze Vielzahl von Vorurteilen gegenüber Juden, deren Wurzeln teilweise jahrhundertealt waren und die in der nationalsozialistischen Zeit bestärkt worden waren. So sagten beispielsweise noch 1960 immerhin 34 Prozent der vom Allensbacher Institut Befragten, an der Aussage »Die Juden sind oft Ausbeuter und leben von der Arbeit anderer«, sei »etwas Wahres dran«. Das gleiche meinten 30 Prozent zu der These »Wenn ein Jude etwas Gutes tut, dann tut er es meistens nur aus Berechnung.«19 Ein Jahr später sagten sogar 44 Prozent, es sei »etwas Wahres« an der Aussage: »Wo Juden das Geschäftsleben beherrschen, da kommt im Allgemeinen kein anderer mehr rein.«20 Bei weitem nicht jedem, der diesen Aussagen zustimmte, hätte man vorwerfen können, er sei allein deswegen als glühender Antisemit zu bezeichnen, doch man erkennt, wie weit noch Jahrzehnte nach dem Ende des Nationalsozialismus antijüdische Klischees verbreitet waren. Wenn es damals noch weniger Übergriffe gegenüber Juden gegeben haben sollte als heute (verlässliche Zahlen hierzu existieren nicht), dann nicht, weil es kein antisemitisches Potential in der Bevölkerung gegeben hätte, sondern vermutlich eher, weil die Zahl der Juden im Land und damit auch die Zahl der potenziellen Angriffsziele nach dem Massenmord durch die Nationalsozialisten äußerst klein war: Mitte der 1950er-Jahre lebten nach Angaben der Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland weniger als 20.000 Juden in der Bundesrepublik, ab den 1960er-Jahren etwas mehr als 20.000. Heute liegt die Zahl nach einem erheblichen Zuzug seit der deutschen Einheit, vor allem aus Osteuropa, immerhin wieder bei knapp 100.000.21
Die Entwicklung der letzten Jahre
Verglichen mit den 1950er- und 1960er-Jahren ist der Antisemitismus in Deutschland heute gering. Zwar halten sich einige traditionelle Klischees über ›die Juden‹ recht hartnäckig in der Bevölkerung. Doch echten Judenhass empfindet anscheinend nur eine kleine Minderheit. Und vor allem: Er ist in den letzten Jahrzehnten eher seltener geworden. Dies zeigen die Ergebnisse einer größeren Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach zu diesem Thema vom Juni 2018.22
Auf die direkte Frage »Ist Antisemitismus, also Judenfeindlichkeit, heute bei uns ein großes Problem, oder sind das aus Ihrer Sicht Ausnahmefälle?« antworteten in dieser Umfrage die Befragten eher wenig besorgt. 23 Prozent meinten, es handele sich um ein großes Problem, eine klare Mehrheit von 58 Prozent glaubte, bei den in den Medien berichteten Übergriffen handele es sich um Einzelfälle. Erinnerte man sie an den Vorfall vom Prenzlauer Berg, fielen die Antworten der Befragten allerdings deutlich skeptischer aus: Nur 27 Prozent sagten, das sei ein Einzelfall gewesen, während 44 Prozent glaubten, der Angriff auf den jungen Mann mit Kippa sei ein Zeichen für weit verbreiteten Antisemitismus unter Menschen mit arabischer Herkunft in Deutschland.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Deutschen sich einer Auseinandersetzung mit dem Massenmord an den Juden im Nationalsozialismus verweigerten. Auf die Frage »Glauben Sie, das meiste, was über Konzentrationslager und Judenverfolgung berichtet wird, ist wahr, oder ist da vieles übertrieben dargestellt worden?« antworteten in der Umfrage von 2018 81 Prozent, ihrer Ansicht nach seien die meisten dieser Berichte wahr, lediglich 6 Prozent widersprachen. Auch der These, man würde zu viel mit den Verbrechen der Nationalsozialisten konfrontiert, stimmt die Mehrheit nicht zu. Eine Frage lautete: »Wird heutzutage im Radio und Fernsehen eigentlich zu viel oder zu wenig über die Judenverfolgung im Nationalsozialismus berichtet?« Gerade 26 Prozent antworteten auf diese Frage, es werde zu viel darüber berichtet, im Februar 1995 waren es noch 36 Prozent gewesen.23 Die gleiche Tendenz zeigen die Antworten auf die Frage, ob man so lange nach Kriegsende nicht mehr so viel über die Nazi-Vergangenheit reden und besser einen Schlussstrich ziehen solle. 45 Prozent vertraten 2018 diese Ansicht, 21 Prozent weniger als im Jahr 1986 (Abb. 1).