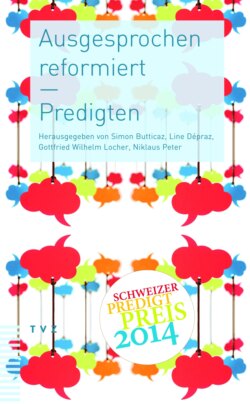Читать книгу Ausgesprochen reformiert - Группа авторов - Страница 5
Оглавление|9|
Gottfried Wilhelm Locher, Präsident des Rates, und Simon Butticaz, Projektleiter des «Predigtpreises»
Vorwort
Aus dem Französischen übersetzt von Monika Carruzzo
«Also kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber geschieht durch das Wort von Christus.» (Röm 10,17) In diesem Zitat des Apostels Paulus wird die besondere Berufung sichtbar, die mit dem Predigen verbunden ist. Die Verkündigung ist unglaublich wichtig für die Entstehung des Glaubens. So verstehen es zumindest die Kirchen der Reformation. Sie sage: Der Glaube entwickelt sich aus dem Hören (ex audito), und die Kirche wird durch das Wort geschaffen (creatura Verbi). Nach Martin Luther zeichnet sich der Christ dadurch aus, dass er Ohren hat («habere aures»)1!
Predigen, die lebendige Stimme des Evangeliums verkünden, ist demnach nicht optional, sondern im Gegenteil ein konstitutives Amt der gläubigen Gemeinde, ein zentrales Wesensmerkmal (eine nota ecclesiae). Denn ohne öffentliche Verkündigung des Gotteswortes stirbt der Glaube und die Kirche verschwindet. Daher hat das Predigtamt in den reformierten und lutherischen Kirchen einen unantastbaren Status erlangt. Wird diese Funktion an einen Pfarrer oder an eine Pfarrerin delegiert, so werden diese damit zu Dienern am göttlichen Wort – zu Verbi divini ministri, was zu V. D. M. abgekürzt in der deutschsprachigen Tradition dem Vornamen und Namen des Pfarrers oder der Pfarrerin angehängt wird.
Infolgedessen ist auch verständlich, dass es der französische Protestantismus kurz nach Widerrufung des Ediktes von Nantes (1685) für nötig befand, die besondere Aufgabe der Verkündigung Laienpredigern, die manchmal auch «Prädikanten» |10| genannt wurden, anzuvertrauen. Louis XIV. hatte die ekklesiologische Eigenart der Hugenotten nicht erkannt und geglaubt, die Kirche führungslos zu machen, als er ihre Pfarrer ins Exil schickte: Aber Kirche in der protestantischen Tradition basiert nicht auf einem institutionalisierten Klerus, sondern auf der getreuen Verkündigung des Wortes! Oder, wie es das Zweite Helvetische Bekenntnis in einer klassisch gewordenen Formulierung ausdrückt: «[…] wir lehren aber, jene sei die wahre Kirche, bei der die Zeichen oder Merkmale der wahren Kirche zu finden sind: vor allem die rechtmässige und reine Verkündigung des Wortes Gottes […]»2.
Dennoch, angesichts der heutigen Krise der historischen Kirchen gibt es viele Stimmen, welche die Kommunikation des Evangeliums in Frage stellen. Die Predigten seien zu intellektuell, zu lang, zu kompliziert, zu abstrakt, sie sollten ganz einfach ausrangiert werden. Die gewonnene Zeit und Energie solle man besser in die Gemeindearbeit investieren, in soziale Aktionen oder seelsorgerliche Begleitung. Dieser scharfe Angriff auf die Predigt überzeugt uns nicht, denn gerade Krisenzeiten erfordern aufbauende und ermutigende Worte. Die Geschichte des Christentums kennt unzählige Beispiele dafür, wie einige Worte ausreichen, um den Glauben eines Menschen zu wecken oder die Kirche wieder aufzurichten. So etwa die Jünger von Emmaus, die am Ostermorgen Christus zuhören und sich von seiner «Predigt» packen lassen (Lk 24,13–35), Martin Luther, der bei der Lektüre von Römer 1,17 sieht, wie sich die Tore des Paradieses öffnen, oder auch Karl Barth, der bei der Analyse des Römerbriefes das Wort Gottes als Antwort auf die homiletische Krise seiner Zeit wiederentdeckt.
Bei näherer Betrachtung dieser Porträtgalerie gelangt man zu der Überzeugung, dass die Predigt weder ein theologischer Diskurs noch eine moralische Lektion, sondern ein Sprach- bzw. Wortereignis ist, um mit der Terminologie von Ernst Fuchs und Gerhard Ebeling zu sprechen. Ein Ereignis, das gleichzeitig anredet und etwas bewirkt. Genauer gesagt: In und mit den Worten |11| des Predigers kann Gott selbst zu Worte kommen und den Menschen ansprechen. Folglich ist die Predigt für die Kirchen und die Gesellschaft eine Chance – heute vielleicht mehr denn je. Eine Gelegenheit, von dem zu sprechen, was uns leben, hoffen und lieben lässt, sich von Gott ansprechen und verwandeln zu lassen, um seinem Ruf in der Welt besser folgen zu können.
Diese Überzeugung liegt der vorliegenden Sammlung zugrunde. Das Buch, dessen Lektüre Sie sich vorgenommen haben, ist eine kleine, aus fünfzehn Predigten bestehende Anthologie. Sie ist entstanden im Rahmen des ersten «Schweizer Predigtpreises», der 2014 vom Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK) ausgeschrieben wurde. Es sind fünfzehn von zwei Jurys3 sorgfältig ausgewählte Predigten. Exegetische Festigkeit, rhetorische Stärke, theologische Konsistenz und existentielle Bedeutung zeichnen sie aus. Fünfzehn Predigten, die einen kleinen Einblick in die grossartige Vielfalt des Schweizer Protestantismus und seiner «Orte des Wortes» (Sonntags- oder Kasualgottesdienste, Gemeinden in Stadt und Land, Radiopredigten usw.) sowie seiner Akteure geben (Männer und Frauen, Pfarrer und Diakone, Theologinnen und Nichttheologen usw.). Wir hoffen, dass diese fünfzehn Predigten durch das Wirken des «inneren Lehrers»4, des Heiligen Geistes, zu einer Heilszusage für Sie werden.
1 WA 3,228,13ff.
2 Heinrich Bullinger, Das zweite Helvetische Bekenntnis. Confessio Helvetica Posterior, Zürich 1966, S. 82.
3 Jury für die deutschsprachigen und rätoromanischen Regionen: Niklaus Peter, Präsident; Ivana Bendik; Walo Deuber; Chatrina Gaudenz; Ralph Kunz; David Plüss. Jury für die Romandie und das Tessin: Line Dépraz, Präsidentin; Didier Halter; Simona Rauch; Kristin Rossier Buri; Paolo Tognina.
4 Johannes Calvin, Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Christianae Religionis, Neukirchen-Vluyn 20123, S. 291.
|12|