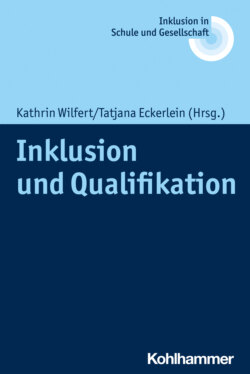Читать книгу Inklusion und Qualifikation - Группа авторов - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1 Eine Frühpädagogik der Vielfalt
ОглавлениеPädagogik der Vielfalt zeichnet sich dadurch aus, dass sie niemanden ausschließt (vgl. Prengel 2020). Das verbindet sie mit der Inklusiven Pädagogik bzw. international auch Diversity oder Inclusive Education. Diese Ausgangsbedingungen schließt auch die Frühpädagogik ein (vgl. Prengel 2019). Gemeinsam ist ihnen die Forderung: Bildung für alle vor dem Hintergrund der Menschenrechte. Die Anerkennungstheorie von Honneth ist dafür ein substantielles Element (vgl. ebd.). Sie steht in Bezug zum Konstrukt der egalitären Differenz. Danach werden Gleichheit und Differenz als sich wechselseitig bedingende Kategorien verstanden. Prengel schreibt dazu:
»Keine der beiden Dimensionen ist in diesem Zusammenhang verzichtbar, denn Gleichheit ohne Differenz würde undemokratische Gleichschaltung und Differenz ohne Gleichheit undemokratische Hierarchie hervorbringen« (Prengel 2001, S. 93).
Eine Frühpädagogik der Vielfalt hebt darauf ab, dass Teilhabe und Partizipation sich an den Aneignungsprozessen der jungen Kinder orientieren muss. Frühpädagogik agiert nicht jenseits von gesellschaftlichen Strukturen, auch hier spiegeln sich Ambivalenzen und Widersprüche einer pluralen Gesellschaft (vgl. Prengel 2014). Durch die Orientierung an inklusiven Theorien kann es gelingen, diese Ambiguitäten bewusst aufzugreifen, zu durchdringen und einzuordnen. Von Pauschalisierungen ist abzusehen, denn Heterogenität ist nicht generell eine Chance. Erfahrungen mit Leiden, Krankheit, Unterlegenheit, Beeinträchtigung darf nicht ignoriert werden (vgl. ebd.). Vorstellungen, Erzählungen, Werte und Haltungen, die die Fachkräfte teilen, sind ein wesentliches Fundament, um Bildungsteilhabe und Partizipation umzusetzen (vgl. Prengel 2016).
Mit der Expertise »Bildungsteilhabe und Partizipation in Kindertageseinrichtungen« leistet Prengel einen wichtigen Beitrag, um an die frühen Kommunikationsformen der Kinder anzuknüpfen. Hier wird herausgestellt, dass Sorge ein integrales Element von Generationenbeziehungen ist (vgl. Baader, Eßer & Schröer 2014). Die Einflüsse der Entwicklungspsychologie und der evolutionären Anthropologie stärken dieses Verständnis. Darüber hinaus wird deutlich, dass Kinder sich der Welt von Anfang an ordnend und verstehend nähern. Auch in der frühen Kindheit gilt daher, dass Entwicklung nicht einem genuinen Bauplan folgt, sondern dass sich Kinder hoch sensitiv ihrer sozialen Umwelt zuwenden. Das Verlangen nach Mitwirkung und Kooperation zeigt sich von Anfang an. Sowohl einseitige auf Fürsorge und Schutz ausgerichtete Bedingungen in den Einrichtungen als auch romantische Erziehungsvorstellungen – die in Kindern die kompetenten Akteurinnen und Akteure sehen, welche sich von selbst bilden (vgl. Baader 2004) – vernachlässigen die Bedeutung von Bildungsteilhabe und Partizipation. Denn erst diese führen dazu, dass Kinder nicht mehr nur an eine bestimmte soziale Gruppe (Familie u. a.) gebunden sind, sondern die Grenzen der sozialen Herkunft überschreiten können (vgl. Oelkers 2009). Dewey hat bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts danach gefragt, welche Bedingungen die Erziehung in einer pluralen Gesellschaft erfüllen muss (vgl. ebd.). Wesentlich dafür schien ihm in einer demokratischen Gesellschaft die Offenheit für den sozialen Wandel. Nicht festgelegte Konzeptionen, sondern Erfahrungen und Impulse, die über Bestehendes hinausgehen, sieht er als wesentliche Triebfedern für Entwicklung. Bildung und Demokratie hängen für ihn daher zusammen. In Bildungsinstitutionen muss die Grundidee der Demokratie erfahrbar sein. Sie ist für ihn in erster Linie eine Lebensform, die auf Beziehung und Interaktion basiert, um unterschiedliche Interessen, aber auch gemeinsame Ziele auszuhandeln (vgl. ebd.). Als genuiner Ort dafür gilt das Spiel mit den Peers (vgl. Heimlich 2015, 2017). Die Offenheit für die frühen Kommunikationsangebote der jungen Kinder sind grundlegende Erfahrungsräume für Resonanz und Einflussnahme auf die soziale Welt und damit für Bildungsteilhabe und Partizipation (vgl. König 2020b). Diese Handlungsmöglichkeiten junger Kinder vor dem Hintergrund einer Pädagogik der Vielfalt zu reflektieren, ist Voraussetzung für die Umsetzung von inklusiven Bildungsangeboten in Kindertageseinrichtungen.