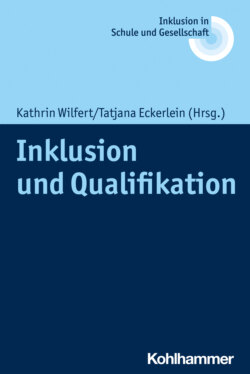Читать книгу Inklusion und Qualifikation - Группа авторов - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4 Fazit
ОглавлениеQualifizierung für Inklusion ist in den Kindertageseinrichtungen erst ansatzweise umgesetzt. In den Fachschulen für Sozialpädagogik – den zentralen Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erziehern – wird Inklusion als Querschnittsaufgabe angesehen. Inklusion bringt aber nicht nur Handlungsanforderungen auf unterschiedlichen Ebenen mit sich, sondern baut auf ein pädagogisches Grundverständnis auf.
Bereits Dewey weist darauf hin, dass in einer demokratischen Gesellschaft die Offenheit für den sozialen Wandel ein zentrales Anliegen sein muss (vgl. Oelkers 2009). Die Interviews zeigen, wie der soziale Wandel auch in den Einrichtungen ankommt. Die pädagogischen Fachkräfte nehmen im Kindergartenalltag plurale und veränderte Lebensformen der Familien wahr. Darüber hinaus wird sichtbar, dass die Strukturen dem Bedeutungswandel, den die Kindertageseinrichtungen durchschreiten, nicht mehr gerecht werden. Diese entwickeln sich in Richtung inklusive Einrichtungen für alle Kinder, was das Recht auf Bildung auch für junge Kinder als zentraler Baustein einer demokratischen Gesellschaft stärkt. Diese Dissonanzen im Umgang mit Heterogenität und pluralen Lebensformen erweisen sich in den Gruppendiskussionen letztlich als Kristallisationspunkt. Anhand von Beispielen beschreiben die Fachkräfte ihre Erfahrungen mit Heterogenität. Deutlich wird, dass die Fähigkeit, Widersprüche und Ambiguitäten anzuerkennen, auch die situationsadäquate Flexibilität des eigenen Handelns erhöht. In einem solchen Fall erleben sich die Fachkräfte als selbstwirksam, sie erfahren Responsivität mit den Kindern, derer sie als Pädagoginnen und Pädagogen bedürfen, um Bildung und Erziehung überhaupt erst zu ermöglichen. Es wird aber auch deutlich, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Die Fachkräfte hinterfragen ihre eigenen Routinen und Praktiken bei weitem nicht so kritisch, wie die Strukturen auf der Ebenen der Administration. Hier gilt es, von Mustern Abstand zu nehmen, die sich als Hemmnisse einer sensitiven und responsiven Praxis erweisen. Eine fehlende Distanz führt hier zu blinden Flecken in der Wahrnehmung des Alltags (vgl. Thon 2017; Egloff 2011; Helsper 2001). Eine auf (Selbst-)Reflexion gegründete Pädagogik – d. h. eine theoriedurchdrungene Praxis – gilt es in den Kindertageseinrichtungen noch zu entwickeln. Diese würde sich durch vertieftes Orientierungswissen auszeichnen, aber auch durch entsprechende Strukturen, die Reflexion im Sinne von Fach- und Teamberatung, Supervision, Coaching etc. in der pädagogischen Praxis ermöglichen (vgl. Cloos 2021). Dazu gehört auch, Qualität im multiprofessionellen Team neu zu denken. Die Diskussionen verweisen deutlich auf die Wichtigkeit, Veränderungsprozesse qualifiziert zu begleiten, um mit auftretenden Widersprüchen gegenüber der gewohnten Praxis sinnvoll umgehen zu können, sie ggf. als Teil einer akzeptierten, ja erwünschten Vielfalt zu verstehen. Zukunftsorientierte Ausbildungskonzepte müssen sich daran orientieren und den Aufbau von Ambiguitätstoleranz (vgl. Sprung 2011) ermöglichen.