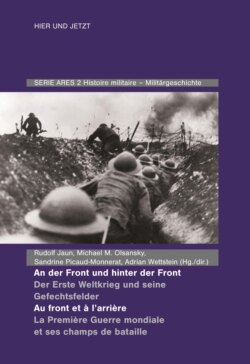Читать книгу An der Front und Hinter der Front - Au front et à l'arrière - Группа авторов - Страница 27
ОглавлениеAm 6. September 1916 landete auf dem Schreibtisch Franz Conrad von Hötzendorfs, des langjährigen Generalstabschefs Österreich-Ungarns, ein ausführlicher Bericht des Vertreters des Armee-Oberkommandos (AOK) der Habsburgermonarchie bei der deutschen Obersten Heeresleitung (OHL). Thema des Schreibens war der Sturz Erich von Falkenhayns als Chef der OHL. Alois Klepsch-Kloth von Roden versuchte aus all dem Tratsch, der ihm zugetragen wurde, ein Bild der Gründe für die Entlassung Falkenhayns zu formen. Vermutlich nahm Klepsch-Kloth an, beim AOK würde eine möglichst kritische Beurteilung des Geschassten gerne gelesen, hatte es doch immer wieder starke Spannungen zwischen Conrad und Falkenhayn gegeben, die nach dem Zerwürfnis über die Frage nach der Zukunft Montenegros in eine regelrechte Funkstille zwischen den Köpfen der verbündeten Armeeführungen gemündet hatten. Den Hinweis darauf, dass eklatantes Scheitern auf dem Feld militärischer Führung die missliche Kriegslage und damit letztlich den Sturz Falkenhayns herbeigeführt hätte, quittierte Conrad mit einer lakonischen Randbemerkung. Die ungünstige Kriegslage sei «Resultat des Kräfte-Missverhältnisses zwischen uns und unseren Gegnern.» Er schloss kurz und knapp: «C’est tout!»1
Es liegt nahe, in dieser Einschätzung aus der Feder Conrads auch eine Formel zu vermuten, die bei der Suche nach einer Entschuldigung für jene Rückschläge nützlich war, die Österreich-Ungarns Streitkräfte unter der Führung Conrads seit August 1914 immer wieder erlitten hatten. Die im Vergleich zum Gegner mangelhafte Ausstattung mit – angemessen ausgebildeten – Soldaten und mit Rüstungsmaterial gehörte denn auch nach 1918 bei Conrad und anderen Mitgliedern der früheren Militärelite zu den Standard-Topoi der Verteidigung. Der Beitrag von Martin Schmitz in diesem Band bietet Gelegenheit, die Rechtfertigungsstrategien dieser Kreise in der Zwischenkriegszeit näher kennenzulernen.2 Der Hinweis auf die Rüstungsdefizite und das strategische Ungleichgewicht bildete eine Waffe zur Verteidigung der eigenen Reputation, im Krieg selbst und noch darüber hinaus. Unberechtigt jedoch, das gilt es hier festzuhalten, war die Einschätzung keineswegs. Sie legte durchaus den Finger in die Wunde: Strategisch war die Lage der Mittelmächte eben von Beginn an ungünstig, und die weitere Entwicklung des Kriegs brachte nur kurzfristige Verbesserungen der Situation mit sich; kurzfristig nicht zuletzt deshalb, weil sich immer neue Gegner am Krieg beteiligten. Die Streitkräfte der Habsburgermonarchie standen damit bereits ab Herbst 1914 der Herausforderung gegenüber, sich trotz gravierender Rückschläge und gewaltiger Verluste an Material, an Mannschaften und nicht zuletzt an Offizieren in einem Mehrfrontenkrieg zu behaupten, auf den Truppe und Führung, aber auch Staat und Gesellschaft nur unzureichend vorbereitet waren. Von der Wirklichkeit des modernen Kriegs überrascht wurden auch die Gegner und Verbündeten der Donaumonarchie, aber die strategische Lage Österreich-Ungarns war besonders prekär und liess wenig Spielraum, um Fehler wettzumachen und Verluste auszugleichen. Insgesamt hatte die Militärführung Österreich-Ungarns immer wieder mit mangelnden Ressourcen zu kämpfen – mangelhaft vor allem im Hinblick darauf, dass zumindest bis zum Herbst 1917 die Lage an den Fronten prekär blieb, auch wenn bedeutende militärische Teilerfolge errungen worden waren. Und als nach Serbien und Rumänien auch Russland faktisch geschlagen und die Italiener bis zum Piave zurückgedrängt waren, reichten weder der Nachschub an Waffen, Munition und vor allem Nahrungsmitteln aus noch die Ersatzmannschaften, die die Lücken unter den Fronttruppen stopfen sollten.
Die letzte grosse Offensive am Piave zeigte dann deutlich, wie geschwächt die k. u. k. Armee bereits war. Schliesslich brach die Italien-Front im Herbst 1918 zusammen und die Armee zerfiel in oftmals von ethnisch-nationaler Identität bestimmte Teile. Nach dem Hinweis auf die Rüstungsmängel spielte denn auch vor allem die zentrifugale Kraft der Nationalismen eine entscheidende Rolle bei der Suche nach Erklärungen dafür, dass Österreich-Ungarn den Krieg verloren hatte. Die österreichische Variante der Dolchstosslegende sollte daher die mangelhafte Kohärenz der unterschiedlichen Nationen in den Streitkräften betonen – jenseits der Verratsrhetorik ehemaliger Offiziere, deren Entlastungsfunktion offenkundig ist, wirft die Geschichte der Streitkräfte in «Österreich-Ungarns letztem Krieg»3 die Frage auf, ob multinationale Armeen in der Moderne nicht grundsätzlich besonders verletzlich sind. So einfach, wie es die «kakanische» Variante der Dolchstosslegende suggeriert, lagen die Dinge dabei allerdings nicht. Das lässt sich gut am wichtigsten Belegstück dieser Denkschule zeigen, den Tschechen. Christian Reiter und Richard Lein haben detailliert nachgewiesen, dass von einer besonderen Unzuverlässigkeit tschechischer Soldaten keine Rede sein konnte. Führungsfehler oder schlechte Versorgung erklären die Fälle von Desertion, massenweiser Kapitulation oder Meuterei zumeist hinreichend. Nationale oder nationalistische Motive standen hingegen deutlich im Hintergrund, auch wenn der Mythos tschechischer Insubordination oder gar tschechischen Überläufertums als Massenphänomen sowohl der tschechischen Nationalbewegung als auch der Führung der k. u. k. Armee mehr als gelegen kam – aus entgegengesetzten Gründen, aber mit dem gleichen, die Erinnerungskultur lange prägenden Resultat.4 Rudolf Kucera hat allerdings auch konzise herausgearbeitet, dass die nationale Perspektive die Kriegserfahrung vieler tschechischer Soldaten doch immer stärker prägte, je länger der Krieg dauerte, je häufiger Diskriminierungserfahrungen wurden und natürlich auch je schlechter die Kriegslage erschien.5 Auch wenn es bei Soldaten aus den nichtprivilegierten Nationen der Doppelmonarchie immer wieder zu einzelnen Problemfällen kam, so blieben doch die Einsatzfähigkeit und der Gehorsam der Truppen über Jahre hinweg bemerkenswert stabil. Die Angst, die multiethnische Armee könnte rasch auseinanderbrechen, die mit dazu beigetragen hatte, 1914 den Krieg zu wagen, solange die Nationalisierung der Streitkräfte noch nicht weiter vorangeschritten war, erwies sich als unbegründet – zweifellos ein Fall von Ironie der Geschichte. Erst in der Schlussphase des Kriegs, als es auf eine erneute moralische wie materielle Mobilmachung anzukommen schien, erwies sich Österreich-Ungarn als vergleichsweise schwach, die Armee als nationalistischer Propaganda gegenüber zumindest teilweise anfällig. Mark Cornwall konnte jedoch zeigen, dass dieser Wandel eben wirklich erst sehr spät manifest wurde, trotz der antiösterreichischen Propagandakampagnen vor allem an der italienischen Front.6
Das ist umso bemerkenswerter, als die Versorgungslage sich im Laufe des Kriegs, vor allem aber seit Herbst 1917 dramatisch verschlechterte. Dies galt nicht nur für das Hinterland, wo vor allem in der österreichischen Reichshälfte der Hunger immer schärfere Formen annahm, sondern es betraf zunehmend auch die Truppen der Habsburgermonarchie. Weder die militärisch abgestützte Ausplünderung der Ukraine, mit der sich etwa Wolfram Dornik befasst hat, noch die konsequente und in Massen auch erfolgreiche Exklusivnutzung des besetzten Serbiens als Speisekammer der Armee, wie Jonathan Gumz gezeigt hat, boten hier ausreichende Abhilfe.7 In der letzten Kriegsphase wurden die Lebensmittel so stark rationiert, dass an der Südwestfront Kampftruppen in Gefahr gerieten zu verhungern. Dass sich solche Bedingungen auch auf die Schlagkraft und schliesslich auf die Kampfmoral auswirkten, ist nachvollziehbar. Die Zerfallserscheinungen der k. u. k. Armee gegen Kriegsende waren mit grosser Sicherheit nicht nur von der Ungewissheit über den Fortbestand des Imperiums und von der Politisierung ethnisch-nationaler Konflikte verursacht, sondern auch der Erschöpfung der mangelhaft ernährten, bekleideten und mit Waffen, Munition und Transportmitteln versorgten Truppe geschuldet. Als Begründung für die Niederlage eignete sich der Topos von der entscheidenden Wirkung der ethnisch-politischen Konfliktlinien in Heer und Imperium, und er wurde von ehemaligen Offizieren der k. u. k. Armee gerne bemüht, aber selbst in der offiziellen Kriegsgeschichtsschreibung bestand die Einsicht: «Der grösste Feind des guten Geistes im Heere war – das muss immer wieder betont werden – die wirtschaftliche Verelendung der Soldaten. […] Hunger, Mangel am Nötigsten auf allen Gebieten und Krankheiten unterschiedlichster Art öffneten nur zu leicht den erdenklichsten [sic] Einflüssen die Türe zu den Soldatenseelen.»8
Scheidet also die Schwächung durch nationalistische Strömungen als direkte Ursache für die vielen Rückschläge aus, die die k. u. k. Armee über den Gesamtverlauf des Kriegs hinweg erlitt, so harrt die Frage nach den Ursachen der gerade im Vergleich zum deutschen Verbündeten wenig erfolgreichen Kriegführung Österreich-Ungarn einer schlüssigen Antwort. Die ökonomischen Rahmenbedingungen, Probleme der zivilen Verwaltung oder die Koordinationsprobleme zwischen dem Königreich Ungarn und Österreich waren für die defizitäre Versorgungslage, die gegen Kriegsende in Teilen Österreichs und, wie erwähnt, selbst bei den Truppen an der Front katastrophale Züge annehmen konnte, in erster Linie verantwortlich. Die k. u. k. Armee und ihre Führung hatte darauf eher indirekten Einfluss, etwa im Hinblick auf die Anforderung von Arbeitskräften oder die Beanspruchung von Transportkapazitäten. Zur Erklärung der vielen militärischen Misserfolge vor dem letzten Kriegsjahr ist die Lebensmittelversorgung ohnehin nicht geeignet. Die Rüstungswirtschaft der Habsburgermonarchie wies Schwächen auf und konnte den Bedarf nicht immer decken. Dies galt in quantitativer wie in qualitativer Hinsicht. Bei Kriegsbeginn fehlte es an Gewehren, bald gab es auch Engpässe beim Munitionsnachschub für die Artillerie, und vor allem in der Anfangsphase galt es, möglichst schnell zur Ausstattung der gegnerischen Truppen mit Feldgeschützen aufzuschliessen.9 Unter dem Zeitdruck des Kriegs wurde dem raschen Schliessen von Rüstungslücken der Vorzug vor technischen Innovationen gegeben, etwa bei der Wahl der Geschütze oder der Bereitstellung von leichten Maschinengewehren.10 Wie Christian Ortner gezeigt hat, liess sich allerdings relativ bald gerade die Geschütz- und Munitionsproduktion steigern. Die katastrophale Unterlegenheit bei der Bestückung der Verbände mit Feldartillerie, die zu Anfang vor allem an der Galizien-Front verheerende Folgen zeitigte, konnte behoben werden. Mit 2600 Geschützen rückte das Feldheer 1914 aus; Ende 1915 waren bereits über 4500 Geschütze vorhanden, davon allein 2300 im Südwesten; Ende 1916 waren es insgesamt 6200, bei Kriegsende sogar 8500 Geschütze. Auch die Ausstattung mit Maschinengewehren war von Beginn an gut und umfasste Ende 1915 2800 Stück. Erst die letzten eineinhalb Kriegsjahre führten dann wieder zu neuen Engpässen.11
Anders als im Fall der Lebensmittelversorgung bestand vor allem bei der Artillerierüstung auch schon in den ersten Kriegsmonaten ein gravierender Nachteil für die Operationsfähigkeit der k. u. k. Armee und nicht erst im letzten Kriegsjahr. Die Verantwortung für das Fehlen moderner Feldhaubitzen und die geringe Ausstattung mit Feldkanonen trugen keineswegs nur die sparsamen Politiker der Vorkriegszeit, sondern auch die Militärführung, die bei der Ressourcenallokation andere Prioritäten gesetzt hatte, die sich nicht zuletzt aus der Absicht erklären lassen, auf einen Krieg gegen Italien vorbereitet zu sein.12 Für das zweite, dritte und selbst für das vierte Kriegsjahr waren die so bereits vor 1914 angelegten Defizite der Artillerierüstung aber weniger entscheidend. Bei der Personalrüstung lagen die Dinge zwar anders, aber auch hier galt, dass zumindest bis zur Wehrreform 1912 den Politikern die Schuld für das geringe Kräfteaufgebot 1914 zugesprochen werden konnte – ganz im Sinn Conrads und der früheren Armeeelite urteilte Maximilian Ehnl in einem Ergänzungsheft zum offiziellen österreichischen Weltkriegswerk daher:
«Die zur Bewilligung des Rekrutenkontingents berufenen Volksvertretungen beider Reichshälften haben in unverantwortlicher Kurzsichtigkeit und Verständnislosigkeit nie die volle Ausnützung der Volkskraft auch schon im Frieden ermöglicht. Mit einem jährlichen Ersatz von 159 500 Mann für das k. u. k. Heer, von 7200 Mann für die bosnisch-herzegowinischen Truppen, von 24 717 Mann für die k. k. Landwehr und von 25 000 Mann für die k. u. Honvéd war an eine Erhöhung der Stände nicht zu denken; man musste froh sein, wenn das Bestehende erhalten und die für zeitgemässe Gestaltung notwendigen Neuaufstellungen an schwerer Feldartillerie und technischen Truppen durchgeführt werden konnten.»13
Die – durchaus zutreffend geschilderten – Folgen der verspätet einsetzenden und nicht sehr weitreichenden Verstärkung der Personalrüstung erwiesen sich in der Tat als schwerwiegende Belastung für die Kriegführung der Habsburgermonarchie, und zwar mindestens für die ersten drei Kriegsjahre. Allerdings waren die niedrigen Stände auch darauf zurückzuführen, dass sich Österreich-Ungarn bereits im Frieden verhältnismässig (zu) viele Verbände leistete.14 Dementsprechend wurden während des Kriegs im Vergleich zu Deutschland nur spät und in geringem Umfang neue Divisionen aufgestellt. Bei der relativ überdehnten Organisationsstruktur führte die geringe Anzahl ausgebildeter Rekruten auch dazu, dass Österreich-Ungarn über keine zweite Linie verfügte.15 Erst die Wehrreform von 1912 eröffnete überhaupt die Aussicht, auch mit einer so grossen Zahl von ausgebildeten Reserven rechnen zu können, dass sich schon bald die Frage nach einem entsprechenden Organisationsrahmen stellte. Conrad forderte denn auch die Schaffung einer Reservearmee. Bei den Planungen zeigte sich der Generalstab zurückhaltender als die zuständige 10. Abteilung des Kriegsministeriums, die bereits für 1915 die Aufstellung von Reservetruppen ins Gespräch brachte, während der Generalstab im Januar 1914 davon ausging, ab 1918/19 erste Feldformationen und ab 1925 voll ausgestaltete Reservedivisionen bereitstellen zu können.16 Noch nach den ersten Feldzügen, Anfang November 1914, regte der Kriegsminister an, aus Besatzungen der Donaubrückenköpfe zwei bis drei Reservekorps zu bilden. Conrad lehnte dies ab, weil es ihm «viel rationeller erschiene, alles, was wir an Offizieren und Mannschaften verfügbar hätten, in die bestehenden Formationen einzureihen, um diese auf möglichst hohem Stande zu erhalten und deren grosse, durch Gefechts- und Krankheitsverluste verursachte Abgänge zu decken.»17
Weil bis zum Kriegsausbruch jenseits mittel- bis langfristiger Überlegungen noch wenig passiert war, wurde nun «der Versuch unternommen, mit den Marschformationen eine Art Reservearmee zu improvisieren, indem man sie in Marschregimenter und Marschbrigaden formierte und als Kampftruppe verwendete. Der Versuch zeitigte kein günstiges Ergebnis; unzulänglich ausgerüstet – sie besassen keine Maschinengewehre und so gut wie keine Artillerie – konnten sie trotz bestem Willen, Hingabe und Opfermut den Anforderungen als Kampftruppe nicht gewachsen sein und gingen überdies zum grossen Teil infolge beträchtlicher Verluste ihrem eigentlichen Zwecke, dem Ersatz der Verluste bei ihren Truppen, verloren.»18 Das Experiment wurde rasch beendet und nun stand zusammen mit dem Landsturm auch noch das ganze übrige Reservoir Ausgebildeter für den Fronteinsatz zur Verfügung. «Einen Vorteil hatte die Sache» daher «allerdings: Es standen verhältnismässig zahlreiche Ersätze für eingetretene Verluste zur Verfügung. Diese waren nun freilich bedeutend.»
Einrücken von Ersatztruppen in Folwarki Waga, vermutlich 1916. (Österreichische Nationalbibliothek)
In der Tat: Mit insgesamt 2,7 Millionen Offizieren und Soldaten lagen die Verluste schon im ersten Kriegsjahr besonders hoch, aber auch im zweiten Kriegsjahr mit 1,8 Millionen sowie im dritten und vierten Jahr mit zusammen rund 2,9 Millionen waren die vom Krieg gerissenen Lücken in den Truppenständen und im Offizierskorps gewaltig. In Kämpfen fielen insgesamt 530 000 Mann, davon über 270 000 schon in den ersten zwölf Monaten des Kriegs.19 Den eigentlichen Tiefpunkt an militärischer Schlagkraft erlebten Österreich-Ungarns Landstreitkräfte Anfang 1915. Gerade einmal eine gute halbe Million «Feuergewehre» – also einsatzfähige Kämpfer – zählte die Militärstatistik. Die desaströse Karpatenoffensive forderte dann so viele Opfer, dass bis zum Frühjahr 1915 bereits 2 Millionen Verluste zu beklagen waren.20 Diese Lücken zu füllen wurde zur Herausforderung der militärischen wie der zivilen Administration. Es genügte nicht, die jeweils neu leistungspflichtig werdenden Jahrgänge zu erfassen und möglichst weitgehend einzuziehen, sondern es wurde nun nötig, alle älteren Jahrgänge nachzumustern und den Pool der zahlreichen nicht Ausgebildeten möglichst komplett zu nutzen, aber auch die Landsturmpflicht 1915 um acht Jahre zu verlängern. Unter Einbeziehung von Genesenen, die wieder verwendungsfähig geworden waren, konnten so in den ersten drei Kriegsjahren jeweils rund 2 Millionen Mann aufgebracht werden. Ganz selbstverständlich wurde der Begriff «Menschenmaterial» benutzt, wenn es um die solcherart sichergestellten Ressourcen zur Fortsetzung des Krieges ging – ganz analog zum Waffen- und Munitionsmaterial, das ebenfalls in grossem Umfang verbraucht wurde und zu ersetzen war, sollte ein Zusammenbruch der Front verhindert werden.
Friedhof in Mahala, um 1915. (Österreichische Nationalbibliothek)
Es fehlte zunehmend auch an Offizieren. Die hohen Verluste unter den an der Front eingesetzten Berufsoffizieren – von denen jeder fünfte fiel –, die häufig über gute oder wenigstens leidliche Kenntnisse in mehreren Regimentssprachen verfügten, machten zudem die Kommunikation zwischen Vorgesetzten und Untergebenen nicht leichter. Erschwerend wirkte sich aus, dass auch das Berufsunteroffizierskorps schon in der Anfangsphase des Kriegs viele Tote und Verletzte zu beklagen hatte und damit ein wesentliches Bindeglied zwischen den Sprachkulturen der Truppe und der kulturell zumeist deutsch, gelegentlich auch magyarisch geprägten Militärelite fehlte. Reserveoffiziere mussten schon gegen Ende 1914 die Lücken im Führungspersonal füllen. Bei ihnen war die Ausrichtung auf die Gesamtmonarchie, das Bewusstsein für die übernationalen Traditionen der Armee und oft auch die Kenntnis der Regimentssprachen schwächer ausgebildet. Potentielle Probleme mit dem Einsatz von Reserveoffizieren blieben der Militärführung schon in der Frühphase des Kriegs nicht verborgen. Manchmal spielten bei der Einschätzung ethnische Zuschreibungen eine Rolle, nicht zuletzt im Hinblick auf die jüdischen Reserveoffiziere. Antisemitismus hatte im politisch-sozialen Leben der Habsburgermonarchie, insbesondere in der österreichischen Reichshälfte, längst einen festen Platz, als der Krieg ausbrach. Im Berufsoffizierskorps der k. u. k. Armee gab es kaum Juden; das war aber kein Hinderungsgrund, im Sinn antisemitischer Denkmuster missliebigen Standesangehörigen jüdische Vorfahren zum Vorwurf zu machen. Zugleich aber gab es, anders als in Deutschland, keinen Versuch, Juden aus dem Reserveoffizierskorps auszusperren. Bildungs- und Vermögensverhältnisse führten im Rahmen des Einjährig-Freiwilligen-Privilegs daher dazu, dass bei Kriegsbeginn beinahe ein Fünftel der Reserveoffiziere Juden waren. Drückebergerei und mangelnde Autorität wurden ihnen in internen Berichten schon nach den ersten Kriegswochen nachgesagt.21 An der Qualität der Reserveoffiziere hatten beim Generalstab vor Kriegsbeginn Zweifel geherrscht.22 Die Erhebung von Informationen zur Leistungsfähigkeit der Reserveoffiziere war denn auch Teil einer systematischen Sammlung von Erfahrungen aus den ersten Kriegsmonaten.23 Martin Schmitz hat diese Erfahrungsberichte als Erster analysiert und ausgewertet. Die Berichte erlauben Einblicke in ein breites Spektrum an Problemlagen. Dazu zählen nicht zuletzt die Fragen nach den Stärken und Schwächen der verschiedenen Ebenen des Offizierskorps, des Verhältnisses zur Truppe und zur Zuverlässigkeit oder Unzuverlässigkeit bestimmter Einheiten. Die Anfang 1915 systematisch eingeholten Berichte boten aber auch Anhaltspunkte für eine Reform der Landstreitkräfte, ein Thema, das in unterschiedlichen Varianten und mit unterschiedlichen Protagonisten fast bis zum Kriegsende diskutiert werden sollte.24
Auch die deutschen Verbündeten kommentierten die Qualitätsmängel im Offizierskorps der k. u. k. Armee und machten sich Gedanken über mögliche Verbesserungen. Major Graf Bethusy Huc rügte in einem Erfahrungsbericht am Offizierskorps der k. u. k. Armee die mangelnde Initiative und die Umständlichkeit bei der Befehlsausgabe. Letztlich attestierte er den Verbündeten Verantwortungsscheue und ein zu stark ausgeprägtes Streben danach, sich das Wohlwollen der Vorgesetzten zu sichern. Unter den Verbesserungsvorschlägen war die Empfehlung, durch weniger häufige Versetzungen «mehr Spezialisten für die einzelnen Volksgruppen» zu gewinnen. Die aus deutscher Sicht so erschreckend komplizierte Kommunikation zwischen Offizieren und Mannschaften einer Vielsprachenarmee sollte durch diese Massnahme im Verein mit ethnisch homogeneren Regimentern erleichtert werden. «Mittel und Mass der Ausbildung des einzelnen Mannes», so Bethusy Huc, seien «je nach seiner völkischen Eigenart [zu] bestimmen».25
Harsche Kritik am Offizierskorps konnte sich auch mit der Ablehnung der in der k. u. k. Armee geübten Praxis verknüpfen, die Verluste unter den Mannschaften auszugleichen.Es bürgerte sich rasch ein, dass jedem Regiment pro Monat ein Marschbataillon zugeschoben wurde, eine Regelung, die zwar die Organisation der Ergänzungen standardisierte und insofern erleichterte, die aber zugleich schematisch war und dem eigentlich je nach Lage des Verbandes sehr unterschiedlichen Ersatzbedarf der betroffenen Einheiten nicht Rechnung trug.26 Diese strukturelle Schwäche fiel auch den Verbündeten ins Auge. Die kritische Sicht auf ein Defizit der Organisation mischte sich allerdings dabei gerne auch mit Urteilen über andere Charakteristika der Armee Österreich-Ungarns. Das weitreichende Versagen der k. u. k. Armee im Jahr 1916, so urteilte der deutsche General Johannes von Eben, dessen Verband zur Unterstützung der k. u. k. Armee während der Abwehr der Brussilow-Offensive eingesetzt und dem Kommando der 2. österreichisch-ungarischen Armee unterstellt worden war, «findet seine psychologische Erklärung in der Energielosigkeit und Indolenz, die eine Nationaleigentümlichkeit besonders der slawischen Stämme bilden» sowie in der «politische[n] Zerfahrenheit der Donaumonarchie, bei der jeder Volksstamm sein besonderes Kriegsziel hat und manche unausgesprochen den Sieg der Russen wünschen. Aus solchem Menschenmaterial sind brauchbare Soldaten nur zu machen bei unausgesetzter scharfer und genauer Arbeit, sowohl bei den Truppen in der Front, als auch bei dem hinter der Front auszubildenden Ersatze. Dass dies nicht geschehen ist, lag hauptsächlich an dem System der Marschbataillone und an der geistlosen, um nicht zu sagen gewissenlosen Art, wie dieses System gehandhabt wurde.» Die automatische Zufuhr von Marschformationen alle vier bis sechs Wochen, ganz unabhängig von der jeweiligen konkreten Bedarfslage bei den Stammformationen, war unsinnig, vor allem aber wurde die Ausbildung vernachlässigt. Nur durch dauernde Arbeit seien auch die bereits vorhandenen Reservisten einsatztauglich zu machen und zu halten, aber: «Diese dauernde Arbeit liegt dem Oesterreicher gar nicht und kann nur durch einen von deutscher Seite ausgeübten, ebenso beständigen, wie in der Form sanften Druck erreicht werden, da ein Zuviel in dieser Beziehung das Ganze verderben würde.»27
Sanfter Druck und gelungene Einflussnahme hingen auch vom Fingerspitzengefühl der deutschen Offiziere ab. Der Einfühlsamkeit eher unverdächtig war der ausgewiesene Österreicher-Verächter Oberst Max Hoffman. Er schrieb seiner Frau im Sommer 1916: «Sorgen wegen der Österreicher, die in allem versagen, kurz, die richtige Sonntagsstimmung. Die Schufte wollen einfach nicht mehr. Die aktiven Offiziere sitzen in den höheren Stäben, auf der Etappe oder sonstwo, und die jüdischen Kommis, Schauspieler, und kleinen Beamten, die als Offiziere an der Front stehen, können und wissen nichts. Und wenn sie was könnten, und wenn sie das Beste wollten, die haben keinerlei Autorität bei den Leuten. Dazu das Völkergemisch mit 23 Sprachen. Keiner versteht den andern. Jetzt fangen wir an, die Österreicher auszubilden und exercieren zu lassen. Es ist schon ein Kreuz.»28
Was in der k. u. k. Armee fehlte, war ein Pendant zu den deutschen Rekrutendepots, bei denen die Ausbildung der Truppe die zentrale Aufgabe darstellte. Beim österreichisch-ungarischen Verbündeten gab es diese institutionelle Bindung nicht, und die Divisionen und Regimenter standen der Rückbehaltung von besonderen Formationen minder ausgebildeter Soldaten bei den Korps ablehnend gegenüber. Dem Regimentskommandanten blieb es möglich, die Kämpferbestände klein zu rechnen und «damit zu beweisen, dass er nicht genug Feuergewehre auf den km der Stellung besässe, und die Einreihung der Marschbataillone zu fordern.» Dem Kommando der 2. Armee attestierte von Eben zwar, dass es diesen Missstand zu beheben versuchte, dies aber vergeblich, «denn der Grund des Uebels ist, dass alle höheren Führer der k. u. k. Armee, vom Regimentskommandeure angefangen, im allgemeinen nicht den Ehrgeiz haben eine möglichst grosse Kampfkraft aus ihren Truppen herauszuholen, sondern diese als möglichst gering darzustellen, damit sie eine möglichst leichte Aufgabe erhalten und damit grössere Sicherheit, sie ohne Rückschläge zu lösen.» Auch von Eben kam nicht umhin, diese Einschätzung mit einer massiven Kritik an der Qualität des k. u. k. Offizierskorps zu verknüpfen: «Es ist dies eine Erscheinung, die aus dem Grundübel des österreichischen Offizierskorps, der geringen Bewertung des Charakters und der auf Willenskraft beruhenden Leistungen [herrührt] im Gegensatz zu gefälligen äussern Formen und Leistungen, die in erster Linie auf Intelligenz und Arbeit beruhen.» Die k. u. k. Armee müsse gründlich reformiert werden und die Alliierten hätten schlicht zu akzeptieren, «dass bei der ganzen Ausbildungsangelegenheit wir die Gebenden und sie die Empfangenden sind», wenn ein weiteres Desaster nach dem Muster der Brussilow-Offensive vermieden werden solle. Die deutschen Bemühungen um eine Änderung der Organisation, Führungskultur und Ausbildungsarbeit bei der k. u. k. Armee zielten darauf, den – leider – unverzichtbaren Alliierten im Feld zu halten und für die Zukunft ein vergleichbares Qualitätsgefälle zwischen dem Deutschen Reich und seinem Verbündeten zu vermeiden. Angesichts der drängenden Probleme mussten die gewünschten Strukturreformen der Nachkriegszeit überlassen werden. Auch die Bestrebungen des AOK selbst waren vor allem darauf ausgerichtet, die aktuellen Krisen besser in den Griff zu bekommen.
Immerhin gelang die Bereitstellung der notwendigen Ersatzmannschaften bis Ende 1916 noch relativ gut. Es hatte sich als Erfahrungswert herauskristallisiert, dass pro Jahr etwa 1,8 bis 2 Millionen Soldaten benötigt würden, um die Verluste des Feldheeres auszugleichen. Weil aber kaum mehr diensttaugliche Männer der bisher stellungspflichtigen Jahrgänge zu finden sein würden, war selbst unter Einrechnung der neu einzuberufenden Achtzehnjährigen und der zu erwartenden Zahl an Genesenen, die wieder zum Einsatz zur Verfügung standen, maximal eine Bedarfsdeckung bis zum Herbst 1917 möglich. Eine denkbare Abhilfe hätte nach dem Muster von 1915 die erneute Ausweitung der Landsturmpflicht geboten, aber aus politischen Gründen wurde davon Abstand genommen. Kaiser Karl, der neue Monarch, wollte die Bevölkerung nicht mit einer so fühlbaren Massnahme belasten, während Ungarns Ministerpräsident István Tisza schon seit längerer Zeit darauf drängte, den überproportionalen Anteil des Königreichs an der Stellung von Mannschaften zurückzufahren. Unter Leitung des bisherigen ungarischen Landesverteidigungsministers Baron Samu (Samuel) Hazai, der im Februar 1917 zum «Chef des Ersatzwesens für die gesamte bewaffnete Macht» der Habsburgermonarchie ernannt wurde, sollten durch systematische Ausnutzung aller Personalreserven, unter anderem auch durch die Einberufung von Arbeitskräften der Kriegsindustrie, Lücken in den Mannschaftsständen geschlossen werden. Nun strebte die Militärführung auch gezielt eine bessere Ausbildung der Ersatzmannschaften und deren bedarfsgerechte Zuweisung zu den Frontverbänden an.29
Im Mai 1917 ging die Habsburgermonarchie daran, ihre Landstreitkräfte neu zu formieren. Um zusätzliche Verbände aufstellen zu können, wurde teilweise auch die Heeresstruktur verändert. Infanterieregimenter sollten statt vier nur mehr drei Feldbataillone aufweisen, wie in anderen Armeen bereits üblich. 1916 war ein entsprechender Vorschlag des Kriegsministeriums, der eine solche Strukturveränderung allerdings erst für die Nachkriegszeit vorsah, noch am Widerstand des AOK unter Conrad gescheitert, aber nun spielte das 2. AOK bei der Neuregelung mit. So liess sich die neue Ausgestaltung der Infanteriedivisionen zu jeweils zwölf Bataillonen durchführen, ohne die Brigaden auflassen zu müssen. Die Zahl der Divisionen wurde im Krieg von 48 auf 71 gesteigert; die Friedensgliederung sollte künftig im Vergleich zu 1914 zehn zusätzliche Infanteriedivisionen und eine weitere Kavalleriedivision aufweisen. Auf Reservedivisionen sollte verzichtet werden.30 Dieser Umstand liess sich aus den Opfern des laufenden Kriegs heraus begründen, aber letztlich ging es auch um Standesinteressen des Offizierskorps. Die Reform liess schon die Wünsche für die Nachkriegszeit durchschimmern: «Eine starke Vermehrung von Truppenverbänden war sicherlich am besten noch während des Krieges möglich, aus dem die neuen Regimenter überdies mit einer Geschichte und Tradition hervorgehen würden», so das Urteil im österreichischen Weltkriegswerk. «Neue höhere Offiziersstellen verbesserten wenigstens einigermassen die ungünstigen Aufstiegsmöglichkeiten des Truppenoffizierskorps.»31 Quantität ging beim Berufsoffizierskorps also letztlich vor Qualität, und falls die Rekrutenkontingente nicht erhöht worden wären, hätte sich die k. u. k. Armee schon nach wenigen Jahren wieder dem alten Problem der niedrigen Mannschaftsstände gegenübergesehen. Aber dazu kam es nicht, dank des «Kräfte-Missverhältnisses» zwischen den Mittelmächten und ihren Gegnern, an dem eben auch die teilweise hausgemachten strukturellen Schwächen der Landstreitkräfte ihren Anteil besassen.