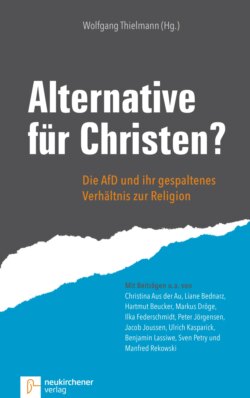Читать книгу Alternative für Christen? - Группа авторов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die AfD, das Christentum und die Kirchen – eine spannende Dreiecksbeziehung
ОглавлениеKirchen und Religion haben den Weg der „Alternative für Deutschland“ begleitet. Sie selber pflegt eine schillernde Verbindung zu beiden. Seit der Gründung der AfD 2013 im Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche in Oberursel im Taunus ist das Band zwischen ihnen nicht abgerissen – bis hin zu der Springflut der von Abneigung und Hass geprägten Kirchenkritik während des Parteitages im April 2017 in Köln. Die Kirchen haben sich mit dem Satz „Unser Kreuz hat keine Haken“ klar gegen die Drift der Partei ins deutsch-nationalistische Fahrwasser gestellt. Das hat die Partei getroffen.
Denn die AfD fordert selber die Deutungsmacht darüber, was christlich ist.
Wie gehen Kirchen mit der Partei um, mit den Überzeugungen ihrer Mandatsträger, mit den Verbindungen zwischen Kirchen- und Parteiamt und mit der Sympathie auch von Christen zu konservativen oder auch rechten Überzeugungen? Davon handelt dieses Buch. Die Autorinnen und Autoren schauen genau auf die Entwicklung der Partei, auf ihre Überzeugungen und auf ihre Strategien. Dieses Buch möchte Kirchen, Gemeinden und Gruppen helfen, sich mit der AfD auseinanderzusetzen, aber das Gespräch nicht aufzugeben.
Die drei Gründungssprecher der neuen Partei am rechten Rand des politischen Spektrums sahen sich im konservativen Protestantismus zuhause, die Pfarrersgattin Frauke Petry, der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke und der Publizist Konrad Adam. Nach Luckes Ausscheiden 2015 wurde Jörg Meuthen der zweite Sprecher neben Petry. In den Monaten vor Erscheinen dieses Buches hat er sich mit seiner Opposition gegen Frauke Petry weiter in den Vordergrund gespielt. Zum Auftakt des Kölner Wahlparteitages im April 2017 intonierte er die Kritik an den Kirchen mit dem Vorwurf, die Aktionen der Kirchen gegen die Positionen der AfD – er nannte sie „klerikalen Klamauk“ – hätten ihn zum ersten Mal über einen Kirchenaustritt nachdenken lassen. Meuthen ist Katholik und sieht sich in den Schriften des deutschen Papstes Benedikt XVI. religiös beheimatet.
Mit diesem Hintergrund ist die Partei zum wichtigsten Teil der neuen nationalistischen Bewegungen geworden. Zugleich hat sie sich geöffnet für Vertreter eines rechten Spektrums, das mit Religion nichts anfangen kann, wenn sie nicht „schön deutsch“ bleibt. Repräsentanten beider Richtungen forderten ein Ende der Kirchensteuer und den Entzug der Körperschaftsrechte, weil Gemeinden Kirchenasyl anbieten und die Kirchen die Partei kritisieren. Ins Wahlprogramm der Bundestagswahl 2017 wurde die Forderung aufgenommen, die staatliche Finanzierung von Bischofsgehältern zu beenden. Tatsächlich ist das an nur noch wenigen Stellen der Fall, vor allem in der katholischen Kirche. Die Kirchen haben erkannt, dass diese Form der Finanzierung nicht mehr in die Zeit passt. Die Forderung stößt in die Debatte um Staatsleistungen an die Kirchen. Fachleute beziffern den Betrag auf etwa 400 Millionen Euro im Jahr. In den Kirchen wie in der Politik ist in den letzten Jahren die Bereitschaft gewachsen, eine Ablösung anzugehen, die schon die Weimarer Reichsverfassung vorsah. Keine Seite hatte früher Interesse daran. Denn der volkswirtschaftliche Nutzen der Kirchen ist immens, und eine Ablösung würde Löcher in Bundes- und Landeshaushalte reißen. Doch der hohe Symbolwert der Staatsleistungen hat das Interesse an einer Lösung wachsen lassen.
In der AfD bekam das Thema einen neuen Zusammenhang. Bisher nährten Staatsleistungen die kritische Frage, ob Staat und Kirche wirklich getrennt seien. An dieser Frage hat die AfD kein Interesse. Ihr geht es weniger um eine Unterscheidung zwischen Staat und Religion als um staatliche Kontrolle der Religion. Das wird besonders an ihren Vorstellungen klar, den Islam zu reglementieren und etwa die Vollverschleierung oder den Bau von Minaretten zu verbieten.
Das schlägt auf das Verhältnis zu den Kirchen durch. Die bisherigen Äußerungen zeigen die Absicht der AfD, Religion nach Wohlverhalten zu honorieren oder zu sanktionieren. Dabei muss sie zwischen Christentum und Kirchen unterscheiden. Am deutlichsten formuliert das der niedersächsische Landesvorsitzende Armin Paul Hampel: Er sei schon vor 25 Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Diese sollte „die Bezeichnung ‚christlich‘ aus ihrem Namen streichen, weil sie das Christentum nicht mehr vertritt“. Er versteht sich jedoch, wie er sagte, als „überzeugter Christ und Lutheraner.“
Die AfD braucht das Christentum. Es steht im Parteiprogramm als eine Quelle der deutschen Leitkultur. Auch dient es als Begründung dafür, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Für den Islam möchte die AfD die Religionsfreiheit einschränken. Das Christentum ist eine Basis der Partei, der Islam ihr Feindbild. Und die Kirchen entwickeln sich neben der etablierten Politik und den Medien zur Reibungsfläche, an der die AfD ihr Licht zum Leuchten bringen will.
Die großen Kirchen haben zunächst die Entwicklung der AfD abgewartet. Bald gingen sie auf Distanz zu der neuen Partei, besonders zu ihren rechtskonservativen und nationalistischen Flügeln. Die aber scheinen aus jeder Krise stärker hervorzugehen.
Die neue Partei organisierte sich wie keine vor ihr über das Internet, den Platz der lauten Stimmen und des Streits ohne Hemmungen. Mit Facebook, Twitter und Whatsapp konnte sie sich weit schneller entwickeln als alle Parteien vor ihr, lauter und plakativer und zugleich anonymer. Das wirkt sich aus bis in die Dörfer. Es erschwert das Gespräch mit denen, die sich für die Positionen der AfD öffnen, aber kaum darüber reden, weil sie die Kritik scheuen, mit der sie rechnen müssen. Über die elektronischen Medien konnte die Partei „alternative Fakten“ behaupten und falsche Nachrichten verbreiten. Währenddessen entzieht sie sich unbequemen Fragen. Kritische Journalisten erhalten kaum Zutritt zu Versammlungen und Parteitagen. Viele Repräsentanten der Partei lassen sich am liebsten nur ausgewählte Fragen stellen. Der Kölner Parteitag forderte eine Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Besonders klar wird die rechtsnationalistische Ausrichtung der Partei am thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke. Er polarisierte seine eigene Partei mit einer Rede im Dresdner Ballhaus Watzke. Dort kritisierte er einen „Import fremder Völkerschaften“, der das Sozialsystem und den sozialen Frieden gefährde. Und er forderte eine „erinnerungspolitische Wende“: Statt der „dämlichen Erinnerungspolitik“ brauche Deutschland eine „Erinnerungskultur, die uns vor allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderen in Berührung bringt.“ Das Berliner Holocaust-Denkmal bezeichnete er als ein „Mahnmal der Schande“. Während dieses Buch entstand, lief ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn. Das Allensbacher Institut für Demoskopie stellte nach seiner Rede einen steilen Absturz der Beliebtheit der AfD fest. Doch die Stimmen, die sich von Höckes Einstellung distanzierten, wurden immer leiser, der Weg in den rechten Nationalismus offensichtlich.
Kurz vor dem Kölner Parteitag im April meldete sich erneut der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er verurteilte den Nationalismus, den die Partei pflegt, mit deutlichen Worten: „Wer sein eigenes Land oder seine eigene Volksgruppe überhöht und gegen die anderen in Stellung bringt, produziert Hass, irgendwann Gewalt und am Ende vielleicht sogar wieder unzählige Tote. Deswegen sage ich: Nationalismus ist eine Erscheinungsform von Sünde.“
Dieses Buch will trotz dieser Tendenz zur Abgrenzung der AfD von der Kirche bei gleichzeitiger Indienstnahme des Christentums das Gespräch befördern. Deshalb kommt auch der Jurist Hartmut Beucker aus Wuppertal zu Wort, der sich für die AfD um ein Landtagsmandat bewarb. Wegen seines Parteiamtes trat das Presbyterium geschlossen zurück, dem er angehörte.
Auch die Vorsitzende der Gruppe „Christen in der AfD“, Anette Schultner, war zur Mitwirkung am Buch angefragt. Sie hat aber auf keine Einladung reagiert. Während des Kölner Parteitags unterstützte sie die Kirchenkritik der Funktionäre. Schultner gehört zu einer Freien evangelischen Gemeinde, also zu einer evangelischen Freikirche. Zur AfD kam sie über ihre Mitwirkung an der „Demo für alle“ in Hannover, einem Aktionsbündnis von Gegnern gegen den sogenannten „Genderwahn“ und gegen Bildungspläne in Baden-Württemberg und Hessen. Sie kämpft gegen Abtreibung und Christenverfolgung und für die traditionelle Ehe; Themen, die auch an den konservativen Rändern der beiden großen Kirchen Gewicht haben, bei Rechtskatholiken und Evangelikalen. Daher sollte auch ein Vertreter der evangelikalen Bewegung in diesem Buch vertreten sein. Doch niemand der Angefragten war dazu bereit – ein Indiz dafür, dass die AfD in der Bewegung mehr Zustimmung genießt als es den Führungen lieb ist. Oder sympathisieren mehr Verantwortliche als gedacht mit Positionen der Partei?
Unter den „Christen in der AfD“ soll es eine konservativ-katholische Mehrheit geben. Ehemalige Spitzenfunktionäre aus den Landesverbänden suchen hier eine neue Chance zur Profilierung. Noch ist offen, wie wichtig der Kreis für die Partei wird.
Die „Alternative für Deutschland“ ist die Partei der heilen Welt. Ihr Deutschland besteht aus Reinräumen und Klartexten. Es ist die Welt der kulturellen, ethnischen, wirtschaftlichen und politischen Eindeutigkeit. Die AfD verspricht, dass es solche reinen Räume und guten Zeiten gegeben hat und dass sie die Menschen wieder dahin führen kann. Sie spricht Enttäuschte an, die sich als Verlierer fühlen, denen die Übersicht abhandengekommen ist. Sie besetzt den Begriff des Konservativen.
Dabei ist die AfD kein Sammelbecken für Unzufriedene am Rand der Gesellschaft und keine Prekariatspartei, auch wenn etwa Alexander Gauland sie als Partei der kleinen Leute bezeichnet. Das sahen zu Unrecht Kommentare voraus, als der Gründungsparteichef Bernd Lucke im Sommer 2015 abgewählt wurde, weil er die rechtskonservative Drift in den Landesverbänden nicht mitmachen wollte. Doch die AfD ist nicht einfach an den rechten Rand der Gesellschaft abgewandert wie vergleichsweise die NPD. Ihre Funktionäre sind Unternehmer, Lehrer und Anwälte. Sie ist also alles andere als ein Randgruppenphänomen. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft brachte im März 2017 zutage, dass die Partei in der Mitte der Gesellschaft zuhause ist. Das belegen Einkommensniveau und Bildungsniveau. Mit 2200 Euro Nettoeinkommen stehen die Anhänger der Partei leicht besser da als der Schnitt der Bevölkerung. 55 Prozent von ihnen haben ein mittleres Bildungsniveau, etwa einen Sekundarschulabschluss, 25 Prozent ein hohes, und nur jeder Fünfte ist weniger gebildet.
Größer als im Schnitt ist aber die Angst vor der Zukunft. 82 Prozent der Sympathisanten fürchten negative Folgen der Zuwanderung. Fast so hoch rangiert die Sorge vor einer steigenden Kriminalität. Die AfD, so bilanziert die Studie, sei die Partei der „sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener.“
Auf der Klaviatur dieser Angst intonieren die AfD-Funktionäre ihr Lied vom Verschwinden der Harmonie.
Längst sind auch die kritischen Stimmen im Inneren der Partei laut geworden. Mitgründer Konrad Adam verteidigte noch im Dezember 2016 in der evangelikalen Zeitschrift idea-Spektrum die Linie der Partei. Noch klang seine Kritik vorsichtig: Dass Frauke Petry forderte, den Begriff „völkisch“ auch positiv zu sehen, fand er nicht rechtsextrem, aber ungeschickt. Im April 2017 erhob er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung schwere Vorwürfe gegen die Führung und die skandalträchtige Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Er kritisierte – wie auch die Kirchen – ein gebrochenes Verhältnis zu demokratischen Verfahren. Seiner Führungskollegin Petry warf er „Methoden einer Kaderpartei“ vor. Ihren neuen Ehepartner Marcus Pretzell bezeichnete er als „Zigeuner der Macht“. Inhaltlich stehe Pretzell für nichts. In Teilen sei die AfD zweifellos unseriös. „Ich frage mich“, sagte Adam, „ob das noch die Partei ist, die ich gewollt habe.“ Doch vor dem Kölner Parteitag trat er aus der Kirche aus.
Kirchen müssen das Gespräch mit der AfD führen und mit deren Anhängern in den eigenen Reihen. Ihr Auftrag verpflichtet sie, ihre Stimme für Menschen in Not zu erheben und für eine Gesellschaft einzutreten, die niemanden ausgrenzt. Darin liegt ein Grund, auch mit denen zu reden, die im Ausschluss und in der Abgrenzung die Zukunft sehen.
Die Kirchen müssen zudem selber offen bleiben für Kritik. Der frühere EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber fragte im April 2017 in der renommierten Berliner Stiftungsrede: „Lege ich mir Rechenschaft darüber ab, wie sich meine Meinungen auf meine Wahrnehmungen der Wirklichkeit auswirken? Wann habe ich zum letzten Mal eine Meinung geändert, weil ich eine Tatsache falsch eingeschätzt habe? Wer über die Protagonisten des postfaktischen Zeitalters schimpft, ist zu solchen Betrachtungen verpflichtet.“
In der Auseinandersetzung mit der AfD müssen die Kirchen diese Kunst pflegen. Deshalb hat Manfred Rekowski, der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Ende 2016 ein Gespräch mit der Parteivorsitzenden Frauke Petry geführt. Anders als der Katholikentag hat der Evangelische Kirchentag 2017 die AfD zum Gespräch eingeladen. Und anders als katholische Bischöfe haben evangelische Kirchenführer die Partei nicht generell aus dem Konsens des Christlichen herausdefiniert. Sie sind stärker in die sachliche Auseinandersetzung gegangen. Das ist der kirchengemäße Weg. Auch wenn dem Kirchentag dabei der Fehler unterlief, sich mit einer unwichtigeren AfD-Vertreterin abspeisen zu lassen, und er der Parteispitze ersparte, sich nach dem Kölner Parteitag zur Kirche zu erklären. Doch Gespräche mit der AfD müssen sein. Auch die katholische Kirche wird daran nicht vorbeikommen. Sie hätte sie besser gleich geführt.