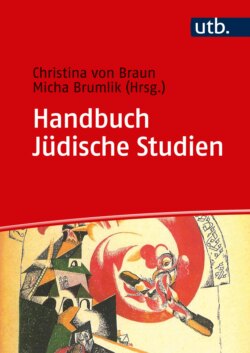Читать книгу Handbuch Jüdische Studien - Группа авторов - Страница 8
ОглавлениеGab es in der griechisch-römischen Epoche ein „Judentum“?
Daniel Boyarin
Heute stellt sich oft die Frage, ob der Begriff „jüdisch“ eher einer Religion oder eher einer kulturellen Gemeinschaft (mit eigenen Gesetzen und Zugehörigkeitsmerkmalen) zuzuordnen ist. In den modernen Gesellschaften lässt sich der Begriff „jüdisch“ auf vielfache Weise auffächern: So gibt es „religiöse Juden“ (unterschiedlicher Ausrichtungen), „kulturelle Juden“ (die nicht in die Synagoge gehen, sich jedoch der Gemeinschaft der Juden zugehörig fühlen) oder auch „psychologische Juden“, wie der Historiker Yosef Hayim Yerushalmi am Beispiel von Sigmund Freud dargestellt hat (siehe hierzu auch den Beitrag von Christina von Braun, S. 15). Für die Antike ist eine solche Auffächerung schon aus dem Grund nicht möglich, weil für diesen Zeitraum kaum zwischen Religion und Kultur unterschieden werden kann. Seit etwa einem Jahrzehnt stellt sich die Forschung auf den Standpunkt, dass es nicht möglich ist, moderne euro-amerikanische Kulturinstitutionen auf antike oder nichtwestliche Gesellschaften zu projizieren. Als Paradebeispiel dafür gilt die „Religion“. Es wird immer deutlicher, dass das Konzept „Religion“ als eine von der „Politik“ getrennte, eigenständige Institution zu vollkommen irreführenden Interpretationen der genannten Kulturen führt. Der folgende Beitrag soll deutlich machen, dass es genauso falsch ist, den Juden der Antike eine „Religion“ zuzuschreiben wie den Römern, den antiken Griechen oder den Indianern. Diesem Gedanken folgend soll weiterhin gezeigt werden, dass es in der Antike kein „Judentum“ in unserem heutigen Sinne gegeben hat, da die Juden selbst zu jener Zeit kein Konzept dieser Art hatten.1 Die Verwendung des Terminus „Judentum“ für jene oder jede andere vormoderne Epoche ist ausgesprochen irreführend, da er unweigerlich suggeriert, es hätte eine separate „religiöse“ Sphäre gegeben, abgetrennt von dem, was wir heute „Politik, Wirtschaft und Gesetz“ nennen.
Das antike Judentum und seine Widersprüche
Ich beginne mit einer kurzen Analyse von Philip Davies’ Standardwerk On the Origins of Judaism,2 schicke aber voraus, dass durch die Annahme dessen, was nachfolgend verworfen werden soll, nämlich die Existenz eines wie auch immer gearteten „antiken Judentums“, übersehen wird, was die bedeutendsten Erkenntnisse dieses Werks sein könnten. Doch beginnen wir mit Davies’ Eröffnungsthese:
Das antike Judentum ist die religiöse Matrix der drei monotheistischen (oder monarchistisch-theistischen) Weltreligionen und neben der klassischen griechisch-römischen Kultur einer der beiden Ursprünge der westlichen Zivilisation.3
Das Problem liegt meines Erachtens bereits bei der Matrix dieses Satzes an sich, nämlich am Konzept „antikes Judentum“. Meint Davies hier den Kult des Alten Israel, wie er im Zweiten Tempel praktiziert wurde, also den Kult des Tempelstaates, den Jahud? Wenn das wirklich das „Judentum“ war, wie ist es dann möglich, dass dieses „Judentum“ sowohl die Matrix des „Judentums“ als auch einiger anderer Gemeinschaften ist, die nicht „Judentum“ genannt werden? Haben wir es hier mit einem ehelichen und zwei unehelichen Kindern zu tun? Diese Position vertritt Davies eindeutig nicht, denn schon im nächsten Satz merkt er an: „Nur weil das Judentum den Namen der Mutter annahm, ist es seinen Vorgängern deshalb nicht typologisch näher.“ (Das Samaritertum seiner Meinung nach hingegen schon.) In diesem Fall stellt sich die Frage, weshalb die „Mutter“ überhaupt als „Judentum“ bezeichnet werden soll, erscheint doch dieser Begriff in keiner der Quellen, die das Alte Israel erwähnen. Der Versuch, dessen angebliche „Religion“ als Judentum zu bezeichnen und somit zu suggerieren, dass die rabbinischen, mittelalterlichen sowie die modernen Arten des Judentums (selbst moderne Konstrukte) die direkten, echten (also typologisch nächsten) Nachkommen dieses Vorläufers sind, ist zweifellos ein legitimes apologetisches Unterfangen, doch hält es auch einer wissenschaftlichen Untersuchung stand? Schließlich scheint mir auch problematisch, das Samaritertum auf das „antike Judentum“ zurückzuführen, bezeichnen sich die Samariter doch nicht einmal selbst als Ioudaioi, sondern als Israeliten.
Natürlich ist Davies’ Darstellung viel zu komplex, als dass nach seiner Vorstellung das antike Judentum nur eine einzige Entität gewesen wäre (so spricht er mit Verweis auf das äthiopische Henochbuch von „Arten des Judentums“), doch die Frage bleibt: Weshalb sollte überhaupt von Judentum gesprochen werden? In der Tat führt die Verwirrung, die diese Spurensuche stiftet, zu folgenden Äußerungen: „Wenn man das ‚frühe Judentum‘ definieren will, muss man sich auch fragen, ‚wer war Jude‘“?4 Indem Davies die Frage so formuliert, ändert der Terminus „Judentum“ seine Bedeutung in seinem Text – von der Bezeichnung einer angeblichen „Religion“, aus der andere angebliche „Religionen“ hervorgegangen sind, zu einer wie auch immer gearteten Volkszugehörigkeit. Am Schluss kommt er zudem zu folgender (bahnbrechender) Erkenntnis:
Das Ergebnis dieser […] Entwicklungen ist die nunmehr breit (wenn auch zugegebenermaßen nicht einstimmig) akzeptierte Wahrnehmung, dass das „Judentum“ in dem Zeitabschnitt vor dem Fall des Zweiten Tempels (und faktisch auch noch lange danach) in Wirklichkeit eine Zusammenstellung kultureller und religiöser Einstellungen war. Diese überschnitten sich zuweilen oder standen zueinander im Wettstreit; sie reichten von dem, was Soziologen heute „Zivilreligion“ nennen, bis zu ziemlich isolierten Sekten.5
Von „Judentum“ kann also nur in Anführungsstrichen gesprochen werden – oder könnte es sich um einen Hinweis darauf handeln, dass diese Bezeichnung von anderen verwendet wurde? Wenn diese Gruppe in der Antike nicht „Judentum“ genannt wurde (wie nachfolgend gezeigt werden soll, hatte Ioudaismos eine ganz andere Bedeutung sowohl in den Büchern der Makkabäer als auch bei Paulus, die einzigen beiden antiken Kontexte, in denen dieser Begriff auftaucht) – woher kommt dann der Name „Judentum“ für diese Gruppe? Die Frage, wann sich „eine Zusammenstellung kultureller und religiöser Einstellungen“ formierte, ist ein weiteres gewichtiges analytisches Problem, besonders, wenn zumindest einige dieser Einstellungen im Widerstreit zu den anderen stehen.
Davies ist sich dieser Probleme wohl bewusst: Moderne Wissenschaftler, die das Konzept des einzig wahren, ewigen Judentums zweifellos de-essentialisieren und von „Judaismen“ sprechen, sieht er als feste Bestandteile eines Systems von „Judaismen“, die miteinander konkurrieren, oder eines Genus, der sich aus verschiedenen „judaistischen Spezies“ zusammensetzt. Gleichzeitig wirft er denselben Wissenschaftlern vor, sich nicht die Mühe gemacht zu haben, den Begriff „Judentum“ zu definieren. Wie Davies selbst anmerkt, ist die Definition des Judentums als Genus mit verschiedenen judaistischen Spezies ebenso problematisch wie die Bedeutung, die sich aus der Vorstellung ergibt, dass ein einziges Judentum individuelle Spezies hervorbrachte, die dann die Gemeinschaften bildeten. Im Hinblick auf eine andere Studie, die scharf zwischen dem Judentum als ungebrochener „religiöser Tradition“ und den „Hellenisierern“ unterscheidet, bemerkt Davies zu Recht: „Sind die Judentümer des Philon oder im 2. oder 4. Buch der Makkabäer traditioneller oder hellenistischer Art? Wenn solche Mischungen in Ägypten möglich waren, warum dann nicht in Palästina?“6
Die Frage, ob „das Judentum“ die Religion des „jüdischen Volkes“ sei oder ob zum „jüdischen Volk“ gehöre, wer sich zu dieser Religion bekennt, beantwortet Davies dahingehend, dass viele Juden in der Antike Konvertiten gewesen seien, die freiwillig oder unter Zwang zu einer „bereits bestehenden Religion“ übertraten.7 Die Ansatzpunkte, auf die sich diese Feststellung stützt, werfen eine ernsthafte Frage auf. Wie jüngst dargestellt, war die Frage der Konversion in der Zeit des Zweiten Tempels und selbst noch einige Zeit später alles andere als geklärt.8 Für bedeutende Gruppen (wie etwa für den Autor des Buchs der Jubiläen) trifft keiner dieser Ansätze zu: Jude ist, wer als Jude geboren ist, nicht mehr und nicht weniger (wenn auch für einige dieser Gruppen ein Junge, der nicht am achten Tag nach der Geburt beschnitten wurde, kein Jude war und auch nie einer werden konnte!). Überdies, was soll man sich unter einer Religion vorstellen, die „bereits existiert hat“, wenn sie von niemandem im Volk je so benannt wurde, und wie können Konvertiten ein Teil davon sein, wenn ein Großteil der Gläubigen die Möglichkeit der Konversion gar nicht anerkannte?
Davies kennt die Problematik, die Existenz einer kulturellen Einheit vorauszusetzen, wenn diese behauptete Einheit weder direkt noch indirekt in der Sprache der Mitglieder dieser Gemeinschaft benannt wird: „Erst wenn ein Konzept wie ‚Judentum‘ ins Bewusstsein rückt, das heißt in Begriffe gefasst wird, kann auch erklärt werden, was diese Begriffe bedeuten […] Doch das bewusste ‚-tum‘ ist eine Vorbedingung oder zumindest ein Symptom für den Eintritt von ‚Judentum‘ in das historische Bewusstsein.“ Die Frage ist also eine philologische: Davies legt dar, dass dieses bewusste Konzept in einem Werk entwickelt wurde bzw. belegt ist, das als das 2. Buch der Makkabäer bekannt wurde. Insofern könne von einer Einheit gesprochen werden, die „Judentum“ genannt wird. Wie aber kann man feststellen oder behaupten, dass der extrem seltene, kaum belegte hellenistische Begriff Ioudaismos„Judentum“ bedeutet und nicht „Loyalität gegenüber dem Gemeinwesen und den Bräuchen des Volkes von Judäa“?
Ioudaismos ist nicht gleich „Judentum“
Steve Mason hat zweifellos Recht, wenn er behauptet, dass die sogenannte Konversion zum sogenannten Judentum (sofern sie überhaupt anerkannt wurde) ein – wie gesagt freiwilliger oder erzwungener – Aufnahmeprozess in ein der Nation analoges Gebilde war – ein Genos oder Ethnos (alle diese Begriffe in ihrer antiken Bedeutung). Was hat Religion damit zu tun? Mason schreibt dazu Folgendes:
Es gibt ein simples Modell der Ethnizität (Athener sind Athener, Tyrianer sind Tyrianer etc.), aber in diesem Fall – wie es Josephus auch in Gegen Apion betont – sind die Judäer anders als die Athener und Spartaner, die streng auf ihre Staatsbürgerschaft achteten. Im Gegensatz dazu nahm Moses bereitwillig jeden auf, der bereit war, unter judäischen Gesetzen zu leben. Philo macht dieselbe Aussage: Wer seine Familie, seine Polis, seine Gesetze und seine Bräuche gegen unsere eintauscht, sollte als unser Fleisch und Blut angenommen werden. Andere zeichnen nach, wie die Idumäer zu Judäern wurden, weil sie die judäischen Gesetze annahmen. Epiktet, Tacitus und Juvenal kommentieren dieselbe Erscheinung als Außenstehende: Leute anderer Ethnizität werden merkwürdigerweise zu Judäern, indem sie den ganzen Satz ihrer normalen Identitätsmerkmale aufgeben (was aus der Sicht von Tacitus nicht wünschenswert ist). Es geht hier nicht um religiöse Konversion, sondern um den Wechsel der Ethnie, was in der Tat bemerkenswert ist (man hätte dasselbe tun können, indem man Römer wurde, außer dass die römische Staatsangehörigkeit die ursprüngliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft nicht in dem Maße gemindert hätte, wie man die Traditionen der eigenen Vorväter hätte aufgeben müssen, um Judäer zu werden).
Wie Mason weiter ausführt, zeigt auch der folgende Text von Josephus Flavius (Der Jüdische Krieg 7,45), dass der Autor die Konversion nicht im christlichen Sinne interpretierte:
Ferner übte auch ihre Religion [thrēskeiai im griechischen Original] stets eine große Anziehung auf viele Griechen aus, die durch deren Annahme in gewisser Hinsicht selbst wieder ein Stück jüdischen Volksthums wurden.9
Zunächst beweist der Plural thrēskeiai, dass es sich hier nicht um Judentum handelt, also nicht um eine Religion, sondern um die Ausübung von Kulten verschiedener Art (einschließlich möglicherweise auch der Einhaltung von Speisegesetzen wie Kaschrut, des Schabbat u. ä.). Noch deutlicher schließt die Aussage „die durch deren Annahme in gewisser Hinsicht selbst wieder ein Stück jüdischen Volksthums wurden“ jede Vorstellung einer religiösen Konversion aus, ganz im Gegensatz zu einer „ethnischen“ Verbindung, da man bei der Konversion zu einer „Religion“ nicht in gewisser Hinsicht, sondern ganz Teil der Gruppe und der Institution wird, der man sich anschließt.
Es gab also Mason zufolge kein „Judentum“, zu dem man konvertieren konnte. Was also ist dann im 2. Buch der Makkabäer (und in einigen verwandten Texten) mit Ioudaismos gemeint? Mason zeigt, dass dieser Begriff weder die angebliche jüdische Religion noch die Ausübung des Kults der Juden benennt. Diese These zur Bedeutung des seltenen hellenistischen-jüdischen Wortes Ioudaismos, das nur in einem Kontext erscheint, ist jedoch entscheidend, da Davies sein äußerst anspruchsvolles System der Suche nach den Ursprüngen des „Judentums“ genau auf diesen Ioudaismos aufbaut. In seinen Augen ist Jüdischsein vor dem Auftritt des Ioudaismos (und hier schließt er sich Daniel Schwartz an) „[…] grundsätzlich eine Frage der Lokalität oder der Rasse [Ethnos oder Genos, DB]. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass es unter ihnen mehr Übereinstimmung bei einem Glauben oder einem Brauch gab als etwa unter allen Franzosen oder allen Frauen“.10 Doch nach dieser angeblichen Transformation gebe es durchaus Grund zu genau dieser Annahme. Davon leitet Davies drei Phasen der Entwicklung des „Judentums“ ab: 1. eine vorreflektive Zeit, in der „die judäische Kultur […] weder homogen war noch konzeptualisiert wurde“; 2. „‚Judentum‘ als judäisches Kulturkonzept“; 3. „‚Judentum‘ neu definiert als Religion, Kult oder Philosophie – Glauben und Ausübung, nicht Bräuche“.11 Er löst also das Logikproblem, denn nun wird klar, dass das Juden-tum der Vorläufer der ohne Bindestrich geschriebenen Judaismen ist. Dazu gehört auch das Samaritertum, das dem Judentum mit Bindestrich näher ist als der späteren Definition von „Judentum“. Dasselbe gilt für das Christentum und den Islam.
Wenn jedoch Ioudaismos nicht „Juden-tum“ bedeutet, wie Mason bereits festgestellt hat – von „Judaismus“ ganz zu schweigen – und wie nachfolgend ausführlich dargelegt werden soll, dann kann nach Davies’ eigenen methodologischen Schlussfolgerungen vor einem bestimmten Zeitpunkt in der Moderne nicht von einem „Judentum“ gesprochen werden (oder zumindest wären damit nicht die Juden gemeint!),12 denn erst dann „trat das Konzept des ‚Judaismus‘ ins Bewusstsein, also wurde erst konzeptualisiert“, und „der bewusste ‚-ismus‘ ist die Voraussetzung oder zumindest das Symptom des Auftauchens des ‚Judaismus‘ im historischen Bewusstsein“. Es kann somit kein Judentum geben, solange es nicht konzeptualisiert und benannt wurde. Damit bleibt uns nur noch der philologische Disput.
Der Fall des 2. Buches der Makkabäer
Vor einigen Jahren trug der Rabbiner und Religionsforscher Yehoshua Amir Quellenmaterial zum Begriff Ioudaismos zusammen, wie er von Juden benutzt wurde. Angesichts der insgesamt sieben belegten Erwähnungen, davon vier in ein und demselben Kontext, meint Amir: „Gestützt auf die erste Durchsicht des Materials kann behauptet werden, dass das Wort Iουδαϊσμός den Komplex von Verhaltensweisen repräsentiert, der sich durch die Tatsache des Jüdischseins ergibt, und dass dieses Verhalten einen Wert darstellt, für den es sich zu kämpfen und sogar zu sterben lohnt.“13 Amir beleuchtet die hinlänglich bekannte Tatsache, dass Nomen mit der Endung -ismos als von Verben mit der Endung -izō abgeleitete Verbalnomen recht häufig im Griechischen vorkommen. Die wichtige Frage wäre dann, was das Verb bedeutet, von dem das Nomen abgeleitet wurde. Es gibt zahlreiche izō-Verben, die von eigentlichen Substantiven abgeleitet sind und bei denen das Verb das Verhalten des Mitglieds einer Gruppe bezeichnet oder die Identifizierung mit einer Gruppe. So würde etwa mēdizō bedeuten, sich wie ein Medäer zu verhalten oder für die Medäer Partei zu ergreifen. Amir legt dar, dass damit in der Regel jemand gemeint ist, der selbst nicht Medäer ist, und dass es sich häufig um einen herabsetzenden Begriff handelt.14
Hellenismos hingegen bezeichnet etwas, das die Griechen anstreben, nämlich die korrekte Verwendung der griechischen Schriftsprache, während mit barbarismos das Gegenteil gemeint war (eine Verwendung, die im Englischen noch geläufig ist, indem etwa ein Irrtum als „barbarism“ bezeichnet wird). Der jüdische Gebrauch dieses Terminus ist dagegen ein anderer: Im 2. Buch der Makkabäer bezeichnen Juden andere Juden, die sich wie Griechen verhielten und sich der griechischen Sache verschrieben hatten, als Hellenismos,ähnlich wie Griechen den Ausdruck Medismos verwenden. Amir zufolge ist die Entwicklung dieser Verwendung von Hellenismos darauf zurückzuführen, dass der jüdische Autor einen Ausdruck benötigte, der „sämtliche Merkmale der hellenistischen Kultur zu einem Ganzen verbindet“, da er Ioudaismos für die Judäer verwenden wollte und ein Wort brauchte, der das Gegenteil von Ioudaismos bezeichnet. Ioudaismos ist, laut Amir, ein singulärer Begriff dafür, dass ausschließlich die Judäer als einziges Volk im gesamten Mittelmeerraum es für notwendig hielten, einen Begriff für sämtliche Merkmale ihrer eigenen Kultur zu prägen. Mit anderen Worten stand also am Anfang das Bedürfnis nach einem Wort, das „Judaismus“ bedeutet und daher Hellenismos zum Gegenstück hatte.15
Amirs Rekonstruktion wirft einige Zweifel auf. Zunächst einmal lehnt Steve Mason Amirs Behauptung ab, bei Iuodaismos handle es sich um einen Begriff mit singulärer Bedeutung. Iuodaismos unterscheide sich in seiner Bedeutung nicht von den andere Ethnien betreffenden-ismos-Verbalnomen. Amirs Behauptung, wonach Ioudaismos insofern allein dastehe, als es sich um das einzige Nomen in der gesamten Antike handle, das eine ganze Kultur oder Religion bezeichne, beanspruche etwas viel für ein Wort, das außer im 2. und 4. Buch der Makkabäer in keinem einzigen hellenistisch-judäischen Text vorkomme. Griechisch-römische Beobachter der Ioudaioi hätten den Begriff zudem nie benutzt, und selbst im Hebräischen und im Aramäischen der damaligen Zeit habe sich keine Parallele dazu gefunden. Eine bessere Erklärung für die Seltenheit des Begriffs besteht, angesichts der (oben erwähnten) Verwendung paralleler Formen, darin, dass die besonderen Umstände nur selten eintraten, die nach der Verwendung dieses stets zu negativen Konnotationen neigenden Wortes verlangten.16 Im Gegensatz zu Amir versteht Mason Ioudaismos als Rückbildung von Hellenismos. Seiner Interpretation zufolge bedeutet Ioudaismus schlicht, sich wie ein Judäer zu verhalten.
In der vorchristlichen Antike taucht der Terminus Ioudaismos im Wesentlichen nur in einem literarischen Kontext auf, nämlich in den Berichten über den Widerstand der Makkabäer gegen den Hellenismos. Auf eine frühere These17 aufbauend, legt Mason dar, dass das Wort Ioudaismos nur in diesem spezifischen literarischen und historischen Kontext erscheint, weil es auch nur in diesen und keinen anderen Kontext der jüdischen Antike hineinpasst. Zudem passt es zu einem Paradigma anderer griechischer Ausdrücke, die sich auf dieselbe Weise als Verbalnomen von bestimmten Verben ableiten und nichts mit der Bezeichnung einer Religion zu tun haben.18 Ioudaizō würde dann entsprechend bedeuten, „sich wie ein Judäer zu verhalten“, und das daraus gebildete Verbalnomen Ioudaismos wäre dann schlicht die substantivierte Form dieses Verbs, also das „Sich-wie-ein-Judäer-Verhalten“, genau wie Hellenismos bedeutet, wie ein Grieche zu handeln, zu sprechen und zu schreiben. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie oft diese Wortkreation damals im Griechischen verwendet wurde, genügt das folgende humoristische Beispiel: Kenneth Dover erwähnt die Entstehung des Worts „euripidaristophanizein“ („wie Euripides und Aristophanes handeln“), das von einem Komödiendichter erdacht wurde, der sich über den intellektuellen Anspruch von Aristophanes lustig machte.19 Das hypothetische Verbalnomen wäre dann euripidaristophanismos, was wohl kaum eine Institution bezeichnet. Mason stützt sich also auf eine solide lexikalische komparative Grundlage, wenn er die Übertragung dieses höchst produktiven griechischen Paradigmas auf eine einzelne Form – Ioudaismos – ablehnt.
Wie Seth Schwartz zutreffend bemerkt, trifft Masons Interpretation in Kontexten wie in 14,37 durchaus zu. Im folgenden Zitat sollte nur der von Schwarz verwendete Begriff „Judentum“ durch den fraglichen Begriff Ioudaismos ersetzt werden:
Es ward aber dem Nikanor angezeigt einer aus den Ältesten zu Jerusalem, mit Namen Razis, dass er ein Mann wäre, der das väterliche Gesetz lieb und allenthalben ein gutes Lob und solche Gunst unter seinen Bürgern hätte, dass ihn jedermann der Juden Vater hieße. Auch war er vor dieser Zeit darum verklagt und verfolgt gewesen, und hatte Leib und Leben männlich gewagt für den Ioudaismos.20
In diesem Ausschnitt ist deutlich zu erkennen, wie eine Entscheidung für den Ioudaismos einem Bekenntnis zur Lebensart der Judäer und deren Gemeinwesen, ja selbst zu einer Erneuerungsbewegung, die solche Gefühle bei den Abtrünnigen neu entfachen soll, gleichkommt. In 8,1 heißt es hingegen: „Aber Judas Makkabäus und seine Gesellen gingen heimlich hin und wieder in die Flecken, und riefen zuhauf ihre Freundschaft und was sonst bei der Juden Glauben geblieben war […].“
Seth Schwartz warnt davor, den Begriff als Bekenntnis zur Erneuerungsbewegung zu interpretieren.21 Daraus sollte jedoch nicht geschlossen werden, dass Ioudaismos „etwas sehr stark wie Judentum“ bedeutet,22 denn das würde eine lexikalisch und grammatikalisch singuläre Entwicklung der Vokabel und des ihr zugrunde liegenden Paradigmas ausschließlich in diesem Kontext der gesamten griechischen Literatur voraussetzen. Wenn überhaupt, können sie in beiden Fällen schlicht als „der Lebensweise und der Sache der Juden treu ergeben“ übersetzt werden. Im ersten Fall riskiert Razis Leib und Leben für die jüdische Lebensweise. Im zweiten Fall sind mit Personen, die im Ioudaismos verblieben, diejenigen gemeint, die dem politischen und kulturellen Leben der Juden treu geblieben sind. Ioudaismos bedeutet also die Ausübung einer solchen Loyalität. Die korrekte Übersetzung wäre „sind beim Judaisieren geblieben“ oder vielleicht besser „beim Jüdischsein“. Das hat mit „Religion“ nicht mehr zu tun als etwa das „Attikaisieren“, also „sich zum Verhalten und zu den Bräuchen auf Attika“ zu bekennen. Einmal mehr sei hier betont, dass es sich nicht um ein abstraktes, eine Institution bezeichnendes Nomen handelt, sondern um ein Verbalnomen, das für eine Handlung oder eine Gruppe von Handlungen steht (wie etwa die „Barbaren“ austreiben oder die Gebote beachten).
Gegen Amirs These spricht auch ein weiterer Grund: Die Annahme, dass Ioudaismos als singulärer Ausdruck zuerst geprägt wurde und sich davon dann die geläufige Wortprägung Hellenismos ableitete, erscheint unlogisch. Viel eher dürfte Masons Vermutung zutreffen, dass der Begriff Hellenismos zuerst existierte und Ioudaismos von diesem abgeleitet wurde. Der semantische Effekt ist aber ein anderer, als von Mason postuliert. Wenn nämlich davon ausgegangen wird, dass Judäer Hellenismos als Charakterisierung ihrer Landsleute in Analogie zur griechischen Verwendung von Medismos in Bezug auf andere Griechen nutzen, dann wird deutlich, dass es sich hier um den primären Ausdruck einer binären Gegenüberstellung handelt. Angeblich abtrünnigen Juden wurde Hellenismos vorgeworfen, genau wie abtrünnigen Griechen Medismos vorgehalten wurde. Hellenismos bedeutet also, sich wie ein Grieche zu verhalten und dem Griechentum gegenüber loyal zu sein. Ioudaimos wäre dann das davon abgeleitete Gegenteil, also sich loyal zur jüdischen Lebensweise und der jüdischen Gemeinschaft zu verhalten.23 Diese Verwendung schien nur den Judäern vorbehalten zu sein, doch es handelt sich um eine natürliche Entwicklung der besonderen Umstände der makkabäischen Konflikte. Statt also davon auszugehen, dass Hellenismos von den Juden als Gegenstück zu Ioudaismus geprägt wurde, behaupte ich, dass Ioudaismos als Gegenstück zur hellenisierenden Abtrünnigkeit die judaisierende Loyalität bezeichnete. Dies ist aber gewiss kein Beweis für ein angeblich neues Bewusstsein der Juden von dieser Institution des „Judentums“. Der Begriff passt gut in sämtliche (vorchristlichen) Kontexte und umgeht auch die Einschränkungen von Schwartz, der die Loyalität gegenüber dem Jüdischen (dem Judäischen) bzw. das Festhalten daran nicht auf die Religionsangehörigkeit reduziert, die wir heute Judentum nennen. Da sämtliche Vertreter des Paradigmas solcher Nomen, wie etwa der oben genannte Medismos – „das den Persern Zuneigende“ –, sowie der Attikismos – „das den Athenern Zuneigende“ – Gerundien und keine abstrakten Substantive sind, gibt es keinen Grund, Ioudaismos nicht auch als solches Gerundium aufzufassen. Im Griechischen sind zwar nur Ioudaismos und Hellenismos (im Sinne von „Schreiben wie ein Grieche“) positiv belegt, aber sie sollten dennoch als „Judaisieren“ verstanden und übersetzt werden.
Der antike Ioudaismos muss also als Glied dieses semantischen und morphologischen Paradigmas verstanden werden. Die seltene Verwendung des Begriffs in den jüdischen Quellen hängt mit der Tatsache zusammen, dass es sich eben nicht um eine allgemeine Bezeichnung für etwas Zusammenfassendes wie das moderne Judentum handelt. Diese Interpretation stützt sich auf alle Erwähnungen in den Büchern der Makkabäer. Masons Ansatz, den Begriff „Judaismus“ bei keiner dieser Erwähnungen als Abstraktion, System oder Institution zu sehen, ist schlüssig, doch wird dabei aus Judaisieren eine „Rückführung jener, die fremde Wege gegangen sind“. Ein ‚Judaisieren‘ oder eine ‚Judaisierung‘, die der Autor des 2. Buches der Makkabäer programmatisch als ‚Iουδαϊσμός‘ bezeichnet.24 Allerdings ist das nicht die einzige Alternative zur Interpretation von ‚Iουδαϊσμός‘ als Bezeichnung für eine Religion. Vermutlich führte einfach das „Sich-dem-Hellenismos-Verweigern“ zur Ableitung Ioudaismos.
Die letzte Verwendung des Wortes im 2. Buch der Makkabäer bestätigt diese Behauptung. Zum ersten Mal überhaupt taucht das Wort in Abschnitt 2:21 auf: „[…] die himmlischen Erscheinungen, die denen zuteil wurden, die für das Judentum [Ioudaismos] ruhmvoll und als Helden stritten.“25 Jenen, die miteinander um das Judentum [Ioudaismos] wetteiferten, sollen also himmlische Erscheinungen zuteil geworden sein. Ioudaismos meint demnach das Wetteifern um die Hingabe zur Lebensweise der Judäer und die Parteinahme für ihren Kampf gegen ihre Unterdrücker, die „Barbaren“.26 Nur ein vorgefasstes Konzept des Ioudaismos als Abstraktum oder die Bezeichnung einer Institution könnte hier dazu führen, sich ihn als „Judentum“ vorzustellen.
Das „Judentum“ des Paulus
Diese Interpretation erklärt auch die Verwendung von Ioudaismos in den Paulusbriefen. Wenn der Apostel behauptet, er sei früher sehr im Ioudaismos fortgeschritten gewesen, meint er sicher keine abstrakte Kategorie oder eine Institution, sondern die jüdische Treue zum traditionellen Brauchtum der Juden, das von seinem Zeitgenossen Josephus als „das Angestammte [die Traditionen] der Ioudaioi“ beschrieben wird (τὰ πάτρια τῶν Iουδαίων; [Ant 20.41 und passim]). Auch das könnte schlicht als jüdische Religion gedeutet werden, wäre da nicht die Tatsache, dass auch Thucydides diesen Begriff verwendet. Er schreibt, die medezierenden Platäer wurden beschuldigt, „ihre angestammten Traditionen aufzugeben“ (παραβαίνοντϵς τὰ πάτρια; [Thucydides 3.61.2]).27 Dass auch Paulus den Begriff in diesem Sinne verwendet, zeigt Masons Beobachtung, wonach „Paulus Petrus verurteilt, weil Petrus wie ein Fremder und nicht wie ein Judäer lebe (έθνικῶς καὶ οὐχὶ Iουδαϊκῶς), dadurch zwinge er die Fremden, sich zu judaisieren“ (τὰ ἔθνη ἀναγκάζϵις Iουδαΐζϵιν; [Gal 2,14]) – also einer Kulturbewegung anzugehören, die Paulus eng mit der Beschneidung und der Beachtung der judäischen Gesetze verbindet (2.12,21).28 Da Ethnisierung gewiss nicht mit der Ausübung einer Religion gleichzusetzen ist, kann das hier auch nicht für das Judaisieren gelten und somit auch nicht für das oft von diesem Verb abgeleitete Nomen Ioudaismos.
Die vorliegenden Verwendungen von Ioudaismos scheinen die Interpretation von Ioudaismos als Verbalnomen, also als Praxis und nicht als Institution, ebenfalls zu bestätigen. Paradoxerweise wurde die Verwendung, die Paulus davon in den Galaterbriefen macht, in der Regel als Beweis für das genaue Gegenteil gewertet. Die zentrale Stelle ist der Brief an die Galater, Kap. 1,13–14, wo Folgendes steht [die Worte, die im Folgenden diskutiert werden, bleiben unübersetzt]:
Ihr habt ja von meinem einstmaligen anastrophe im Ioudaismos gehört: dass ich nämlich die Gemeinde Gottes maßlos (= wütend) verfolgt habe und sie zu vernichten suchte und dass ich es an Leidenschaft für den Ioudaismos vielen meiner Altersgenossen in meinem Volk zuvorgetan habe, indem ich ein ganz besonderer Eiferer für die von meinen Vätern überkommenen Überlieferungen war.
Das Wort anastrophe wird gewöhnlich mit „Leben“, hier mit „einstmaligem Leben“ übersetzt. Mason behauptet: „In Anbetracht dessen, dass das begleitende Nomen ἀναστροϕή stärker ist als ‚[mein einstmaliges] Leben‘, wie es oft übersetzt wird, sollte es eine gewisse Form von ‚Hang‘ oder ‚Hinwendung‘, eine ‚Rückbesinnung‘ auf etwas oder eine Beschäftigung mit etwas andeuten. Der in 1,14 erwähnte Eifer bestätigt diese Bedeutung.“29 „Einstmaliges Leben“ gibt in der Tat eine vorgefasste Meinung wieder und stimmt nicht mit den häufigsten Verwendungen dieses Wortes im Griechischen überein. Meines Erachtens eignet sich die Übersetzung „Benehmen“ besser, wie sie beispielsweise bei Tobias 4,14 zu finden ist: πρόσϵχϵ σϵαυτῷ, παιδίον, ῶν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου καì σθι πϵπαιδϵυμένος ἐν πάση ὰναστροϕῇ σου, wobei der letzte Satz gut als „Benimm dich wohlerzogen in deinem ganzen Wandel“ übersetzt werden kann, was wiederum dem ersten Satz entspricht, dessen Übersetzung „Gib’ acht auf dich, […], in allem, was du tust“ lauten würde. Paulus meinte demnach sein früheres Solidarisieren mit den Judäern, namentlich die Verfolgung der Gemeinde Gottes. Die Verwendung von Ioudaismos im zweiten Vers hebt diesen Punkt noch stärker hervor. Man zeichnet sich nicht durch Leidenschaften aus in einer Institution, etwa religiöser Art (außer vielleicht, um darin aufzusteigen, was hier offensichtlich nicht passt), sondern durch die Praxis des Judaisierens, in der sich Paulus besonders hervortat, weil er größeren Eifer zeigte als andere. Schließlich muss die Verwendung, die Paulus vom Verbalnomen Ioudaismos macht, auch mit Blick auf seine Verwendung des Verbs interpretiert werden. Wie oben erwähnt, schimpft Paulus in den Galaterbriefen 2,14:
Als ich jedoch sah, dass sie nicht den rechten Weg in Übereinstimmung mit der Wahrheit der Heilsbotschaft wandelten, sagte ich zu Kephas offen im Beisein aller: ‚Wenn du, der du doch ein Jude bist [Ioudaios], nach heidnischer [ethnikos] und nicht nach jüdischer Weise [Ioudaikos] lebst, wie kannst du da die Heiden zwingen wollen, die jüdischen Bräuche (= Lebensform) zu beobachten [zu judaisieren]’?
Hier ist also klar gemeint: Es soll nach judäischen und nicht nach heidnischen Bräuchen gelebt werden. Ioudaismos, das von diesem Verb abgeleitete Nomen Judaisieren bedeutet dann entsprechend: nach judäischen/jüdischen Bräuchen zu leben und nicht Mitglied einer Institution zu sein, die „Judentum“ genannt wird.
Ein weiterer Grund, dass Ioudaismus bei Paulus nicht eine jüdische Religion bezeichnen konnte, ist folgender: Paulus betrachtete sich zeit seines Lebens als Jude. Wenn also mit Ioudaismos die Gesamtheit des judäischen Brauchtums und des judäischen Glaubens oder die jüdische Religion gemeint wäre, würde sich Paulus in diesem Vers selbst davon ausschließen. Wenn aber Paulus davon ausgeschlossen wäre, könnte Ioudaismos schlicht nicht als die vermeintliche jüdische Religion oder selbst als Bezeichnung für die Gesamtheit der Verrichtungen der Juden interpretiert werden. In seinen Schriften muss damit also die (von ihm abgelehnte) Befolgung der Gebote der Bibel gemeint sein. Ioudaismos, das „Judäisieren“ scheint also bei all diesen Erwähnungen zu bedeuten: sich (mit Eifer) der Praxis (der Traditionen der Vorväter) der Judäer hingeben. Jede andere Interpretation (wovon einige nur im jeweiligen Kontext möglich sind) würde heißen, die spätere Bedeutung von -ismus-Begriffen, wie etwa die Bezeichnung von Institutionen, zu adoptieren und sie anachronistisch auf Ioudaismos anzuwenden.
Kein Wort – kein Konzept
Mason schlussfolgert damit richtig:
Die Tatsache, dass die fünf Erwähnungen von Iουδαϊσμός in den jüdisch-judäischen Schriften weitgehend auf einen einzigen kreativen Autor zurückgehen, entweder Jason von Kyrene oder der Verfasser seiner Epitome, die das Wort als ironisches Gegenstück zu Eλληνισμός prägten, sollte uns davor warnen, das Wort so zu verwenden, als ob es sich um eine generelle Bezeichnung der gesamten Kultur, des gesamten Rechtssystems und der „Religion“ der Judäer handelte. Abgesehen vom Kontext der Bedrängnis durch die Hellenisierer und späterer christlicher Kreise, sahen antike Autoren keinen Anlass für dessen Verwendung, teilweise offenbar wegen des abschätzigen Nachklanges der Medismos-Familie, der Iουδαϊσμός auch angehaftet hätte, wenn es nicht im Kontrast zum klar negativ belegten Eλληνισμός benutzt worden wäre.30
Das überzeugendste von Masons Argumenten scheint das Argument der Seltenheit zu sein. Gäbe es eine verbreitete Bezeichnung für die Gesamtheit der judäischen „Verhaltensweisen, die der Tatsache geschuldet sind, dass jemand jüdisch ist und dass diese Verhaltensweisen einen Wert darstellen, für den es sich zu kämpfen und sogar zu sterben lohnt“, dann ist nicht einzusehen, weshalb es nur in so wenigen und so speziellen Kontexten wie im 2. Buch der Makkabäer und in sehr wenigen und sehr spezifischen anderen Kontexten zu finden ist.
Dieses gewichtige Argument der Nichterwähnung kann gewissermaßen noch positiv verstärkt werden. Der Historiker Duncan MacRea, der sich mit römischer Geschichte befasst, untersucht ein ähnliches (oder zumindest analoges) Problem der römischen Historiographie, nämlich die angebliche Tradition des Antiquarianismus, die einigen römisch-republikanischen Schriftstellern – besonders Varro – im Widerspruch zur antiken Historiographie zugeschrieben wird. Nachdem er gezeigt hat, dass es im antiken Latein keinen Terminus für Antiquarianismus gibt und dass ein solcher Begriff erst im 15. Jahrhundert bei frühen modernen Gelehrten auftaucht, bemerkt MacRea: „[…] doch die These, dass es keinen römischen Antiquarianismus gab, ist nicht nur nominalistischer Art, nämlich dass die Römer kein Wort dafür hatten. Hier soll vielmehr dargelegt werden, dass sie auch kein Konzept dieser Art hatten.“31 Eine nähere Betrachtung von MacReas deutlicher Behauptung wird uns helfen, die These dieses Abschnitts zu verdeutlichen.
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass MacRea den Begriff „nominalistisch“ hier sehr weit fasst, wenn nicht gar metaphorisch verwendet. Man muss kein Nominalist sein und behaupten, dass sämtliche Kategorien nur dann existieren, wenn sie auch entsprechend benannt sind (z. B. „Hunde“, „Bäume“), um darzulegen, dass es für die Welt des Menschen, die Welt der menschlichen Klassifikationen menschlicher Dinge schwer vorstellbar ist, wie ein Konzept ohne Bezeichnung existieren kann. Genau das möchte ich im nächsten und letzten Abschnitt darlegen. Im vorliegenden Abschnitt soll aber, gestützt auf MacReas zweites Argument, erläutert werden, dass das Konzept „Religion“, und damit des „Judentums“, auch bei den griechischjüdischen Autoren nicht existierte.
Bevor ich weiterfahre, möchte ich mich kurz mit einem Irrtum und einer falschen Fährte in diesem Zusammenhang beschäftigen. Der Philosoph Malcolm Lowe behauptet, dass, trotz des Fehlens des Begriffs „Religion“ im Judäisch-Griechischen, das Konzept dennoch existiert:
Hier liegt das größte Problem von Masons Ansatz. Der zweite Abschnitt seines Aufsatzes von 2007 trägt den Titel „Auf der Suche nach Religion in der Antike [Searching for Ancient Religion] und ist der These gewidmet, dass ‚das Konzept der Religion, das unserer Perspektive und unserer Geschichtsforschung zugrunde liegt, keine taxonomische Entsprechung in der Antike aufweist‘. Ja, es gibt kein Wort dafür in der Antike. Doch Mason übersieht eine ebensolche taxonomische Entsprechung in seinem Zitat aus Josephus’ Gegen Apion auf derselben Seite. Die Formulierung, die Josephus benutzt ist: tois oikeiois nomois peri eusebeian. Eine ähnliche Terminologie ist bei antiken Autoren sehr verbreitet; anstelle von oikeios mag ein anderes Adjektiv stehen (und manchmal steht nomina statt nomoi). Solche Sätze können als ‚die althergebrachten Frömmigkeitsregeln‘ übersetzt werden, wobei ‚Frömmigkeit‘ das ‚Verhältnis der Menschen zu den Göttern‘ bedeutet, ‚Regeln‘ kann durch ‚Bräuche‘ und ‚althergebracht‘ durch eines von mehreren anderen Adjektiven ersetzt werden, das eine Volkszugehörigkeit bezeichnet. Die Apologie des Sokrates in den ersten Kapiteln von Xenophons Memorabilia basiert auf demselben Religionskonzept.32
Das klingt fast überzeugend. Es trifft selbstverständlich zu, dass eine Sprache ein Konzept nicht unbedingt mit einem einzigen Wort benennen muss, eine Wortgruppe oder ein Satz genügen auch. Nur stützt das Josephus-Beispiel von Lowes Interpretation in keiner Weise. Josephus schreibt in einer hinlänglich bekannten Passage:
[…] dass er [Moses] sich auch in der Art der Gesetzgebung zum bleibenden Nutzen von allen anderen sehr unterschied, war: Er machte nicht die Frömmigkeit zu einem Teil der Tugend, sondern als einen Teil der Frömmigkeit fasste er das andere zusammen und setzte es fest; ich meine aber die Gerechtigkeit, die Besonnenheit, die Selbstbeherrschung, die Einstimmigkeit der Bürger untereinander in allem [Gegen Apion, 2,170].
Mit anderen Worten, gerade diese angestammten Frömmigkeitsregeln klauben nicht irgendeinen speziellen Teil des judäischen Brauchtums heraus und nennen ihn Religion, sondern sie fassen alles zusammen: die Gerechtigkeit, die Besonnenheit, die Selbstbeherrschung und die Übereinstimmung der Bürger miteinander. Da für Josephus Frömmigkeit und mit dieser einhergehende Regeln zahlreiche Elemente umfassen, die wir als Gegenteil von „Religion“ auffassen würden, wäre es auch nicht sinnvoll, seinen Satz als Bezeichnung des Konzepts ‚Religion‘ in seiner Sprache zu verstehen.
Judentum ohne Namen? – Josephus
Es scheint kaum möglich, dass ein verbreiteter lexikalischer Begriff, der einen für Judäer/Juden obligatorischen Verhaltenskomplex bezeichnet, nicht in der umfangreichen Literatur judäogriechischer Autoren auftaucht, die ebendiesen Komplex darlegen und rechtfertigen. Die beiden bekanntesten griechisch-jüdischen Schriftsteller, in deren Schriften wir Ioudaismos erwartet hätten, sind zweifellos Philon und Flavius Josephus. Beide schildern ausführlich das Wesen des jüdischen Volkes sowie dessen Bräuche, und hätte es einen Oberbegriff für dieses Wesen gegeben, hätten sie diesen bestimmt angewandt. Dabei kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass Josephus das 2. Buch der Makkabäer kannte.33 Wenn er Ioudaismos als „Judentum“ verstanden hätte, also die angebliche jüdische Religion, oder auch als einen Begriff für jüdische Kultur und Brauchtum im Allgemeinen verwendet hätte – warum hat er dann den Begriff nicht in seinem Werk benutzt? Dieses Argument bestärkt Masons These beträchtlich. Und es geht hier um mehr als nur die Nichterwähnung. Nachfolgend soll am Beispiel des Josephus gezeigt werden, dass die Worte, die er benutzt, um den gesamten Komplex des judäischen Brauchtums zu beschreiben, diesen Komplex auf die Ebene anderer Völker stellen. Er begreift somit die Judäer nicht als singuläre Gemeinschaft, ganz im Gegensatz zu Amir, der behauptet: „Im gesamten hellenistisch-römischen Kulturraum gibt es, soweit uns bekannt ist, keine andere Nation, Gemeinschaft oder Gruppe, die sich veranlasst sah, eine übergeordnete Bezeichnung für das gesamte praktische und kognitive Brauchtum, zu dem sich die Mitglieder der Gruppe bekennen müssen, zu prägen, außer das Volk Israel.“34
Politeia; Nomos; Ta Patria Ethē bei Josephus
Josephus wurde oft dafür kritisiert, dass er seinen Lehrer Bannus, die Pharisäer, die Sadduzäer sowie die Essener als philosophische Schulen darstellte,35 und das basierend auf unserer modernen Annahme, dass es sich um religiöse Gemeinschaften gehandelt haben muss. Doch Josephus standen keine derartigen Begriffe zur Verfügung, die sein Publikum hätte verstehen können. Er sagte lediglich, dass diese Gruppen oder Individuen sich mit Gottesfurcht, Bescheidenheit und einer gewissen Jenseitsvorstellung beschäftigen. Und genau damit beschäftigten sich philosophische Schulen, weshalb er sie auch Philosophien nannte. Es gab keinen Genus „Religion“, deren Spezies sie sein konnten.36
In keiner Schrift des jüdischen Historikers Josephus aus dem Palästina des 1. Jahrhunderts findet sich ein Wort, das sich auf „Judentum“ oder „Religion“ bezieht. Spricht er über Ideen, Gedanken und Ideologien der Tora, dann bezeichnet er sie als „die Philosophie der heiligen Bücher“. Erwähnt er die in diesen Büchern und im jüdischen Brauchtum kodierten Gebote und Verbote, nennt er diese „Regeln/Bräuche der Vorväter“. Das entspricht auch dem Usus im 2. Buch der Makkabäer, das Josephus gelesen hatte. Martha Himmelfarb bemerkt hierzu: „Für das 2. Buch der Makkabäer ist Jerusalem eine Polis, die Juden ihre Bürger und ihre Lebensphilosophie die Politeia.“37 Die Nomoi oder, seltener, der Nomos, sind die Bräuche der Vorväter, denen die Bürger verpflichtet sind – genau wie bei Josephus.
Nomos und Narrativ: Gegen Apion
Wie bezog sich also ein auf Griechisch (bzw. im vorliegenden Fall auf Hebräisch oder Aramäisch) schreibender jüdischer Chronist auf den judäischen Lebenswandel, ohne einen übergeordneten Begriff wie Ioudaismos oder eine Bezeichnung für „Religion“ zu verwenden? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zunächst einen Blick auf ein belastetes Wort werfen, das Josephus (und die hellenistischen Juden generell) verwenden, nämlich auf nomos und seinen Plural nomoi. Diese Begriffe werden in der Regel als „Gesetz“ und „Gesetze“ übersetzt, doch soll hier gezeigt werden, dass diese Übersetzung den Sinn bei Josephus verfehlt. In seiner bemerkenswerten Apologie der jüdischen Lebensweise, in Gegen Apion, dient einzig nomos zur Beschreibung dieser Lebensweise. Für Josephus und für antike Autoren allgemein sind Abstraktionen und Kategorien wie „Gesetz“, „Politik“ und „Religion“ keine hilfreichen analytischen Kategorien. Josephus verwendet den Ausdruck nomos für das „Buch“ und die gesamte judäische Lebensart, ein Begriff, der der hebräischen Tora und der aramäischen orayta entspricht. Das mag trivial sein, wird doch bereits in der Septuaginta „Tora“ in der Regel mit nomos übersetzt. Entscheidend ist aber nicht, dass die griechischen Übersetzer den Sinn der Tora falsch verstanden haben und den Begriff deshalb so übersetzten, sondern dass das griechische Wort nomos eine andere Bedeutung erhielt, indem es von den Juden als Entsprechung von Tora genutzt wurde.
Am deutlichsten ist dieser Umstand in Josephus’ Schilderung und Apologie des judäischen nomos in Gegen Apion zu erkennen, ein Text, in dem er den judäischen nomos ausdrücklich gegen Angriffe einiger „heidnischer“ Autoren verteidigt, unter ihnen der alexandrinische Grammatiker und Homerphilologe Apion. An dieser Stelle schreibt Josephus ausführlich, was nomos/Tora in seinen Augen bedeutet:
Weil aber auch Apollonius Molon und Lysimachus und manch andere teils aus Unkenntnis, größtenteils aber aus Feindschaft über unseren Gesetzgeber Mose und über die Gesetze [nomoi] weder gerechte noch zutreffende Äußerungen gemacht haben, indem sie jenen als einen Zauberer und Betrüger verleumdeten, von den Gesetzen aber behaupteten, sie seien für uns Lehrer der Schlechtigkeit, aber keiner einzigen Tugend, will ich kurz sowohl über die Verfassung [politeuma] unseres Gemeinwesens als ganze als auch über sie in ihren Teilen sprechen, wie ich es dann vermag.
Ich glaube nämlich, dass offensichtlich sein wird, dass wir zur Frömmigkeit und zur Gemeinschaft miteinander und zur Menschenliebe allgemein, darüber hinaus aber zur Gerechtigkeit und der Ausdauer in Mühen und der Verachtung des Todes die am besten niedergelegten Gesetze haben. Ich bitte aber, dass die, welche die Schrift lesen, die Lektüre nicht missgünstig machen. Denn nicht ein Enkomium auf uns selbst zu schreiben hatte ich mir vorgenommen, sondern ich meine, dass uns, die wir oft und falsch angeklagt werden, diejenige Apologie am meisten gerecht wird, die von den Gesetzen ausgeht, nach denen wir beharrlich leben. [2,145–147]
Obwohl hier Josephus für die fünf Bücher Mose den Terminus politeuma benutzt, der in etwa Verfassung bedeutet, also ein Begriff, den wir dem Politischen bzw. der Staatsgewalt zuordnen, sind es die nomoi, aus denen sich die politeuma zusammensetzt. Häufig verwendet er nomos auch im Sinne des gesamten übergeordneten Objekts, der politeuma. Innerhalb der politeuma gibt es zwar Gesetze, doch man beachte deren Wesensarten: Es handelt sich um Gesetze, die sich auf Frömmigkeit, Gemeinschaft und Menschenliebe beziehen, auf Gerechtigkeit, auf Ausdauer in der Arbeit sowie auf die Todesverachtung. Bei näherer Betrachtung stellen wir fest, dass der gesamte Komplex – gleichgültig wie er ihn nennt, er hat mehrere Begriffe dafür – aus etwas besteht, das wir als „rituelle Gesetze“ oder „Führungsstrukturen“ einstufen könnten. Sie erzeugen wiederum eine gemeinschaftliche Verbundenheit und Nächstenliebe – und auch Gesetze im engeren Sinne (Recht) sowie einen vorgeschriebenen Ritus zur Verinnerlichung individueller moralischer Charakteristiken. Wir können weder einen Bestandteil dieses Ganzen herauslösen und ihn Gesetz, Politik oder Religion nennen, noch kann das Ganze mit einem solchen Oberbegriff benannt werden. Der Begriff nomoi hingegen umfasst all diese Kategorien und Praktiken und noch einiges mehr.
In einer längeren Passage postuliert Josephus die Totalität des judäischen Gesetzeswerks sowie den Umstand, dass dieses allen Judäern zugänglich ist. Zu den griechischen Philosophen, darunter Platon und die Stoiker, die er alle als Schüler des wahren Gottes erkennt, schreibt er:
Aber die, die vor Wenigen philosophierten, wagten nicht, der in ihren Meinungen voreingenommenen Masse die Wahrheit der Lehre zu veröffentlichen. Unser Gesetzgeber aber hat, weil er ja Taten vollbrachte, die mit den Worten übereinstimmten, nicht nur seine Zeitgenossen überzeugt, sondern pflanzte auch denen, die in Zukunft aus jenen hervorgehen würden, den unabänderlichen Glauben über Gott ein. Der Grund dafür ist, dass er sich auch in der Art der Gesetzgebung zum bleibenden Nutzen von allen anderen sehr unterschied, war: Er macht nicht die Frömmigkeit zu einem Teil der Tugend, sondern als einen Teil der Frömmigkeit fasste er das andere zusammen und setzte es fest; ich meine aber die Gerechtigkeit, die Besonnenheit, die Selbstbeherrschung, die Einstimmigkeit der Bürger untereinander in allem. Alle Taten und Beschäftigungen und alles Denken führen uns hin auf die Frömmigkeit zu Gott. Denn nichts von diesen ließ er unbeachtet oder undefiniert. [2,169–171]
Wir stellen also Folgendes fest: Zunächst einmal werden die Vorstellungen Platons und der Stoiker als „Philosophien“ bezeichnet, die er nicht im Gegensatz zu den fünf Büchern Mose sieht, sondern auf derselben Ebene. Die Gesetzgebung der Tora sei im Gegensatz zu jener der großen Griechen so perfekt aufgebaut, dass ihre Empfänger auch den Gottesglauben verinnerlicht hätten, was den anderen aufgrund ihres esoterischen Charakters (nicht ihrer „Säkularität“) nicht habe gelingen können. In dieser Passage beginnt Josephus ‘ umfassender Vergleich der fünf Bücher Mose mit dem Brauchtum anderer Völker im Hinblick auf die Verinnerlichung von Werten ihrer Lehre. Zuvor bezeichnet er die judäische Gemeinschaft [politeuma] mittels eines Neologismus bereits als Theokratie [theokratia], als Prinzipat Gottes [2,165], also Gott, wie er sich in der Tora präsentiere – nicht als die Herrschaft der Priester, wie John Barclay in seinem Kommentar schreibt.38 Wie David Flatto gezeigt hat, handelt es sich praktisch um das Gegenteil von dem, was wir heute unter dem Begriff „Theokratie“ verstehen.39 Josephus erklärt hier den Mechanismus der Theokratie anhand seiner Theorie, dass die Tora die Tugenden durch eine Kombination von „Worten“ und „Riten“ vermittle und damit anderen Kulturen überlegen sei, weil diese versuchten, ihre Werte entweder allein durch Worte (Athen) oder durch Taten (Sparta) zu vermitteln. Für die Judäer sei eusebeia gegenüber Gott nicht nur eine von vielen Tugenden, sondern die wichtigste Tugend, die alle anderen Tugenden mit einschließe und präge. „Worte“ bedeuten hier wohlgemerkt nichts anderes als die geschriebenen „Gesetze“, die es zu studieren gilt, wie Josephus im nächsten Satz erläutert, während für „Taten“ steht, „durch Sitten erzogen [werden], nicht durch vernünftige Belehrungen [Worte]“ [ἔθϵσιν ἐπαίδϵυον, οὐ λόγοις] [2,172]. Josephus bezieht sich somit deutlich auf die Doppelpraxis, die sich später für das rabbinische Judentum als so charakteristisch erweisen wird, nämlich auf die Hingabe sowohl zum Tora-Studium, logois, als auch zur Ausübung der Gebote, erga.
Wie Barclay ausführt, aktiviert Josephus hier antike Topoi und Stereotype. So zitiert er Dionysios von Halicarnassos, der über die römische Tugend schreibt: „[…] es sei jetzt nicht um schöne Worte […], sondern um Taten zu tun, wenn sie was auszurichten gedächten.“40 Josephus äußert sich hierzu explizit:
Unser Gesetzgeber aber fügte beides ineinander mit viel Bedacht. Weder ließ er nämlich stumpfsinnig die Einübung der Sitten, noch ließ er die Lehre aus dem Gesetz unausgeübt, sondern sofort, beginnend mit der ersten Nahrung und der häuslichen Lebensweise aller überließ er nichts, auch nicht das Geringste, selbstbestimmt dem Willen derer, die unter den Gesetzen leben sollten. Sondern auch über Speisen, welcher man sich enthalten muss und welche man zu sich nehmen kann, über die, die diese Lebensweise teilen sollten, über Arbeitszeiten und andererseits Ruhezeiten setzte er als Bestimmung und Richtschnur das Gesetz, damit wir unter diesem wie unter einem Vater und Herrscher leben und weder willentlich noch aus Unwissenheit etwas Sündiges tun. Denn er ließ nicht einmal die Entschuldigung wegen Unwissenheit als Möglichkeit, sondern als schönstes und notwendigstes Erziehungsgut bestimmte er das Gesetz für sie, damit sie es nicht nur ein einziges Mal anhören oder zweimal oder öfter, sondern er hieß sie, jeden siebten Tag von allen anderen Werken abzulassen und sich zum Anhören des Gesetzes zu versammeln und dieses genau auswendig zu lernen. Das haben anscheinend alle [anderen] Gesetzgeber versäumt. [2,173–175]
Josephus ist hier so weit davon entfernt, die Tora mit „Religion“ gleichzusetzen, dass er Moses als Gesetzgeber [nomothetēs] bezeichnet.41 Seine Beschreibung des Gemeinwesens als theokratia freilich hat er nicht vergessen. Die Tatsache, dass Moses das Gesetz Gottes gestiftet hat, verleiht ihm den Status eines göttlichen Menschen [theion andra]. Mehr noch, der Hauptzweck der Schabbatruhe soll das Tora-Studium sein. Moses verband die Unterweisung der Israeliten in die Tugenden zu einem perfekten Ganzen, indem er weder die Lehre unausgedrückt noch Worte als Theorie oder unausgeübt ließ. Der nomos ist somit der perfekte Ausdruck und Lehrmechanismus judäischer Werte. Die Verbindung zwischen ständigem Hören der Worte und Ausübung der darin erwähnten Taten ist die besondere Qualität: „Für uns aber, die wir überzeugt sind, dass das Gesetz von Anfang an gemäß dem Willen Gottes gegeben wurde, wäre es nicht fromm, dieses nicht einzuhalten.“ [2,184]
An diesem Punkt führt Josephus die vom nomos vermittelten Werte und Tugenden aus, unter denen sich auch solche befinden, die wir in unserem modernen Denken dem „Politischen“, dem „Religiösen“ und dem „Gesetzlichen“ zuordnen, wobei Josephus diese drei neuzeitlichen Abstraktionen nicht voneinander unterscheidet. Der nomos hat also zu einer übereinstimmenden Gottesauffassung unter den Judäern geführt. Zudem trägt auch ihr gemeinsamer Lebensstil [bios] zur Übereinstimmung bei. Der nomos entwirft eine Welt, über der Gott als Gebieter des Universums thront, der die Priester zu Verwaltern und Aufsehern und zu Richtern der in Streit Geratenen bestimmt [2,187]. Josephus schließt daran einen Gedanken an, der zunächst unlogisch erscheinen mag, nämlich, dass eine der Tugenden des judäischen Volkes die Fähigkeit sei, das Leben jederzeit als Ritus und Mysterium zu bewahren [2,188 f.]. Als wäre die ganze Verfassung wie ein mystischer Ritus [telete] aufgebaut.
Alles in der Tora – das Zivilrecht, die Herrschaftsregeln, die Riten, Ethik und Moral, die gesamte „Verfassung“ [politeia] – gestaltet sich wie ein Mysterieninitiationsritual. Die Mysterien waren ein essentieller Bestandteil des Lebens der Athener und der Hellenen. Während uns über die Initiation nicht viel bekannt ist (genau das macht ja die Mysterien aus), wissen wir dennoch, dass diese Rituale aus gemeinsamen Handlungen und Sprüchen bestanden. Laut Josephus ist es ja genau das, was die Tora als judäische Verfassung gegenüber den Verfassungen der hellenischen poleis besonders auszeichnet. Er scheint also darzulegen, dass während die Athener durch ihre Mysterien zwar lehrten und die Lehre durch eine Worte und Handlungen umfassende Praxis transformierten, kann das von der Athener Verfassung als Ganzes nicht gesagt werden. Die judäische Konstitution hingegen verkörpere solches Handeln und Reden in ihrer gesamten Existenz und sei somit wie eine Mysterieninitiation für alle aufgebaut.
Zunächst erwähnt Josephus die Gebote, die von Gott sprechen: das Verbot anderer Götter und das Verbot, sich ein Ebenbild von Gott zu machen. Dann erwähnt er die Opfer, die Regeln des Opferns, Gebete sowie Rituale der Reinigung, und er schließt diesen Abschnitt mit dem Hinweis ab, dass es sich um feste Bestandteile des nomos handle [2,198]. Diesem folgt eine Diskussion über Sexualpraktiken und Heiratsgesetze, Reinigungs- und Bestattungsrituale und das Ehren der Eltern. Anschließend erfahren wir, dass das Gesetz vorschreibt, wie wir uns gegenüber Freunden zu verhalten haben und welche Anforderungen Richter erfüllen müssen. Des Weiteren erläutert er Gesetze, etwa zum Umgang mit Kriegsgefangenen [2,212], mit Tieren [2,213] und zu redlichem Geschäftsverhalten. Josephus’ Ausführungen fassen also all das, was wir unter Staat, Ritualen, Religion, Politik und Gesetz verstehen, unter einer Rubrik zusammen – nomos.
Dieser Punkt kann am besten mit Josephus’ eigener Zusammenfassung abgeschlossen werden:
Über die Gesetze bedurfte es keiner längeren Ausführung. Sie selbst nämlich wurden erkennbar durch sich selbst, dass sie nicht Gottlosigkeit, sondern wahrhaftigste Gottesfurcht lehren, nicht zum Menschenhass, sondern zur Gemeinschaft mit allen Lebewesen auffordern, feind der Ungerechtigkeit, besorgt um Gerechtigkeit sind, Trägheit und Luxus ausschließen, lehren, selbstgenügsam und bereitwillig in Mühen zu sein. Von Kriegen zum Machtgewinn halten sie fern, sie ordnen aber an, tapfer für sich selbst zu sein, unerbittlich gegenüber den Strafen, unsophistisch in der Anordnung der Worte, durch Taten immer bekräftigt. Denn diese Taten bieten wir stets dar, augenfälliger als Buchstaben. Deshalb möchte ich kühn sagen, dass wir die ersten Lehrer der meisten und zugleich schönsten Dinge für die anderen geworden sind. Denn was ist schöner als unwandelbare Gottesverehrung? Was ist gerechter als den Gesetzen zu gehorchen?
Oder was ist förderlicher als miteinander übereinzustimmen und weder in schlimmen Zeiten sich zu entzweien noch in glücklichen Zeiten gegeneinander aufzustehen aus Übermut, sondern im Krieg den Tod zu verachten, sich im Frieden aber den Handwerken oder der Landwirtschaft zu widmen und überzeugt zu sein, dass Gott überall auf alles schaut und alles regiert? [2,291–294]
Im Gegensatz zu der stereotypen Vorstellung, die griechisch-jüdischen Schriftsteller hätten die Tora zum „Gesetz“ reduziert, wird bei Josephus deutlich, dass er nomos auf eine Art und Weise interpretiert, die weit über unser heutiges Verständnis von „Gesetz“ hinausgeht. Für ihn schließt der Begriff Zivil- und Strafgesetz, die Staatsform und zusätzlich den Kultus, inklusive Glaubensausübung im Tempel und als Individuum, sowie Gottesglaube mit ein, also weit mehr als „Gesetz“, „Politik“ oder „Religion“.
An diesem Punkt könnte man sagen: Entscheidend ist nicht der Name. Obwohl Josephus ganz andere lexikalische Begriffe verwendet, um die judäische Lebensart zu beschreiben, sieht er sie dennoch als Einheit. Warum sollte sie also nicht „Judentum“ genannt werden? Entscheidend ist hier die Frage, ob Josephus diese judäische Lebensart als Spezies des Genus interpretiert, zu dem er die Griechen, Assyrer, Römer und Skyten zählt, oder als etwas Singuläres, sui generis. Der Umstand, dass Josephus den Begriff Ioudaismos nicht anwendet, zeigt meines Erachtens, dass Amir genau falsch liegt: Die Juden/Judäer haben kein singuläres Selbstverständnis als Volk, das sich von dem anderer Völker als separater Genus abhebt. Wie Josephus bezeugt (und in Übereinstimmung mit Masons Standpunkt) sehen sie sich gleichsam als Teil der „Völkerfamilie“.
Ioudaismos in Inschriften
Zwei epigraphische Funde scheinen diese Sichtweise (entgegen Amirs Darstellung42) ebenfalls zu bestätigen. Eine Inschrift von Stobi (spätes 3. bis 4. Jahrhundert)43 bezieht sich auf eine Person (oder vielmehr bezieht sich die in dieser Inschrift genannte Person auf sich selbst) als „πολιτϵυσάμϵνος πᾶσαν πολιτϵίαν κατ τὸν Iουδαισμον“.44 Amir übersetzt das erwartungsgemäß mit „verhielt sich in der Öffentlichkeit nach den Regeln des Judentums“ und fügt folgenden Kommentar hinzu: „Die Bedeutung scheint einfach, dass er die Gebote streng beachtete.“ Ich stimme zwar Amirs Interpretation zu, doch ist seine Übersetzung irreführend. Wie erwähnt ist „Judaisieren“, d. h., wie ein Judäer zu handeln, sich zu verhalten, wie es Judäer tun (gut oder schlecht, in diesem Fall Ersteres) viel näher am erstrebten Sinn als „Judentum“, das die Bedeutungen des modernen -ismus-Begriffes impliziert. Hengel übersetzt es als „jüdische Sitte“,45 was der Sache viel näherzukommen scheint.46 Doch selbst wenn jemand behaupten möchte, dass bei dieser Inschrift eine Interpretation wie „Judentum“ plausibler wäre, ist das vermutlich späte Datum der Inschrift an sich aufschlussreich und könnte somit leicht als Verwendung unter christlichem Vorzeichen gedeutet werden.
Ähnliches wäre zur letzten – meines Wissens – noch erhaltenen Erwähnung in einer Inschrift zu sagen. Eine Inschrift in Porto enthält folgende Passage: καλῶς βιώσασα ἐν το Iουδϊσμῷ (sie führt ein geruhsames Leben [mit ihrem Ehemann], indem sie den jüdäischen Bräuchen nachgeht), also indem sie die Gebote beachtet/praktiziert (genau wie in der Inschrift von Stobi), aber nicht zwingend im Rahmen einer Institution, die in der Moderne „Judentum“ genannt wird. Es gilt zu beachten, dass diese beiden epigraphischen Erwähnungen sich nicht vollständig mit Masons Interpretation vereinbaren lassen, doch ich glaube, dass sie, gestützt auf meine Korrektur dieser Interpretation, sehr gut ins Bild passen und in keiner Weise die Art von semantischer Entwicklung nahelegen, die wir sonst nur in christlichen Quellen finden. Sollten die Inschriften einen christlichen Bezug haben, sind Masons Argumente allerdings völlig irrelevant.47 Jedenfalls handelt es sich um die einzigen jüdischen Verwendungen von Ioudaismos (sozusagen aus der inneren Perspektive), abgesehen von den Makkabäerbüchern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der überaus seltene Terminus Ioudaismos keine Bezeichnung für eine damit angeblich verbundene „Religion“ ist, sondern einen Lebenswandel benennt, der sich (mit Eifer) der Einhaltung der Gebote verschrieben hat. Er kann also genauso als „Judaisieren“ bezeichnet werden, wie etwa das fehlerfreie Schreiben der griechischen Sprache als „Hellenisieren“. Wie Amir mit Bezug auf Hellenismos bemerkt: „In diesem Sinne ist es ein ersehntes Ideal, dem der Mann des Geistes sein Leben lang nachstrebt, denn der linguistische ,Hellenismus‘ erfordert die genaue Einhaltung tausend kleiner und großer Regeln.“ Ersetzt man „linguistischer Hellenismus“ mit „die Lebensart der Vorväter (oder der Tora), dann erschließt sich der perfekte Sinn für Ioudaismos: „In diesem Sinne ist es ein ersehntes Ideal, dem der Mann des Geistes sein Leben lang nachstrebt, denn das Ausüben des ‚Judentums‘ erfordert die genaue Einhaltung tausend kleiner und großer Regeln.“ Diese Deutung passt sowohl in den paradigmatischen Kontext des grammatikalischen und lexikalischen Systems des Griechischen als auch zu den syntagmatischen Kontexten der Erwähnung des Begriffs im Jüdisch-Griechischen. Dieser Sinn erschließt sich auch, wenn wir dem Judäischen keine Sonderrolle einräumen. Nicht nur im Jüdisch-Griechischen, sondern auch im Hebräischen, im Jüdisch-Aramäischen und sogar im Jiddischen gab es jahrhundertelang keinen Ausdruck für die „jüdische Religion“.
Ich hoffe, hier bewiesen oder zumindest plausibel dargelegt zu haben, dass es irreführend ist, die jüdische Kulturgeschichte der Antike vor dem Hintergrund einer Vermutung zu betrachten, es habe eine „Religion“ gegeben, die „Judentum“ genannt wurde und gesondert war vom säkularen Bereich und der Politik. Wir täten gut daran, die Kultur insgesamt zu betrachten, ohne sie in Kategorien zu zwingen, die von anderen Kulturen, besonders unserer christlich geprägten, übernommen wurden.
Übersetzung aus dem Englischen: David Ajchenrand
______________
1Dieser Beitrag ist eine leicht geänderte und gekürzte Version eines Kapitels in meiner sich in Arbeit befindenden Studie Judaism/Jewish Religion im Rahmen der Reihe „Key Words for Jewish Studies“, die demnächst in der Rutgers University Press erscheinen wird.
2Davies, Philip R.: On the Origins of Judaism, Bible World, London; Oakville 2011.
3Ebd., S. 1.
4Ebd., S. 4.
5Ebd., S. 9.
6Ebd., S. 11.
7Ebd., S. 12.
8Thiessen, Matthew: Contesting Conversion: Genealogy, Circumcision and Identity in Ancient Judaism and Christianity, Oxford; New York 2001.
9Flavius Josephus: Jüdischer Krieg. Aus dem Griechischen übersetzt von Dr. Philipp Kohout, Linz 1901, S. 488.
10Schwartz, Daniel R.: Jewish Background of Christianity (= Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Bd. 60), Tübingen 1992, S. 13.
11Davies: Origins of Judaism, S. 13.
12Batnitzky, Leora: How Judaism Became a Religion: An Introduction to Modern Jewish Thought, Princeton 2011.
13Amir, Yehoshua: The Term Ιουδαϊσμός: On the self-understanding of Hellenistic Judaism, in: Peli, Pinchas (Hg.): Proceedings of the Fifth World Congress of Jewish Studies, the Hebrew University of Jerusalem, Mount Scopus-Givat Ram, Jerusalem 1969, S. 264.
14Ebd., S. 265.
15Ebd., S. 266. Vgl. Schwartz, Daniel R.: More on Schalit’s Changing Josephus: The Lost First Stage, in: Jewish History 9/2 (1995), S. 9–20.
16Mason, Steve: Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism: Problems of Categorization in Ancient History, in: Journal for the Study of Judaism xxxviii/4–5 (2007), S. 465.
17Unter anderem in Boyarin, Daniel: Semantic Differences: Linguistics and „the Parting of the Ways“, in: Becker, Adam H.; Reed, Annette Yoshiko (Hg.): The Ways That Never Parted: Jews and Christians in Late Antiquity and the Early Middle Ages (= Texte und Studien zum antiken Judentum, Bd. 95), Tübingen 2003, S. 65–85. Diese Behauptung zu Ioudaismos findet sich zudem bereits bei Goldstein, Jonathan A. (Übers. und Hg.): II Maccabees: A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible 41a, New York 1983. Mason hat das Argument aber zweifellos weiterentwickelt und es in seiner gründlichen Arbeit entscheidend gestärkt.
18Vgl. Himmelfarb, Martha: Judaism and Hellenism in 2 Maccabees, in: Poetics Today 19 (1998), S. 196. Meines Erachtens versteht Himmelfarb diesen Sachverhalt genau verkehrt. Von Ioudaismos als gegeben ausgehend und es als „Judentum“ übersetzend geht sie davon aus, dass Hellenismos hier „Hellenismus“ und nicht „Hellenisieren“ bedeuten muss. Vgl. auch ihre meinen Thesen diametral entgegenlaufende Bemerkung, dass „‚Die Gesetze‘ (hoi nomoi), oder weniger häufig, ‚Das Gesetz‘ (ho nomos), im 2. Buch der Makkabäer als Bezeichnung für die jüdische Lebensart ist, die anderswo als Ioudaismos bezeichnet wird und den Gegensatz zu ‚Hellenismos‘ bildet“. (ebd., S. 196). Vgl. nachfolgend die Argumente bei Josephus, die u. a. gegen diese Interpretation sprechen.
19Dover, Kenneth James: Aristophanic Comedy, Berkeley 1972, S. 214.
20Schwartz, Daniel R.: 2 Maccabees: Commentaries on Early Jewish Literature, Berlin; New York 2008, S. 465.
21Schwartz, Seth: How Many Judaisms Were There? A Critique of Neusner and Smith on Definition and Mason and Boyarin on Categorization, in: Journal of Ancient Judaism 2/2 (2011), S. 225.
22Ebd., 226.
23Vgl. „In der immer noch lebendigen Erinnerung der Griechen von den Perserkriegen des 6. und 5. Jahrhunderts v. u. Z. werden jene, die sich von den Griechen abwandten und mit ihren Feinden kollaborierten, ‚Medisierer‘ genannt, […] die implizierten Antonyme von ‚Medisierer‘ und ‚Medismus‘ wären ‚Hellenisierer‘ und ‚Hellenismus‘, was ‚der griechischen Sache loyal sein‘ bedeuten würde.“ Goldstein: Maccabees, S. 230, Fn 13. Ich erkenne bei Ioudaismos genau denselben Ursprung und dieselbe Semantik.
24Mason: Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism, S. 467.
252. Buch der Makkabäer 2:21, Bibelübersetzung von Hermann Menge http://www.bibelwissenschaft.de/online-bibeln/menge-bibel/bibeltext/bibel/text/lesen/stelle/46/20001/29999/ch/bc17a5c06f734ff3a1b95350290ff329/, letzter Zugriff: 10. 01. 2017.
26Goldstein stellt enthusiastisch fest: „Unser Vers enthält die früheste bekannte Erwähnung des griechischen Wortes Ioudaismos (‚Judentum‘). Der Autor benutzte vermutlich absichtlich ein Wort mit dieser Form im Sinne von ‚barbarisch‘, da er damit seinem gebildeten griechischen Publikum die Analogie zum Kampf der loyalen Hellenen gegen die ‚barbarischen‘ Perser und gegen den ‚Medismus‘ der griechischen Kollaborateure mit dem Perserreich nahelegen wollte.“ Goldstein: Maccabees, S. 192, Fn 21.
27Mason: Jews, Judaeans, Judaizing, Judaism, S. 463.
28Ebd., S. 464.
29Ebd., S. 469.
30Ebd., S. 468.
31MacRea, Duncan: Diligentissumus Investigator Antiquitatis? „Antiquarianism“ and Historical Evidence between Republican Rome and the Early Modern Republic of Letters, in: Smith, Christopher; Sandberg, Kaj (Hg.): Historical Evidence and Historiography in Republican Rome, im Erscheinen.
32Lowe, Malcolm: Concepts and Words, in: Marginalia. The Los Angeles Review of Books (August 2014).
33Goldstein: Maccabees, S. 302.
34Amir: On the self-understanding of Hellenistic Judaism, S. 266.
35Der Jüdische Krieg 2,119–166; Altertümer 13,171–173; 18,12–25; Autobiographie 10–12.
36Dieses Argument wurde bereits vorgebracht, wenn auch etwas weniger pointiert. Siehe Flavius, Josephus: Judean War 2. Translation and Commentary by Steve Mason with Honora Chapman [De Bello Judaico. Liber 2.], Josephus Flavius: Works, 2000 1B, Leiden 2008, S. 96, Fn 734.
37Himmelfarb: Judaism and Hellenism in 2 Maccabees, S. 201.
38Josephus, Against Apion, hg. von Steve Mason, ins Englische übersetzt und kommentiert von John Barclay, Leiden 2007, S. 262, Fn. 638.
39„Josephus fasst frühe Staats- und Rechtstheorie mit sozioreligiösen jüdischen Werten zu einem theokratischen Konzept als Alternative zu klassischen Staatsmodellen zusammen. Die Instabilität und tyrannische Tendenzen königlicher Herrschaft kritisierend legt Josephus dar, dass ein politisches System nur dann von Dauer sein kann, wenn es auf den Grundlagen des Gesetzes ruht. Indem es die Rolle der Menschen reduziert und sich an ihrer Stelle auf sakrale Gesetze stützt, bietet die Theokratie ein solches System. Ungeachtet der Verzerrungen, die dieser Begriff im Laufe der Zeit erfuhr, oder dessen späterer Transformation, repräsentiert die Theokratie für Josephus ein konstitutionelles Vorhaben, das sorgfältig darauf ausgelegt wurde, Freiheit und Recht zu erreichen.“ Vgl. Flatto, David C.: Theocracy and the Rule of Law: A Novel Josephan Doctrine and Its Modern Misconceptions, in: Dine Yisrael 28 (2011), S. 7. Zum Gedanken, dass theokratia heute das Gegenteil von dem bedeutet, was Josephus mit diesem Begriff vorschwebte, siehe ebd., S. 5.
40Josephus: 267, Anm. 677, zitiert in: Altertümer 2,28.
41Siehe zu dieser Verwendung Josephus Flavius: De Bello Judaico. Der jüdische Krieg, Bd. I u. II. Herausgegeben und mit einer Einleitung sowie mit Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto Bauernfeind, Darmstadt 2013, S. 116: „Nächst Gott ist bei ihnen der Name des Gesetzgebers der Gegenstand der größten Verehrung.“
42Amir: On the self-understanding of Hellenistic Judaism, S. 264.
43Vgl. die Diskussion zur Datierung bei Hengel, Martin: Die Synagogeninschrift von Stobi, in: Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 57/3 (1966), S. 147–159.
44Ebd., S. 146.
45Ebd., S. 178.
46Siehe Hengels gesamte aufschlussreiche und wichtige Diskussion dieses Aspekts: ebd., S. 179 ff.
47Das ist zweifellos auch der Grund, weshalb er die Inschriften ignoriert.