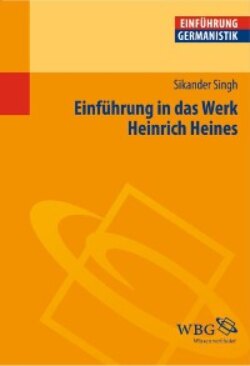Читать книгу Einführung in das Werk Heinrich Heines - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Zur Lebens- und Werkgeschichte
ОглавлениеHerkunft und Kindheit
Geboren wurde Heinrich Heine am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf, der Haupt- und Residenzstadt des Herzogtums Berg, als erster Sohn des jüdischen Kaufmanns Samson Heine und seiner ebenfalls jüdischen Frau Betty, geb. van Geldern. Der Vater unterhielt ein Manufakturwarengeschäft, das in den ersten Jahren gute Gewinne abwarf, später jedoch, nach dem Ende der von dem französischen Kaiser Napoléon gegen England verhängten Kontinentalsperre, in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet und schließlich im Jahr 1819, aufgrund einer Erkrankung Samsons, liquidiert werden musste.
An der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert hatte die Stadt am Rhein 16 Tausend Einwohner und nur eine kleine jüdische Gemeinde. Ohnehin ging man im Elternhaus des Dichters liberal mit der jüdischen Religion um: So wurde der Erstgeborene zwar beschnitten und besuchte ab 1803 eine israelitische Privatschule, im Gegensatz zu anderen jüdischen Familien spielte die Pflege religiöser Überlieferungen und Rituale jedoch nur eine untergeordnete Rolle.
Ein einschneidendes und folgenreiches Ereignis in der Kindheit des Dichters war die Okkupation seiner Vaterstadt durch die Armeen Napoléons im Frühjahr 1806. Damit gelangte Düsseldorf nicht nur politisch unter den Herrschaftsbereich des revolutionären Frankreich, die liberale französische Gesetzgebung, welche die Gleichheit aller Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und Religion festschrieb, der „Code Napoléon“, galt fortan auch im Rheinland, wie in allen von Frankreich besetzten Territorien.
Lehrjahre
Die bürgerliche Gleichstellung schuf die Voraussetzung dafür, dass der junge Heine die Möglichkeit bekam, eine höhere Schule zu besuchen, was zuvor nur Angehörigen der christlichen Konfessionen offenstand. Ab 1807 war er Schüler des Düsseldorfer Lyzeums, das er jedoch 1814 ohne Reifezeugnis verließ. Er wechselte für kurze Zeit auf eine Handelsschule und begann schließlich 1815 im Bankhaus Rindskopf in Frankfurt am Main eine kaufmännische Lehre, die er allerdings nach nur zwei Monaten abbrach, um in sein Elternhaus zurückzukehren. Ein Jahr später verließ er Düsseldorf erneut und reiste nach Hamburg, wo er in dem Bankhaus seines Onkels, Salomon Heine, eine Lehre absolvierte. Der reiche Hamburger Bankier, der Zeit seines Lebens den Sohn seines Bruders finanziell unterstützen sollte, richtete ihm 1818, nach dem erfolgreichen Abschluss der Lehrzeit, ein Manufakturwarengeschäft in der Hansestadt ein. Nachdem das Unternehmen nach nur einem Jahr liquidiert werden musste, erklärte Salomon sich bereit, seinem Neffen ein Studium der Rechts- und Kameralwissenschaften zu ermöglichen.
Studium in Bonn, Göttingen und Berlin
Während des Hamburger Aufenthaltes entstanden die ersten Dichtungen Heines. Diese Gedichte sind in der Forschung lange Zeit vor dem Hintergrund der unglücklichen, weil unerwiderten Liebe des jungen Dichters zu seiner Cousine Amalie, einer Tochter Salomon Heines gedeutet worden, spiegeln aber bereits den auch sein späteres Werk bestimmenden kritischironischen Umgang mit der Bild- und Formensprache der Romantik. Aus diesen Anfängen entstand während der Jahre seines Studiums, das Heine in den Jahren 1819 bis 1825 in Bonn, Göttingen und Berlin absolvierte, und unter dem Einfluss des romantischen Schriftstellers und Literaturtheoretikers August Wilhelm Schlegel, der an der Universität Bonn lehrte, eine ganz eigene Schreibart, mit der er, nach verstreuten Publikationen einzelner Gedichte in Zeitschriften und Journalen, im Jahr 1822 mit einem Band lyrischer Werke die Öffentlichkeit überraschte und provozierte.
Salonkultur
Prägend waren in diesen Jahren auch die Salons der Rahel Varnhagen von Ense und Elise von Hohenhausen, zu denen Heine bereits kurz nach seinem Wechsel an die Universität Berlin Zugang gefunden hatte. Nach französischem Vorbild avancierten Salons in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Treffpunkten musisch-künstlerischer aber auch politischer Kreise. Ihre spezifische Form von Geselligkeit bildete während der Restaurationszeit eine Art von Gegenöffentlichkeit derjenigen Schichten, denen die Teilnahme am höfischen Leben verwehrt blieb. (Seibert 1993) Im Kreis von Adligen, Gelehrten, Schriftstellern, Malern, Professoren und anderen Intellektuellen, wie Adelbert von Chamisso, Friedrich de la Motte-Fouqué, Christian Dietrich Grabbe oder Friedrich von Uechtritz, fand Heine Gesprächspartner, die seine literarische Arbeit anregten und förderten. So entstanden während seines Berliner Aufenthaltes nicht nur Gedichte, sondern auch Prosaarbeiten, wie die Briefe aus Berlin oder die frühe Reiseskizze Über Polen, die in Fortsetzungen in Zeitschriften publiziert wurden und gleich seinen lyrischen Produktionen Beachtung und Anerkennung fanden.
„Verein für CuItur und Wissenschaft der Juden“
Richtungsweisend wirkten in der preußischen Residenzstadt des Weiteren die Begegnung mit dem Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel, bei dem Heine Vorlesungen hörte, sowie der Kontakt zu einer Gruppe jüdischer Studenten, die den „Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden“ begründet hatten, dem der Dichter 1822 beitrat. (Lutz 1997) Ziel der Vereinigung war es, das Bildungsniveau der benachteiligten unteren jüdischen Bevölkerungsschichten zu heben und auf diese Weise ihre (Assimilations-)Chancen zu verbessern. So gliederte sich die Vereinstätigkeit in vier Bereiche: die wissenschaftlichen Arbeiten zur Geschichte der Juden, die Herausgabe einer Zeitschrift, die Errichtung einer Unterrichtsanstalt und den Aufbau eines Archivs zur Geschichte der jüdischen Kultur. In den Jahren 1822 und 1823 hat Heine sich als Sekretär und Lehrer, aber auch mit Beiträgen für die Zeitschrift am Wirken des Vereins beteiligt. Nach seinem Weggang aus Berlin (Salomon Heine drängte seinen Neffen zum Abschluss des Studiums und sah – wie Heines vielfältige Tätigkeiten belegen – die preußische Universitätsstadt hierfür als wenig geeignet an), blieb der Kontakt zu einzelnen Mitgliedern des Vereins zwar bestehen, aber sein Engagement für die Ziele der Gruppierung ließ nach und erlosch schließlich ganz.
Taufe und Promotion
Zu Beginn des Jahres 1824 kehrte Heine zur Fortsetzung seines juristischen Studiums an die Universität Göttingen zurück, wo er bis zu seiner Promotion zum Doktor beider Rechte, die am 20. Juli 1825 vollzogen wurde, blieb. Kurz nach dem Examen und noch bevor er seine Thesen verteidigte, erfolgte am 28. Juni in Heiligenstadt der Übertritt zum evangelischen Glauben. Der Dichter, der bis zu diesem Zeitpunkt den Vornamen Harry führte (nach einem britischen Geschäftsfreund seines Vaters), nahm die christlichen Taufnamen Johann Christian Heinrich an.
Diese Konversion hat in der Forschung viel Beachtung gefunden und ist bis in die Gegenwart kontrovers bewertet worden. (Schlingensiepen 1998) Nach der Rücknahme des preußischen Emanzipationsediktes von 1812 und vor dem Hintergrund eines zunehmenden Antisemitismus bezweckte Heine mit diesem Schritt wohl, seine Ausgangssituation für eine jener Laufbahnen im Staatsdienst zu verbessern, die für einen Juristen naheliegend waren. Wenn er, Jahre später, von dem „Taufzettel“ als dem „Entre Billet zur Europäischen Kultur“ spricht, deutet sich diese Überlegung an. (HSA XII, 246) Wie wenig glücklich Heine jedoch über den als notwendig erachteten Schritt war, belegt bereits ein Brief an den Berliner Freund Moses Moser aus dem Januar 1826: „Ich bin jetzt bey Christ und Jude verhaßt. Ich bereue sehr daß ich mich getauft hab; ich seh noch gar nicht ein daß es mir seitdem besser gegangen sey, im Gegentheil, ich habe seitdem nichts als Unglück –“ (HSA XX, 234)
Erste schriftstellerische Erfolge
Mit dem Abschluss des Studiums und der Übersiedlung nach Hamburg begann für Heine eine Zeit, die geprägt war von Unruhe und Enttäuschung. Verschiedentlich unternahm er den Versuch, eine Anstellung im Staatsdienst zu erlangen, so beabsichtigte er zunächst, sich in der norddeutschen Handelsmetropole als Advokat niederzulassen, später strebte er eine Professur in München an. Seine Bemühungen, sich in einem bürgerlichen Leben zu etablieren, blieben jedoch erfolglos, stattdessen avancierte er in der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre zu einem zwar umstrittenen, aber gleichwohl anerkannten Schriftsteller. Grundlage seines Erfolges waren die ersten beiden Bände der Reisebilder, die 1826 und 1827 im Hamburger Verlag Hoffmann & Campe erschienen. Der ironische Ton, die assoziative Schreibart, aber auch der kritische Blick, den diese Texte auf die literarischen und gesellschaftlichen Zustände der Zeit werfen, war neu und provozierend und überraschte in einer Periode, die geprägt war von der Bild- und Formensprache der bereits spätzeitlich gewordenen Romantik.
Julius Campe
Wesentlichen Anteil an den literarischen Erfolgen des jungen Schriftstellers hatte Julius Campe. Der Verleger und der Schriftsteller hatten sich Anfang 1826 in Hamburg kennengelernt, wo Campe nicht nur einen Verlag, sondern auch eine Buchhandlung unterhielt. Wenngleich die Beziehung geprägt war von oftmals langwierigen und erbittert geführten Auseinandersetzungen um Honorare, Auflagenhöhen, die Ausstattung von Büchern, Papierqualitäten oder Erscheinungstermine hatte das Geschäfts- und Freundschaftsverhältnis über drei Jahrzehnte bis zu Heines Tod Bestand. (Ziegler 1976) Trotz der Maßnahmen, mit denen die staatlichen Behörden die Publikation und Verbreitung von Heines Schriften zeitweilig zu unterbinden suchten, gelang es Campe, die Werke zum Druck zu befördern und auszuliefern. Und wenngleich der Schriftsteller nie müde wurde, über die Honorare für seine Werke zu klagen und dem Verleger die Eingriffe der Zensur in seine Texte vorzuwerfen, profitierte er von dem Geschick, das Campe bewies, wenn es um den Vertrieb und die Verbreitung seiner oftmals verbotenen Werke ging, und partizipierte in der Folge an dem wirtschaftlichen Erfolg, den der Verlag mit seinen Schriften erzielte.
Reisen und Kuraufenthalte
Den biografischen Hintergrund für die Reisebilder bildeten die Reisen, die Heine in den zwanziger Jahren unternahm. So machte er im Spätsommer 1824 von Göttingen aus eine Fußwanderung durch den Harz, woraus die Harzreise erwuchs, hielt sich, aufgrund seines bereits in jungen Jahren angeschlagenen Gesundheitszustandes, in den Sommermonaten oft und gern (und stets auf Kosten seines Onkels Salomon Heine) in Nordseebädern wie Cuxhaven, Ritzebüttel, Norderney oder Helgoland auf oder reiste im Jahr 1827 nach England und besuchte auf der Rückreise Holland sowie die Nordseeinsel Wangeoog.
München und Italien
1828 hatte er das Angebot angenommen, in München die in dem angesehenen Verlagshaus des Barons Johann Friedrich von Cotta erscheinende Zeitschrift Neue allgemeine politische Annalen zu redigieren. Von der bayerischen Residenz aus unternahm er von August bis November 1828 eine Reise nach Italien, die ihn auf den Spuren Johann Wolfgang von Goethes bis nach Sizilien führen sollte – die Nachricht von der Erkrankung seines Vaters veranlasste ihn jedoch bereits in Lucca zur vorzeitigen Rückkehr nach Hamburg. Gleichwohl traf er seinen Vater nicht mehr lebend an.
„Platen-Streit“
Literarisches Ergebnis dieser Reise waren die drei Werke Reise von München nach Genua, Die Bäder von Lukka und Die Stadt Lukka. Sie erschienen im dritten und vierten Band der Reisebilder. Mit den Bädern von Lukka provozierte Heine einen literarischen Skandal, in dessen Verlauf seine jüdische Herkunft erstmals in den Rezensionen und Stellungnahmen der Feuilleton-Kritik eine bedeutende Rolle spielte: Der zweite Band der Reisebilder hatte mit einer Reihe von Xenien aus der Feder des befreundeten Schriftstellers Karl Leberecht Immermann geschlossen. Ohne dass dies von Heine oder Immermann beabsichtigt war, hatte der Dichter August Graf von Platen eines der Epigramme auf sich und seine Werke bezogen. Er sah sich in einem solchen Maße angegriffen, dass er in dem als öffentliche Replik konzipierten Lustspiel Der romantische Ödipus sowohl Immermann als auch Heine lächerlich zu machen versuchte. In Bezug auf Heine zielten seine Ausfälle vor allem auf dessen jüdische Herkunft. Dieser wiederum nutzte die Bäder von Lukka, um auf die Angriffe Platens zu reagieren, indem er – ein in der Zeit unerhörtes Vorgehen – auf eine satirische Weise dessen homosexuelle Neigungen öffentlich bloßstellte. (Hermand 1993)
Selbst im Kontext einer Epoche, welche die dialektische Methode der sauberen und wissenschaftlich korrekten Trennung von Idee und Person noch nicht kannte, weshalb jeder nicht nur argumentativ für seine Positionen und Vorstellungen einzustehen hatte, sondern mit seiner ganzen Person, bildete die Auseinandersetzung zwischen Heine und Platen eine vielbeachtete und -diskutierte Ausnahmeerscheinung des deutschen Literaturbetriebs. Wirkungsgeschichtlich bedeutsam an diesem über Monate die Feuilletons der deutschen Zeitschriften und Journale beschäftigenden Skandal war der Umstand, dass Heine, erstmals in seiner schriftstellerischen Laufbahn, mit jenen antisemitischen Vorurteilen konfrontiert wurde, die die Aufnahme seiner Werke bis in das 20. Jahrhundert prägen sollten.
Übersiedlung nach Paris
Fünf Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums an der Göttinger Universität und nach einigen vergeblichen Versuchen, eine gesicherte, bürgerliche Existenz aufzubauen, entschloss sich Heine, als freier Berufsschriftsteller nach Paris überzusiedeln. Beeinflusst wurde dieser Schritt einerseits von der französischen Juli-Revolution des Jahres 1830, deren Dynamik ihn als liberalen Denker und kritischen Zeitschriftsteller faszinierte (in den in die Denkschrift über Ludwig Börne integrierten Briefen aus Helgoland berichtet er, zwischen Dichtung und Wahrheit changierend, über den Einfluss, den die Ereignisse in Frankreich auf seine Entscheidung genommen haben), und andererseits von dem Angebot des Barons Cotta für in seinem Verlagshaus erscheinende Zeitungen und Zeitschriften aus Paris als Korrespondent zu arbeiten. Im Mai 1831 verließ Heine Hamburg und reiste über Frankfurt und Straßburg in die Stadt an der Seine. Seine erste journalistische Arbeit in der französischen Hauptstadt war eine Reihe von Berichten über die große, jährlich stattfindende Gemäldeausstellung im Louvre.
Gesellschaftliches Leben
Seit der Revolution des Jahres 1789 hatte Paris deutsche Schriftsteller, Gelehrte, Publizisten und Denker angezogen. Als größte Metropole des europäischen Kontinents entwickelte die Stadt nicht nur im Bereich des politischen Diskurses eine ungeheure Dynamik, auch die technischen Neuerungen des Industriezeitalters, die innovative (und zugleich zerstörerische) Kraft des Kapitals, das in den Banken und an der Börse der französischen Hauptstadt akkumuliert, verwaltet und vermehrt wurde, bedingten gesellschaftliche Wandlungsprozesse, mit denen die Intellektuellen der Zeit sich in ihren Schriften auseinandersetzten. Heine fand auch hier schnell Zutritt zu den Salons, wie sie von Damen der Gesellschaft wie Caroline Jaubert, Cristina Principessa di Trivulzio Belgiojoso oder Betty Rothschild unterhalten wurden, knüpfte Kontakte zu Persönlichkeiten, die in der Politik dieser Jahre eine bedeutende Rolle spielten, wie den späteren Ministerpräsidenten François Guizot und Adolphe Thiers, zu Journalisten wie Michel Chevalier, zu Schriftstellern wie Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Victor Hugo, Gérard de Nerval, George Sand, Honoré de Balzac, zu Musikern wie Frédéric Chopin, Hector Berlioz, Giacomo Meyerbeer, Franz Liszt, aber auch zu anderen deutschen Exilanten wie Ludwig Börne. (Kruse/Werner 1981; Deinet 2007) Ein Brief, den der Schriftsteller unmittelbar nach seiner Ankunft an Karl August Varnhagen von Ense nach Berlin schrieb, dokumentiert das Lebensgefühl, das in den ersten Jahren seines französischen Aufenthaltes bestimmend sein sollte: „Ich habe wahrhaftig nicht die Dinge auf die Spitze gestellt, sondern die Dinge haben mich auf die Spitze gestellt, auf die Spitze der Welt, auf Paris –“ (HSA XXI, 20)
Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich
Unmittelbar nach seiner Ankunft begann Heine auch in französischen Zeitschriften zu publizieren. So sind die ersten Jahre in Frankreich werkgeschichtlich von dem Versuch bestimmt, in zwei dialektisch aufeinander bezogenen Sammlungen seiner Schriften, De l’Allemagne und De la France, dem französischen Publikum die deutsche Literatur und Geistesgeschichte zu vermitteln und die deutschen Leser mit den literarischen und philosophischen Diskursen der Franzosen vertraut zu machen. Noch in seinem im November 1851 niedergelegten Testament bezeichnete der Dichter diese Vermittlerrolle als „grande affaire de ma vie“. (HSA XXIII, 159) In einer historischen Periode wie der Restaurationszeit, die im Schatten der gegen die napoleonische Fremdherrschaft geführten Befreiungskriege lag, einer Epoche, in der, wie verschiedene politische Krisen dokumentieren, sich beide Länder feindlich gegenüberstanden, war Heines Eintreten für Frieden und Völkerverständigung ebenso bemerkenswert wie in seinen Auswirkungen vergeblich. In diesem Sinne schreibt er bereits am Ende des Reisebilds Englische Fragmente:
[…] die Freyheit ist eine neue Religion, die Religion unserer Zeit. […] Die Franzosen sind aber das auserlesene Volk der neuen Religion, in ihrer Sprache sind die ersten Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ist das neue Jerusalem, und der Rhein ist der Jordan, der das geweihte Land der Freyheit trennt von dem Lande der Philister. (HSA V, 194)
Verbot des „Jungen Deutschlands“
So war er zugleich auch darum bemüht, weiterhin als deutscher Schriftsteller wahrgenommen zu werden und auf dem literarischen Markt seiner Heimat präsent zu sein. Um so mehr trafen ihn die Beschlüsse, die der Deutsche Bundestag in Frankfurt am 10. Dezember 1835 auf Betreiben der preußischen Regierung gegen ihn und eine Reihe weiterer Autoren verhängte. Es handelte sich um ein umfassendes Publikationsverbot, mit dem die Regierungen nicht nur die Verbreitung seiner Schriften im Geltungsgebiet des Deutschen Bundes zu unterbinden beabsichtigten, sondern auch diejenigen einer jüngeren Generation von Schriftstellern, wie Ludolf Wienbarg, Heinrich Laube, Theodor Mundt und Karl Gutzkow, die sich sowohl in Stil und Schreibart als auch inhaltlich den kritischen Positionen Heines angeschlossen hatten. Diese unter der Bezeichnung „Junges Deutschland“ zusammengefassten Schriftsteller (Wülfing 1978, 150f.) bildeten zwar keine literarische Gruppierung im programmatischen Sinn des Wortes, gleichwohl verband sie der Anspruch, mit den Mitteln der Literatur für eine Veränderung der politischen Verhältnisse in Deutschland einzutreten.
Ludwig Börne
Dass die kritisch-oppositionelle Literatur in unterschiedliche Lager gespalten war und in ihren politischen und ästhetischen Vorstellungen nur bedingt gemeinsame Ziele verfolgte, spiegelt sich auch in dem schwierigen, persönlich belasteten Verhältnis zwischen Heine und Ludwig Börne. In den Jahren, die beide Schriftsteller gemeinsam im französischen Exil verbrachten, trat jener grundlegende Dissens zu Tage, über den Heine drei Jahre nach Börnes Tod im Jahr 1837 in einer Denkschrift öffentlich nachdachte. (Enzensberger 1997) Der Skandal, den das Werk erregte (der Hauptvorwurf galt dem Umstand, dass Heine sich kritisch und abwertend über die verstorbene Leitfigur der liberalen Bewegung äußerte), hat seinem Ansehen in der literarischen Öffentlichkeit der Zeit dauerhaften Schaden zugefügt. Neben diesem Aspekt hatte der Skandal auch eine Duellforderung zur Folge. Salomon Strauß, der Gatte von Jeanette Wohl-Strauß (der ehemaligen Lebensgefährtin Börnes), sah durch Heines ironisch-mehrdeutig gehaltene Darstellung der Beziehung seine Ehre verletzt. Das Pistolenduell fand am 7. September 1842 statt, Heine erlitt einen Streifschuss an der Hüfte.
Eheschließung
Wenige Tage zuvor – wohl um sie im Falle seines Todes rechtlich abzusichern – hatte der Schriftsteller seine langjährige Lebensgefährtin Augustine-Crescence-Eugénie Mirat geheiratet. Die kirchliche Trauung wurde am 31. August auf ihren Wunsch nach katholischem Ritus vollzogen, die standesamtliche Eheschließung erfolgte am 1. September. Kennengelernt hatte Heine die Französin bereits im Oktober 1834. Und wenngleich die Beziehung zu der jungen Frau, die aus einfachsten Verhältnissen stammte und als Schuhverkäuferin arbeitete, eine Mesalliance war und der Schriftsteller, wie Briefe bezeugen, verschiedentlich den Versuch unternahm, sich von ihr zu trennen, hatte die Beziehung bis zu seinem Tod Bestand. Sie „erheitert mir das Leben durch beständige Unbeständigkeit der Laune“, schrieb der Dichter im Mai 1836 die Beziehung charakterisierend an August Lewald in Stuttgart. (HSA XXI, 154)
Deutschlandreisen 1843 und 1844 – Haftbefehl
Mathilde, wie er sie nannte, begleitete ihn auch während seines zweiten Besuches, den er nach der Übersiedlung nach Paris im Juli 1844 in der deutschen Heimat machte. Die erste Reise nach Hamburg hatte er im Herbst des Vorjahres unternommen, um seine Mutter und seine Familie wiederzusehen und mit dem Freund und Verleger Julius Campe zusammenzutreffen. Literarische Frucht dieses, nach zwölf Jahren des Exils unternommenen Aufenthaltes war das Versepos Deutschland. Ein Wintermährchen, das im Herbst 1844 veröffentlicht wurde. Im gleichen Jahr verschärfte die preußische Regierung die Maßnahmen gegen sein Werk. Anlass waren einerseits Veröffentlichungen in den Deutsch-französischen Jahrbüchern, andererseits seine Kontakte zu der revolutionären Zeitschrift Vorwärts!. Betraf das Verbot zunächst „lediglich“ den Vertrieb seiner Schriften in preußischen Gebieten, so folgte bald ein Haftbefehl gegen den Dichter selbst, in dessen Folge sein zunächst freiwillig gewähltes Exil zu einem endgültigen wurde. Der Haftbefehl lautet: „Heinrich Heine, Literat; – alt 50 Jahre, mittlerer Gestalt, Nase und Kinn spitz, von markirtem jüdischen Gepräge. Er ist ein Wüstling, dessen gesunkener Körper das Dickwerden bemerken läßt.“ (Jahreszeiten. Hamburger Neue Mode-Zeitung 1845, Bd. 1, S. 855) Nach seiner im Jahr 1844 unternommenen Reise hat Heine seine deutsche Heimat nicht wiedergesehen.
Erbschaftsstreit
Die vierziger Jahre waren für den Dichter ohnehin eine schwierige Zeit: Bald nach seiner Rückkehr aus Hamburg erreichte ihn die Nachricht vom Tod seines Onkels Salomon. Dieser hatte seinen Neffen stets finanziell unterstützt, worauf dieser, angesichts der unregelmäßigen Einkünfte, die der Schriftstellerberuf ihm brachte, durchaus angewiesen war. (Werner 1978) Als der Haupterbe des Bankiers, Heines Vetter Carl, sich zunächst weigerte, die Zahlungen fortzusetzen, entwickelte sich eine fast zwei Jahre währende Auseinandersetzung, an deren Ende Carl zwar einlenkte, die den Gesundheitszustand des Dichters jedoch weiter angriff und untergrub. Bereits in jungen Jahren von schwacher physischer Konstitution hatte Heine durch Kur- und Sanatorienaufenthalte sich lange Jahre wenn nicht Besserung, so doch Linderung verschafft. Im Laufe der vierziger Jahre verschlechterte sich sein Zustand jedoch stetig. Er litt unter zeitweiligen Lähmungserscheinungen an den Extremitäten, so dass er nicht eigenhändig schreiben konnte, zudem war phasenweise der gesamte Unterleib paralysiert.
Krankheit
Die komplexe Symptomatik ist bereits von den Zeitgenossen sehr unterschiedlich bewertet worden. Heines Hauptleiden bestand in einer Erkrankung des Rückenmarks, die Lähmungserscheinungen in den Händen, Armen und Beinen hervorrief und in der Folge für die dauerhafte Bettlägerigkeit des Dichters ab dem Revolutionsjahr 1848 verantwortlich zu machen ist. (Montanus 1996) Wodurch das Rückenmarksleiden jedoch verursacht wurde, darüber gehen die Meinungen auseinander: Über eine lange Zeit hat man sich jener vom Dichter und seinen behandelnden Ärzten vertretenen Auffassung angeschlossen, er habe an den Spätfolgen einer syphilitischen Infektion, die er sich durch Ausschweifungen während seines Studiums in Göttingen zugezogen hat, gelitten. Andere Diagnosen lauteten auf eine myatropische Lateralsklerose oder eine tuberkulöse Infektion. Aber trotz detaillierter Studien, die von Medizinhistorikern in den vergangenen Jahren vorgelegt worden sind, ist es bis heute nicht möglich gewesen, die Krankheit des Dichters eindeutig zu diagnostizieren. (auf der Horst/Labisch 1999; auf der Horst/Labisch 2006)
„Matratzengruft“
Seit dem endgültigen gesundheitlichen Zusammenbruch, der im Mai 1848 erfolgte, blieb Heine acht Jahre lang bis zu seinem Tod an das Bett gefesselt. Die Ärzte behandelten ihn einerseits mit Aderlässen, andererseits mit immer höheren Gaben von Morphium. Die Krankheit hinderte ihn jedoch nicht an seiner Arbeit, auch wenn die Lähmungserscheinungen und der schlechte Allgemeinzustand den Dichter dazu zwangen, seine Texte zu diktieren. Die Gedichte des Romanzero und der Sammlung Gedichte. 1853 und 1854, die in den Jahren der „Matratzengruft“ entstanden sind, wie er selbstironisch sein Krankenlager nannte (HSA III, 153), dokumentieren nicht nur den Lebenswillen ihres Verfassers, sondern auch die seinem Werk selbst in dieser Spätphase innewohnende innovative Gestaltungskraft. Die Dichtungen dieser Zeit sind jedoch nicht nur literarische Betrachtungen über das eigene Leiden: Nach dem Scheitern der Revolution des Jahres 1848, das mit dem Beginn seiner Krankheit zusammenfällt, deutete der Dichter seine individuellen Erfahrungen als die exemplarischen Leiden seiner Epoche.
Neben Gedichtsammlungen entstanden in diesen Jahren auch autobiografische Schriften sowie Dichtungen, in denen er sich neuerlich mit mythologischen und religiösen Fragen auseinandersetzte. Schließlich überarbeitete er die in den vierziger Jahren für die Allgemeine Zeitung entstandenen Frankreich-Korrespondenzen und fasste sie zu dem Werk Lutezia. Berichte über Politik, Kunst und Volksleben zusammen. Nicht zuletzt wollte er auch in dieser Phase seines Lebens nicht nur als deutscher Schriftsteller wahrgenommen werden, weshalb er intensiv an einer französischen Ausgabe seiner Werke arbeitete, die ab 1855 bei Lévy frères in Paris veröffentlicht wurde.
In den Feuilletons der Zeitschriften und Journale wurden in diesen Jahren nicht nur die literarischen Werke Heines thematisiert. Zahlreiche Paris-Reisende, die den Dichter in seinem Krankenzimmer aufsuchten, berichteten von ihren Gesprächen mit dem Sterbenden und prägten auf diese Weise sein Bild, das in der deutschen Öffentlichkeit diskutiert wurde. (Werner 1973) Elise Krinitz gehörte zwar nicht zu den prominentesten Besuchern dieser späten Jahre; der durchaus auch erotisch gefärbten, aufgrund seines Gesundheitszustandes aber platonisch geführten Beziehung, die sich zwischen dem Dichter und der jungen Frau zwischen Juni 1855 und Februar 1856 entwickelte, hat Heine gleichwohl in den Gedichten an die „Mouche“ ein literarisches Denkmal gesetzt. (Folkerts 1999)
Tod und Beisetzung
Nach acht Jahren, während derer er, wie er selbst bemerkte, zu einem „spiritualistischen Skelette“ abgemagert war (HSA III, 153), starb Heinrich Heine am 17. Februar 1856, wie die zeitgenössischen Ärzte konstatierten, an Schwäche in Folge eines Blutsturzes. Drei Tage später, am 20. Februar wurde er, seinem testamentarisch formulierten Wunsch gemäß, ohne kirchliche Einsegnung auf dem Pariser Friedhof Montmartre beigesetzt. Zu den ca. 100 Trauergästen, die seinem Sarg folgten, gehörten auch die Schriftsteller Alexandre Dumas und Théophile Gautier.