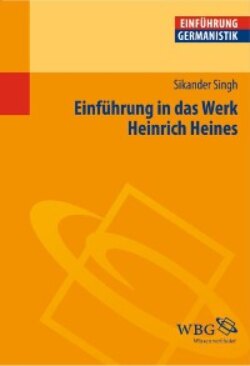Читать книгу Einführung in das Werk Heinrich Heines - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. Heinrich Heine im 21. Jahrhundert
ОглавлениеUrteile der Literaturgeschichte
Im Gegensatz zu vielen anderen Autoren der Literaturgeschichte, deren Dichtungen und Schriften von ihren Zeitgenossen in ihrem Rang und ihrer Bedeutung verkannt und deshalb nicht gelesen wurden, fanden die Werke Heinrich Heines bereits zu seinen Lebzeiten eine außerordentliche Beachtung. Je nach weltanschaulicher und ästhetischer Ausrichtung galt er als Künder einer neuen Epoche, einer neuen Literatur, die in Form, Sprache und Inhalt richtungsweisend war, oder als ein charakterloser Schriftsteller (ein Jude, Exilant und Vaterlandsverräter zudem), der mit moralischen und ästhetischen Werten brach und deshalb als Vorbote eines kulturellen Verfalls gesehen wurde.
Die Geistesgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts hat diese Urteile lange überholt und der hohe Rang der Werke Heines im Diskurs der deutschen Literatur gilt heute als unumstritten. Trotzdem nehmen seine Dichtungen und Schriften – im Gegensatz zu denen anderer Schriftsteller – bis in die Gegenwart eine Sonderstellung ein. So ist er der einzige Dichter, der in Deutschland wie in Frankreich gleichermaßen als ein kanonischer Autor der jeweils eigenen nationalen Literatur angesehen wird – bereits aus diesem Grund kann er als einer der ersten europäischen Denker und Intellektuellen gelten. Andererseits hat es beispielsweise in seiner Geburtsstadt Düsseldorf erst vor wenigen Jahrzehnten eine lang anhaltende, erbittert geführte Kontroverse gegeben über die Frage, ob die dortige Universität seinen Namen tragen solle – der internationales Aufsehen erregende Streit wurde im Jahr 1988 zugunsten einer Benennung nach dem Dichter entschieden. Ohnehin provozierten seine Person, sein Werk aber auch seine Nachwirkung immer wieder Skandale, die nicht nur von dem begrenzten Horizont der Vertreter einer lokalen (Kultur-)Politik Zeugnis ablegen, sondern auch sichtbar machen, dass selbst über 150 Jahre nach seinem Tod die ungebrochene Ehrung dieses Schriftstellers in Deutschland noch nicht ganz unproblematisch ist.
Dies als einen Gradmesser für Heines Aktualität zu werten, bedeutete allerdings einen Trugschluss. Denn die Debatten, welche von der Nachwelt über einen Dichter geführt werden, sagen nur bedingt etwas aus über die Frage, ob die Themen- und Problemfelder, die in seinen Werken behandelt werden, einen Beitrag zu leisten vermögen zu den gesellschaftlichen oder ästhetischen Diskursen der Gegenwart. – Abgesehen von der Frage, ob dies überhaupt ein Kriterium ist, nach dem das literarische Kunstwerk angemessen bewertet werden kann und darf.
Romantische Kunstanschauung
Worin also liegt die Aktualität, die fortwährende Relevanz der Dichtungen und Schriften Heinrich Heines begründet? Die literaturgeschichtlich zentrale Frage, mit der sich seine Werke auseinandergesetzt haben, ist die nach der Bedeutung der klassisch-romantischen Ästhetik für seine Gegenwart. Bereits in den frühen Dichtungen, mit denen der junge Heine zu Beginn der zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts an die Öffentlichkeit trat, befragte er die Bilder und Metaphern, die Themen und Vorstellungen der spätzeitlich gewordenen Romantik auf ihre Relevanz für den Diskurs einer nunmehr veränderten zeit- und geistesgeschichtlichen Verfasstheit. Wenngleich er sich bis in sein Spätwerk mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, dokumentieren die Urteile der Nachwelt, sowohl im 19. als auch im 20. Jahrhundert, die dominierende Stellung der romantischen Kunstanschauung: Die abwartende oder ablehnende Haltung weiter Teile eines bildungsbürgerlichen Lesepublikums resultiert aus dem Widerspruch zwischen ihrer eigenen, romantisch geprägten Vorstellung des „Kunstschönen“ und dem ironischen Umgang Heines mit dieser Vorstellung. Die Gebrochenheit der Bildlichkeit und des Tons, die vielzitierten Stimmungswechsel, mit denen seine Gedichte und Prosatexte den Leser nicht nur konfrontieren, sondern allein lassen, irritieren und provozieren deshalb bis in die Gegenwart.
Frühe Moderne
Die Gebrochenheit oder Zerrissenheit – um ein Wort aufzugreifen, mit dem Heines Zeitgenossen diese Problematik bezeichneten – meint aber auch die Reflexion des Menschen über seine ontologische Verfasstheit. Nach der Dekonstruktion der Religion und ihrer paradigmatischen Stellung im gesellschaftlichen Diskurs durch die Philosophie der Aufklärung im 18. Jahrhundert, nach der sich diesem Prozess anschließenden Dekonstruktion Gottes thematisiert Heine die Erfahrungen von Einsamkeit und Entfremdung, stellt er die Frage nach dem Inhalt und der Bedeutung der menschlichen Existenz. Die Liebenden und Leidenden, die Kämpfer und Geschlagenen, die Helden und Narren seines Werkes sind Figurationen des Menschen, der in einer Welt, in der eine übergeordnete transzendente Instanz ihren normativen Einfluss verloren hat, nach einem individuellen Sinn sucht. Diese geistesgeschichtliche Verfasstheit, die seine Dichtungen abbilden, unterscheidet sich nicht wesentlich von der existentiellen Ratlosigkeit unserer eigenen Gegenwart. In der frühen Moderne ist es Heine gelungen, jene Sinnfragen auf eine prägnante, eindringliche und gültige Weise in literarische Bilder und Metaphern zu kleiden, die in der Post- (oder auch Post-Post-)Moderne unverändert dringlich geblieben sind. In diesem Zusammenhang ist in besonderer Weise hervorzuheben, dass Heine eben nicht den Versuch macht, Antworten auf diese Fragen zu finden. Stattdessen thematisiert er die Ratlosigkeit, die Folge eines Bewusstseins ist, aus dem heraus Antworten nicht mehr gegeben werden können.
Seine Aktualität erweist sich jedoch nicht nur im Bereich existentieller Fragestellungen. Im Paris der dreißiger, vierziger und fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts wird Heine zum Zeugen und Chronisten eines tiefgreifenden sozialen Veränderungsprozesses. Die Gesellschaft wandelt sich von einer agrarischen zu einer industriellen, von einer auf Subsistenz beruhenden Wirtschaft zu einer auf den Grundsätzen des Kapitals fußenden ökonomischen Ordnung. Indem der Schriftsteller Prozesse der unaufhaltsamen Beschleunigung des Lebens, den Einfluss der Macht des an den Börsen akkumulierten Kapitals auf das Leben des Menschen untersucht, indem er über die Bedeutung des schnellen Verkehrs von Waren und Personen für die Volkswirtschaft nachdenkt und über Prozesse der Globalisierung, die durch die Kolonialisierung der Länder Afrikas und des Vorderen Orients durch europäische Mächte ihren Anfang nimmt, gelangt er zu einer Diagnose seiner Gegenwart, die für die entfesselten ökonomischen Verhältnisse am Beginn des globalisierten 21. Jahrhunderts unverändert ihre Gültigkeit bewahrt hat. Man sollte hieraus jedoch keineswegs den Schluss ziehen, der Dichter habe prognostische oder gar prophetische Kräfte besessen. Vielmehr sind die Erkenntnisse und Einsichten, die Heine über die Zustände seiner Zeit mitteilt, deshalb noch aktuell, weil unsere Gegenwart sich in der Endphase jenes Prozesses befindet, der in seiner Epoche seinen Anfang genommen hat.
Kunstautonomie
Nun gibt es – gerade in der Literatur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – zahlreiche Schriftsteller, welche diese ontologischen und ökonomischen Entwicklungen in ihren Werken thematisiert haben und die gleichwohl aus den Diskursen unserer Zeit verschwunden sind. Die ungebrochene Modernität Heines erwächst daraus, dass er – trotz des politischen und sozialen Engagements, das sein Werk auszeichnet – den künstlerischen Anspruch niemals aufgegeben hat. In der Erkenntnis der tiefsten Ratlosigkeit ob des Zustandes der Welt glaubt Heine an das Unbedingte und Ausschließliche der Kunst. Er erachtet sie nicht als eine Möglichkeit oder Hoffnung, den Menschen oder die Welt zu bessern, sondern als einen Akt der Revolte gegen das zerstörerische Potential einer Ordnung, die nur mehr von vermeintlichen ökonomischen Notwendigkeiten bestimmt wird. Unter dem Schlagwort der Emanzipation streitet Heine nicht nur für Menschen- und Bürgerrechte, nicht nur für die Grundsätze von Freiheit und Gleichheit, nicht nur für den Frieden und die Aussöhnung zwischen den Völkern und Nationen, sondern auch für die Kunst als einen Bereich, in dem der Mensch sich frei und ohne Zwänge dem ihm gegebenen anthropologischen Potential im Spiel der Gedanken und Gefühle hingeben kann und auf diese Weise gegen das Nützlichkeitsdenken der Moderne zu revoltieren und seine politische Freiheit und ontologische Autonomie zu behaupten vermag. „Wie Sie wissen“, notiert Heine in den Briefen Über die französische Bühne in diesem Sinne, „bin ich für die Autonomie der Kunst; weder der Religion, noch der Politik soll sie als Magd dienen, sie ist sich selber letzter Zweck, wie die Welt selbst.“ (HSA VII, 260)