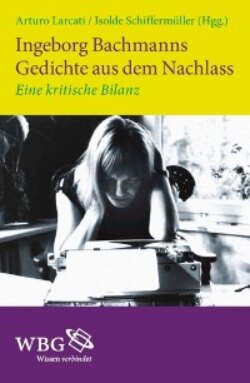Читать книгу Ingeborg Bachmanns Gedichte aus dem Nachlass - Группа авторов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schwierigkeiten beim Lesen von Ingeborg Bachmanns Gedichten aus dem Nachlass
Оглавление1. „Fragen und Scheinfragen“
Die Irritation, ja die Verstörung und Empörung, die die Lektüre von Ingeborg Bachmanns Gedichten aus dem Nachlass hervorrufen konnte, zeigte sich beispielhaft an den heftigen und kontroversen Reaktionen, die der Band Ich weiß keine bessere Welt in der Presse ausgelöst hat. Wohl selten wurden Gedichte zum Anlass einer so erregten und erbitterten Debatte, die sich nicht allein – und sicherlich teilweise auch zu Recht – auf die Edition bezog1 und auch nicht bloß die ästhetische Form und Qualität dieser nie autorisierten Verse betraf, grundsätzlicher und radikaler stand vielmehr die Legitimität der Veröffentlichung intimer Aufzeichnungen ebenso wie die Poetizität der publizierten Texte zur Diskussion, deren prosaisch direkte Diktion manche Kritiker am „poetischen Mehrwert“ der Sprache zweifeln ließ. Hauptsächlich ging es also um die Frage, ob es sich hier denn wirklich um Gedichte handle oder nicht vielmehr um die indiskreten Zeugnisse einer „Lebens- wie Schreibkatastrophe“2, in denen „der ungereinigte Lebensschlamm“ (Hamm) an die Öffentlichkeit gezerrt werde, um so den unwilligen Leser in die erbärmliche Rolle des Voyeurs zu zwingen. Starkes Vokabular also war die Reaktion auf eine poetische Sprache, die sich den ersten Kritikern ungeschützt, fassungs- und formlos darbot, für die einen enthemmt, peinlich, geschmacklos, beklemmend und traurig-banal – dies die Attribute, die in der Tagespresse wiederkehren –, für die anderen umso authentischer und wahrer im Ausdruck einer bitteren und herben Verzweiflung, die hier das Leben ebenso wie die Poesie zu erfassen scheint. Ingeborg Bachmanns „unveröffentlichte Gedichte“, ein Konvolut von Blättern und Notaten, das jahrelang unter Verschluss gehalten wurde, wirkten als Provokation der Literaturkritik. Schwierig zu qualifizieren sind diese Aufzeichnungen aus dem Nachlass, Handschriften und großteils Typoskripte, die im Band erklärtermaßen weder chronologisch noch textkritisch geordnet sind, es sind Fragmente, die oft mitten im Vers abbrechen, Entwürfe und Textvarianten, die einen faszinierenden Fundus für die textgenetische Forschung darstellen können, Material für das Studium einer Poetik des verstörten und verstörenden Schreibens, das zerstörerischen historischen Erfahrungen abgerungen ist.3
Wenn sich die Archive öffnen – wie der Klappentext ankündigt –, mag die Gelassenheit des Philologen die angemessene Haltung sein, um letztlich ein ausgewogenes Urteil anzustreben. Dieser Beitrag will zunächst jedoch das Erregungspotential der Texte aus dem Bachmannschen Nachlass befragen, die Verstörung des Lesers, die symptomatisch anzeigt, dass hier eine Schwelle berührt wird, auf der die Poesie ihre eigene Fragwürdigkeit ins Spiel bringt und ihre Legitimität aufs Spiel setzt. Die viel diskutierte Frage, ob es sich hier um Gedichte oder nur um biografische Aufzeichnungen handle, kann den problematischen Charakter der Nachlassgedichte allerdings kaum erfassen; schief benannt ist deren unauflösbare Ambivalenz in diesem aut aut zwischen Schmerzdokument und Poesie, das lähmend unfruchtbar und letztlich unentscheidbar ist.4
Die gattungstheoretische Alternative, die das lebensgeschichtliche Zeugnis vom poetischen Text unterscheiden will, könnte zu jenen „Scheinfragen“ zählen, die Ingeborg Bachmann in den Frankfurter Vorlesungen bekanntlich klar getrennt hat von den Fragestellungen, die den Schriftsteller bewegen und die zuallererst „die Rechtfertigung seiner Existenz“ (IV, 186) betreffen. Zu Recht wurde die exemplarische Bedeutung der Bachmannschen Poetik für die Standortbestimmung der Nachkriegsliteratur betont5: Insbesondere die Frankfurter Vorlesungen repräsentieren das kulturelle Selbstverständnis der Epoche, das geprägt ist von der gesellschaftlichen Realität des Kalten Kriegs und des Wirtschaftswunders, von der Philosophie des Existentialismus und der kritischen Theorie, von einem Lebensgefühl, das die individuelle Leiderfahrung spiegeln will in der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts.6 In diesem Kontext findet die Poesie ihre Legitimation vor allem in einem moralischen Engagement, das sich abgrenzt vom Ästhetizismus, in einem Antrieb, den die Bachmann als „einen moralischen vor aller Moral“ (IV, 192) bezeichnet, ihre authentische Beglaubigung aber sucht sie in einer Schmerzerfahrung, in der der romantische Mythos vom gefährdeten Künstler weiterlebt. Ingeborg Bachmanns posthume Lyrik kann als Zeugnis gelesen werden für die Infragestellung solcher Grundsätze und Mythen, die das poetische Selbstverständnis der Nachkriegszeit begründen, als mise en abyme einer radikalen Krise, die die Wurzeln des poetischen Sprechens erfasst, die moralische Legitimation der Dichtung ebenso wie ihre authentische Beglaubigung in der Schmerzerfahrung des Schriftstellers, so wie sie in den Frankfurter Vorlesungen formuliert wurden. Wieweit dies wenn nicht eine Revision, so doch eine Akzentverschiebung oder gar Neubegründung des Schreibens aus der Krankheit bedeutet, bleibt zu untersuchen. Reduktiv wäre es auf jeden Fall, die Bedeutung dieser Texte festzulegen auf ihre biographische Interpretation und damit auf verifizierbare Ereignisse und Personen im Leben der Autorin. Nachzugehen ist hier vielmehr der Frage, ob diese Dokumente einer psychischen Krise und Krankheit auch als Manifest oder zumindest als Ansätze einer neuen Poetik lesbar sind.
2. „Ich ohne Gewähr“
Die Gedichte, Fragmente, Entwürfe und Textvarianten, die im Band Ich weiß keine bessere Welt versammelt sind, bilden ein Netz von thematischen Konstellationen, in denen ein Grundmotiv wiederkehrt: die Klage um den Verlust der Gedichte, um das Verfehlen des poetischen Wortes, die Bedrohung des lyrischen Ich durch eine Aphasie, die immer wieder ganz explizit und direkt benannt wird:
Meine Gedichte sind mir abhanden gekommen.
Ich suche sie in allen Zimmerwinkeln.
Weiß vor Schmerz nicht, wie man einen Schmerz
aufschreibt, weiß überhaupt nichts mehr.
Weiß, daß man so nicht daherreden kann,
es muß würziger sein, eine gepfefferte Metapher.
müßte einem einfallen. Aber mit dem Messer im Rücken. (KBW, 11)
Betont werden muss: die Texte sprechen über das Scheitern des poetischen Wortes und über den Verlust der Gedichte, meist im trockenen und prosaischen Tonfall einer unverblümten Feststellung. Ebenso direkt wird der Schmerz angesprochen, der das Überleben des lyrischen Ich bedroht und der ihm seine Stimme raubt, so etwa im Gedicht Die Folter:
[…] daß ich nie
zur Ruh komm, daß
das dauert, dieses Eisen
im Leib, diese Faust auf dem Schädel, diese Geisel
am Rücken […] (KBW, 95)
und weiter:
[…] mich
frißt ein größerer Hai
ein Raubfisch, der
heißt Schmerz. (KBW, 96)
Benannt wird ein Schmerz, der keinen Ausdruck und keine Worte mehr hervorbringt, nur hässliche und entstellte „Mundgeburten“ wie es im Gedicht An Ingmar Bergman, der von der Wand weiss heißt: „Ich hab keine Worte mehr / nur Kröten […].“ (KBW, 65) Und dennoch weiß das lyrische Ich, dass es allein noch in diesem Schmerz am Leben ist, der die Authentizität seiner Worte verbürgen sollte:
Das Herz schlägt nicht mehr.
Wie wird das enden? Ich bin langweilig
geworden und so langsam, und so kalt,
daß ich ohne meinen Schmerz nicht mehr am Leben wäre. (KBW, 22)
Die Sprachlosigkeit, von der in diesen Versen die Rede ist, ist radikaler noch als jener Verzicht auf die schönen Worte und auf die Effekte der Metapher, der im Gedicht Keine Delikatessen thematisiert wird. Während die poetologischen Gedichte der Spätphase, die 1968 im Kursbuch veröffentlicht wurden, den Scheincharakter der Kunst angreifen, um die Grenze der Sprache und das Schweigen des poetischen Wortes zu erkunden und das Unsagbare lesbar zu machen7, sprechen die Nachlassgedichte von einer Aphasie, die ganz konkret und buchstäblich verstanden werden will:
Ich habe nicht geschwiegen,
weil Schweigen gut ist schön ist,
ich hatte nichts mehr zu sagen (KBW, 71).
Viele der abgebrochenen und bruchstückhaften Verse aus dem Nachlass lesen sich als Mimikry an eine verzweifelte Sprachlosigkeit, die sich nur noch stammelnd und formlos äußern kann und keine poetischen Figuren mehr findet, so etwa in den folgenden Zeilen:
und bettle und wein,
seht ihr’s, aber ich hab
nicht die große Musik
die abführt einen der den Abgang
nicht findet, in den Schlaf,
in den Tod.
Verklärung – für uns nicht,
für die anderen, die
Figuren, die sind reiner, (KBW, 72)
Diese radikale Aphasie führt nichts ins Schweigen, sie erzeugt paradoxerweise eine obsessive und repetitive Rede, einen permanenten Ausdruckszwang, der den Mangel füllen will, Worte wie Drogen (Die Drogen, die Worte; KBW, 68 –73), denen das lyrische Ich nicht trauen kann. Verdacht lautet der Titel von zwei Gedichtfassungen (KBW, 127–128), die die Gewalt dieses tödlichen Ausdruckszwangs thematisieren, über den auch die folgenden titellosen Verse sprechen:
Immerzu in den Worten sein, ob man will oder nicht,
Immer am Leben sein, voller Worte ums Leben,
als wären die Worte am Leben, als wäre das Leben am Wort.
(KBW, 126)
Wo sich Wort und Leben trennen, steht das Überleben des lyrischen Ich auf dem Spiel. Bachmanns posthume Gedichte inszenieren die Aporien eines schreibenden Ich, das nicht mehr zur Existenz kommen kann. „Ich existiere nur, wenn ich schreibe, ich bin nichts, wenn ich nicht schreibe, ich bin mir selbst vollkommen fremd, aus mir herausgefallen, wenn ich nicht schreibe“ (IV, 294) – so Ingeborg Bachmann anlässlich der Verleihung des Wildgans-Preises im Jahr 1972. Schon Jahre vorher hatte sie ihre dritte Frankfurter Vorlesung den Problemen des schreibenden Ich gewidmet, seinem Auftritt in der Dichtung als bloße Diskursinstanz, als rein formales und rhetorisches Ich, dessen Verbindlichkeit in Frage steht, ein „Ich ohne Gewähr“, das die Literatur zum „Versuchsfeld“ seiner „geträumten Identität“ wie seiner „verrückten Entdeckung“ (IV, 218 – 219) macht. Die Überzeugung, die Ingeborg Bachmann – über die luzide literaturgeschichtliche Analyse hinaus – in ihrer dritten Vorlesung ausspricht, gilt dem Existenzbeweis dieses schreibenden Ich: „Ich möchte beinahe behaupten, dass es kein Roman-Ich, kein Gedicht-Ich gibt, das nicht von der Beweisführung lebt: Ich spreche, also bin ich“. (IV, 225) Nicht das logozentrische cogito ergo sum ist hier gemeint, das der Satz gleichwohl anklingen lässt, sondern die Hoffnung des Schriftstellers, dass das schreibende Ich seinen Triumph haben werde, „heute wie eh und je – als Platzhalter der menschlichen Stimme“ (IV, 237), eine Überzeugung, die einem Glaubensbekenntnis des Schreibenden gleichkommt: „Es ist das Wunder des Ich, daß es, wo immer es spricht, lebt“. (IV, 237) Die Gedichte aus dem Nachlass lesen sich wie ein demento dieses Wunderglaubens, als würde der elementare Existenzbeweis des lyrischen Ich einer radikalen Krise ausgesetzt, als müsste das schreibende Ich seine Selbstberechtigung aufkündigen und zweifeln an seinem Grundsatz „ich spreche, also bin ich“, als bliebe das Verbum sein in diesem verzweifelten Sprechen ohne Resonanz, eine fragile und tonlose Stimme, die sich dem Schrei und dem Schluchzen annähert und die vergeblich „Halt an einem Wort“ (IV, 237) sucht. „Erwürgt von Banalitäten“ (KBW, 27) – so heißt es im Fragment Für C. E. – behauptet dieses lyrische Ich seine Stellung am falschen Ort („Nämlich ich / bin, wo ich / nicht sein kann“; KBW, 95) und dennoch klagt es immer wieder sein Recht auf Existenz ein wie in der letzten Strophe des Gedichts Ach:
Geh ich,
der einer ist
und noch sein will
ohne Musik, ohne Trotz
sein will ich und forthin
dauern, nicht zum Trotz,
aber trotzdem. (KBW, 26)
Aus den zitierten Versen spricht ein heroisches Ich, das sich der Krankheit und der Sprachlosigkeit zum Trotz zu Wort meldet und moralisch behaupten will. Dieser Heroismus des schreibenden Ich, der die Sprechhaltung vieler Gedichte aus dem Nachlass kennzeichnet und in diesen gleichsam nackt zu Tage tritt, wird bereits in den Frankfurter Vorlesungen explizit angesprochen als ein konstitutives Element der Bachmannschen Poetik. Selbst dem Beckettschen Namenlosen, der sich von der Sippschaft der Menschen ins Gemurmel der Tonne zurückgezogen hat, will die Bachmann dieses Heldentum andichten: „noch immer ein Held, der Held Ich, mit seinem Heroismus von jeher“. (IV, 236)
Nicht die Suspension der Identität oder ihr Zugrundegehen im poetischen Sprechen, sondern die heroische Selbstbehauptung scheint in den posthumen Gedichten der Grundgestus des schreibenden Ich zu sein; dieses spaltet sich auf in ein vom Schmerz zerstörtes und ein intellektuell starkes Ich, das die Aphasie der Emotionen souverän mit seinem poetologischen Bewusstsein beantworten kann. Die meta-poetische Reflexion ist integraler Bestandteil der Bachmannschen Gedichte, die insofern auch die germanistische „Zunft“ ansprechen, von der sich Dichter wie Paul Celan ganz bewusst fernhalten wollen.8 Das Ich als Diskursinstanz eines meta-poetischen Sprechens fällt in diesen Texten ein schonungsloses Urteil über das Scheitern des poetischen Wortes. Eine unentscheidbare Ambivalenz scheint jedoch selbst dieses Scheitern zu betreffen, denn schwierig zu beantworten ist die Frage, wie der Verlust und das Verfehlen der Poesie, das in den Gedichten aus dem Nachlass geradezu zwanghaft benannt wird, zu lesen ist. Als Thema und Reflexion über das Ende der Poesie, als „Paradox eines kunstfernen Wegs“9, der sich in die Richtung einer neuen Poetik bewegt oder als Symptom und Diagnose einer Krankheit, die auch das poetische Sprechen erfasst und die Dichtung letztlich scheitern lässt?
3. „vivere ardendo e non sentire il male“
Über das Ende der Poesie schreibt Ingeborg Bachmann in ihren Frankfurter Vorlesungen: „Denn wenn man über das, Ende der Dichtung‘ zu reden anfängt, eine solche Möglichkeit schwelgerisch oder gehässig erwägt, als wäre es die Dichtung selbst, die zu Ende gehen wollte, oder als wäre dieses Ende ihr letztes Thema, so kann man nicht außer acht lassen, wo eine der Voraussetzungen dazu immer gelegen hat. In den Dichtern selbst, in ihrem Schmerz über ihre Unzulänglichkeit, in ihren Schuldgefühlen.“ (IV, 187) Die Lyrik der Bachmann sucht – so wird auch aus ihren theoretischen Stellungnahmen deutlich10 – ihre authentische Beglaubigung in einer extremen Lebens- und Leiderfahrung des Schreibenden, die posthumen Gedichte zeigen allerdings gerade in dieser Hinsicht ein eigenartiges Doppelgesicht. Hart, direkt, schonungslos meldet sich in ihnen einerseits eine Verzweiflung zu Wort, die vergeblich um ihren poetischen Ausdruck ringt, andererseits aber stellt das lyrische Ich seinen Schmerz immer wieder in rhetorischen Formeln emphatisch zur Schau. Ein melodramatischer Gestus charakterisiert viele dieser Verse, in denen sich das lyrische Ich zum Protagonisten eines Schauspiels macht, das den Blick der anderen auf sich ziehen will. Leitmotivisch wiederholt sich in vielen Gedichten der Appell „Seht ihr, Freunde, seht ihrs nicht!“, in dem die Worte aus der Wagnerschen Oper Tristan und Isolde anklingen:
Seht ihr, Freunde, seht ihrs nicht!
daß ichs nicht überlebt
auch nicht überstanden habe, seht ihrs nicht, (KBW, 115)
Im Finale des Wagnerschen Dramas meint das „Seht ihr, Freunde!“ die Vision des Geliebten, die im Liebestod der Isolde aus der Einbildungskraft des Gefühls erstrahlt, in Bachmanns Versen ohne Tristan ist die Figur des anderen abwesend, die pathetische Gebärde bleibt gleichsam leer, ein rhetorischer Gestus des Ich, das sich zum Schauspieler und Regisseur eines Dramas macht, in dem nichts anderes als die eigenen tribula mortis ausgetragen werden. Die Überlebensstrategie des lyrischen Ich, das sich in die exhibitionistische Ausstellung des Leidens rettet, trägt einen hysterisch-theatralischen Zug11, sprachloser Schmerz und pathetische Rhetorik verschränken und verwirren sich in diesem Melodrama der Leidenschaft, das sich als Debakel der Ausdruckskunst liest. Im Schauspiel des Ecce artista kann das lyrische Ich die verschiedensten Rollen interpretieren: Es kann die großen Gesten der Oper vorführen und dabei die Gewänder von Tosca oder Isolde tragen, es kann sich identifizieren mit den Figuren des gefährdeten Dichters, mit dem Propheten oder mit dem Dichter im Wahnsinn wie Hölderlin, es kann sich der Topoi der literarischen Tradition bedienen, die Celan, Benn oder Büchner bereitgestellt haben.
Ein ganzes Repertoire von literarischen Formeln und Figuren wird in den Nachlass-Gedichten von Ingeborg Bachmann zitiert. Die Intertextualität als distinktiver Zug ihrer Lyrik, der die Kritiker von Beginn an intensiv beschäftigt hat12, scheint frühe und späte Gedichte zu verbinden, die posthume Lyrik zeigt allerdings auch in dieser Hinsicht ein eigentümliches und zwiespältiges Gesicht: Ihre intertextuelle Vernetzung geht aus keinem souveränen Spiel mit den Texten der Tradition hervor, über die der Autor als poeta doctus verfügt, in ihr scheint sich die Sprache auch nicht so sehr (oder nicht allein) auf eine polyphone Mehrstimmigkeit zu öffnen, auf literarische Korrespondenzen und Affinitäten, die Texte vermitteln vielmehr den Eindruck, als zeugten sie von einer Heimsuchung der Sprache durch fremde Stimmen und kollektive Formeln. Oft wirken die Zitate wie eine Flucht ins fremde Idiom, in Fremdsprachen wie das Italienische oder das Spanische, die nach eigenen Worten wie „auf einer alten gestohlenen Platte“ (KBW, 11) klingen. Nimmt man das Bekenntnis der Bachmann ernst – „Es gibt für mich keine Zitate, sondern die wenigen Stellen in der Literatur, die mich aufgeregt haben, sind für mich das Leben“ (GuI, 69) – so scheint aus den Worten der anderen, die die posthumen Gedichte zitieren, oft ein falsches, ein ausgeliehenes oder gestohlenes Leben zu sprechen.
Die Faszination durch das Pathos fremder Worte prägt auch die Sprache der Leidenschaft, die sich hier als authentisch weibliche ausgibt. Claudia Albrecht hat am Romanfragment Das Buch Franza gezeigt, wie sich die Leidenschaft der Protagonistin nach dem Modell der Koloniallegenden formt und wie sie vom Fundus kollektiver Phantasien zehrt, von einem Kolonialismus, der die „Geschichte im Ich“ (IV, 230) besetzt und die Imagination unterwandert bis in die entlegenen Winkel der österreichischen Provinz hinein: „Sire, this village is yours“13, so beispielhaft der Satz, mit dem Franza nach dem Krieg sich selbst und ihr Land dem englischen Soldaten zu Füßen legt. Ironische oder kritische Distanz wäre angesagt gegenüber der Erotisierung des Machthabers, die so charakteristisch ist für die Bachmannsche Sprache der Leidenschaft und diese kennzeichnet mit einem unauflöslichen Doppelgesicht: einerseits hysterischer Schatten kollektiver Machtstrukturen, andererseits Vehikel des weiblichen Wunsches, dem Repräsentanten der Macht das Gesicht der Liebe zu verleihen. Dieses Begehren, die Macht, ja die Gewalt des anderen in Liebe zu verwandeln, inspiriert den Eros ihrer poetischen Sprache.14 In den Gedichten aus dem Nachlass muss die erotische Inspiration der Sprache jedoch an eine Fürsprecherin, an die wahre Dichterin Gaspara Stampa delegiert werden. Die fremd faszinierende Diktion ihrer Verse – „vivere ardendo e non sentire il male“ – wird zum Motto einer Reihe von Gedichten und damit zum Leitstern einer Leidenschaft, die im poetischen Sprechen die Leiden der sexuellen Differenz überwinden soll:
Alla più umile, alla più umana, alla più sofferente (KBW, 116), so der Titel eines dieser Gedichte, in dem sich das lyrische Ich dem Schlaf hingibt, während es die poetessa des Cinquecento als „Genie der Liebe“ anruft:
Und sie lebt für mich, sie weiß zu leben,
leidets für mich, wird verhöhnt, geschmäht,
verstoßen und verdammt, sie leidet es. (KBW, 116)
Rainer Maria Rilke zählte Gaspara Stampa bekanntlich im Malte zu den „gewaltigen Liebenden“, die „während sie ihn riefen, den Mann überstanden, die über ihn hinauswuchsen, wenn er nicht wiederkam“.15 Tief eingeprägt hat sich dem germanistischen Gedächtnis, das auch der Bachmann nur allzu präsent ist, die pathetische Mahnung der Ersten Duineser Elegie: „Ist es nicht Zeit, dass wir liebend / uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehen.“16
Gemessen an dieser Hoffnung lesen sich die Gedichte aus dem Nachlass wie das Zeugnis eines verzweifelten Werbens: „um jeden werb ich / und keinen gewinn ich“ (KBW, 25), so heißt es im Gedicht Werbung. Hier wie auch in anderen Versen, die vom Ausbleiben der Inspiration sprechen, verfällt das poetische Sprechen ins Weinen, Jammern und Betteln, um immer wieder nur die eine Klage zu erneuern: „daß / nicht und niemals, nie es ihn bewegt“ (KBW, 121). Reduktiv und banal wäre eine bloß biographische Interpretation, die den kalten und unbeweglichen Anderen mit dem ehemaligen Lebensgefährten Max Frisch identifizierte oder die Aphasie der Gefühle als Element einer psychischen Krankheit der Autorin diagnostizierte. Was auch für den Leser kalt bleibt, ist der Eros der poetischen Sprache, ein symbolischer Anderer, der das Wort beleben, erwärmen und erneuern könnte. Ingeborg Bachmanns sprachliche Leidenschaft gerät so in den posthumen Gedichten zur Mimikry an die Sprache der Gewalt, die sie aus der Welt schaffen will. Zerstört, rachsüchtig und krank vor Hass („Der Haß hat mich krank gemacht, / ich bin entstellt“; KBW, 115) begibt sich das lyrische Ich in Feindeshand (KBW, 139) und wohnt der Höllenfahrt des poetischen Eros bei. Die Macht des anderen, an den es sein Begehren richtet, pervertiert zur sadistischen Instanz, die das weibliche Ich nur quälen, vernichten und zum Objekt degradieren kann. Dass sich in diesem Drama der Selbstzerstörung, das die Gedichte in Szene setzen, der geliebte und zugleich verhasste Mörder kaum identifizieren lässt, zeigt beispielsweise das Gedicht Un altra notte ancora senza vederlo, dessen Titel wiederum in der Fremdsprache gehalten ist und das mit folgenden Zeilen beginnt:
Daß keiner meiner Schmerzen
ihn beweget
(der Himmel, nein vom
Himmel red ich nie,
also von ihm, da doch vom Himmel
nicht)
daß nichts und nichts und
alles ihn nie bewegt, (KBW, 123)
Die dritte Person, die diese Verse ansprechen, oszilliert und changiert wie der Pol einer psychischen Projektion, abwechselnd scheint der andere ein männlicher Abgott zu sein, der sich als kalter und sadistischer Vertreter der sexuellen Differenz erweist oder er ist eine gleichsam vertikale Alterität, die als Himmel benannt und zugleich negiert wird, wie um den fehlenden höheren Auftrag der Dichtung zu bestätigen. Besonders deutlich tritt schließlich in diesem Gedicht der aggressive und destruktive Impetus in den Vordergrund, der die Grammatik der Verse zerbricht und ihre Form in Fragmente zerstückelt: Das Gedicht schließt mit einer gedrängten Folge von Partizipien, die kein Subjekt mehr zulassen und so die Objektivierung und Zerstörung des Ich unwiderruflich festschreiben. Buchstäblich, roh und direkt, ohne jedes lyrische Pathos, wird das objektivierte Ich in dieser brutalen Sequenz festgenagelt bis zum unvermittelten Abbruch des Gedichts:
… ich gesotten, [ge]braten und verbrannt
gefoltert, gemordet, [er]drosselt
und erwürgt, es hat ihn nie bewegt, (KBW, 123)
4. „Ich weiß keine bessere Welt“
Der aggressive und selbstdestruktive Gestus, der aus den Fragmenten, Entwürfen und abgebrochenen Versen spricht, scheint die Sprache der posthumen Gedichte zu beherrschen und wie ein Virus zu infizieren. Kann diese stigmatisierte poetische Sprache – im Unterschied zu den frühen Gedichten – noch als Anklage und als moralischer Appell wirken? Oder liest sich ihre Klage nicht vielmehr als verzweifelte Mimesis an die Gewalt, als unfreiwilliges und dennoch bewusstes intimes Bekenntnis, dass keine andere Welt und kein anderes Sprechen möglich sind? In Frage steht hier eine der Grundlagen der Bachmannschen Poetik, die ihre Rechtfertigung im moralischen Antrieb des Schriftstellers und in der Utopie einer neuen Sprache sucht. Das lyrische Ich, das in den frühen Gedichten der Bachmann diesen Auftrag vertreten kann, dankt hier gewissermaßen ab und identifiziert sich selbst nur noch mit der Rolle des Opfers. Die Identifikation mit der Opferrolle, ja die Opfermythologie des weiblichen Ich stellt sicherlich einen der problematischsten Aspekte der Gedichte aus dem Nachlass dar. Sie zitieren ein ganzes Repertoire von Leidensformen herbei, Ikonen, Topoi und Figuren des Schmerzes, vom Kreuz Christi bis zu Büchners gottloser geschändeter Kreatur, von den Gaskammern über die schrecklichsten Formen physischer Tortur bis zum kalten Laboratorium des Tierversuchs, beispielsweise im Gedicht Eintritt in die Partei:
Auch das Kaninchen, im Labor, aufgedunsen,
das sein Fell läßt nach dem Versuch,
auch die Ratte, abgespritzt, ohnmächtig
wird den Arm ihres Mörders nicht zerfleischen.
Auch die Fliege, gegen die eine Flitspitze
sich richtet, die Mücken, die eine Charta
der Mückenrechte noch nicht in Anspruch nehmen
sind meine Genossen. (KBW, 9)
Können diese Figuren der Ohnmacht, die das Ich zu seinen kreatürlichen Genossen erklärt, als „Pathosformeln“ bezeichnet werden, in denen das lyrische Ich seinen Schmerz benennt und erkennt? Eher schon geht es um ein Manifest, um eine Programmankündigung, wie der Titel des Gedichts nahe legt, das den Band eröffnet. „Die Ich, die gänzlich Erniedrigten, wollen / die Rache, eh sie geschändet sterben“ – so heißt es zur Identifikation des Ich mit den Opfern und weiter: „Ich weiß, dass man die Opfer hier zwingen muß, zueinander“ (KBW, 9). Was die Genossenschaft der erniedrigten Kreaturen verbindet, kann keine „Vereinbarung“ sein, nur die ohnmächtige Wut und die Rachsucht, die dem Ich seine menschliche Sprache raubt und eine einzige „verruchte Frage“ übrig lässt, „ob dies Geröchel noch / Werbung ist, für die schwachsinnige Moral / der Opfer“ (KBW, 20). Auf das Opfer darf keiner sich berufen – so heißt es in einem kurzen Prosaentwurf aus dem Nachlass, in dem diese Feststellung auch begründet wird: „[…] weil der geopferte Mensch nichts ergibt. Es ist nicht wahr, daß die Opfer mahnen, bezeugen, Zeugenschaft für etwas ablegen, das ist eine der furchtbarsten und gedankenlosesten, schwächsten Poetisierungen.“ (IV, 335) Im zitierten Prosastück konfrontiert sich die Bachmann mit dem Missbrauch der Opfer und mit einem Diskurs, der die Epoche nach dem Krieg bestimmt hat und weit ins Denken unserer Zeit hineinreicht. Insbesondere in der unmittelbaren Nachkriegszeit kann „der Mensch, der nicht Opfer ist“ nur die „zwielichtige Existenz par excellence“ (IV, 335) darstellen, denn er muss zu den Tätern zählen. Mit der Zeugenschaft der Opfer steht in den posthumen Gedichten allerdings auch die Existenzberechtigung des lyrischen Ich auf dem Spiel, das sich selbst nur in der Opferrolle identifizieren kann und das dennoch weiterhin hofft: „[…] dies Überlebens / sich wert zu zeigen, im Angriff, abzulegen / die schwachsinnige Moral / der Opfer.“ (KBW, 20)17 Bachmanns Gedichte aus dem Nachlass zeugen keineswegs für die Opfer, ihre Bedeutung liegt vielmehr darin, dass sie Zeugenschaft ablegen vom Zerbrechen eines Diskurses, der das Denken der deutschen Nachkriegskultur bis heute geprägt hat. Aus dem zynischen Wissen, dass das „Geröchel“ des Schmerzes nur zur Werbung geraten kann für die dumme und irrsinnige Moral der Nachkriegszeit18, spricht jedoch eine Verzweiflung, die dem ganzen Gedichtband den Titel gibt: Ich weiß keine bessere Welt – dieser Satz liest sich wie eine Sentenz, die das Ich über seine Zeit und ihre Utopie der poetischen Sprache spricht, denn – so die Motivation im folgenden Vers: „Die schwachsinnige Moral der Opfer läßt wenig hoffen.“ (KBW, 20)
In den posthumen Gedichten der Bachmann meldet sich ein schreibendes Ich zu Wort, das seinen Schmerz zwar spiegeln möchte in allen Figuren der Vernichtung, das zugleich jedoch weiß, dass sich die ganz persönliche Krankheit nicht stilisieren lässt zum universalen Symbol: „[…] und die Leiden sind nicht die großen […]. / Die Kranken wissen, / daß […] ein Grasgewimmer der Welt schon das Herz umdreht im Leib“ (KBW, 68), sie wissen, dass die großen Leidensfiguren der Geschichte den alltäglichen Qualen im Krankenzimmer der Gloriastraße (KBW, 58) fremd bleiben:
Wie soll einer allein soviel erleiden können,
soviele Deportationen, soviel Staub, sooft hinabgestoßen
sooft gehäutet, lebendig verbrannt, sooft
geschunden, erschossen, vergast, wie soll einer
sich hinhalten in eine Raserei
die ihm fremd ist und der heult über eine erschlagene Fliege.
(KBW, 60)
Hier spricht „einer“ für eine, die sich hinter dem schreibenden Ich verbirgt; weder gläubige Christin noch Jüdin ist es eine, die sich bewusst ist, dass ihre Verzweiflung, das Heulen „über eine erschlagene Fliege“, nichts Exemplarisches hat, die weiß, dass sie heimgesucht wird von der Krankheit:
heimgesucht von jeder Nadelspitze,
jeder Würgspur, jedem Druckmal,
ganz ein Körper, auf dem die Geschichte
und nicht die eigene, ausgetragen wird, (KBW, 60)
Krankheit, das ist ein Schmerz, der nicht zur Erfahrung wird und den auch der Schriftsteller nicht „wahrmachen“ (IV, 275) kann, insofern er sich der Vermittlung zwischen Literatur und Leben entzieht. Nur symptomatisch schreibt sich in den Körper die fremde Geschichte ein. Der kolonisierte Körper als Schlachtfeld einer kollektiven Geschichte gibt keine „Geschichte im Ich“ mehr zu lesen, eher schon eine Erzählung, die im unpersönlichen und unbewussten Freudschen Es beheimatet ist. Wenn die Bachmann in ihrer dritten Frankfurter Vorlesung von der Veränderung des schreibenden Ich in der Moderne sagt, „daß es sich nicht mehr in der Geschichte aufhält, sondern daß sich neuerdings die Geschichte im Ich aufhält“ (IV, 230) und wenn sie Proust als Zeugen dafür anführt, so betont sie das Vertrauen auf die Fassungskraft dieses epischen Ich, die bis in die Tiefe der Zeit hinein reicht und aus der Erinnerung eine ganze Welt erstehen lässt. Der kranke symptomatische Körper dagegen, beleidigt, besetzt und beschriftet durch eine anonyme Gewalt, erzählt nichts als den Zusammenbruch dieser Geschichte, den Verlust des Vertrauens in die Fassungskraft des Subjekts. Er gibt sich als Urschrift19 zu lesen, als Erinnerungsspur, die nur mühselig zu entziffern ist wie die antiken archäologischen Reste von Hieroglyphentafeln, die Freud mit dem berühmten Motto saxa loquuntur bezeichnet hat und die ihm in den Studien über Hysterie den Weg zur Entdeckung des so genannten Unbewussten weisen.
In den posthumen Gedichten bietet das schreibende Ich diesen kranken, von der Gewalt kolonisierten und infizierten Körper der Poesie als Opfergabe an. Das poetische Wort als Opferhandlung soll das Krankheitssymptom zur Sprache erlösen. Bachmanns Verse aus dem Nachlass zitieren die Evangelien, das Wort der Bibel ebenso wie die Figuren einer imitatio Cristi herbei, um den Schmerz und das Böse zu verwandeln, Litaneien, Gebete und Kniefälle dienen der Invokation eines Opfers, das nie vollbracht wird, sie sprechen über die „Auferstehung“ im Wort und über das Verfehlen und Scheitern dieser Hoffnung, denn die Sprache dieser Gedichte bleibt unerlöst. Das christliche Passionsgeschehen und die Erlösungshoffnung sind auch in der früheren Lyrik der Bachmann Prätexte der poetischen Sprache20; der Christologie der Nachlassgedichte aber, die Gott „ins Reagenzglas“ zwingen wollen, damit er „Farbe / bekennt, wenn er die Liebe sein sollte“ (KBW, 9), eignet ein blasphemischer Zug, sie liest sich wie eine böse Karikatur der Verwandlung und der alchemischen Wiedergeburt aus dem Chaos. Ein signifikatives Beispiel sind die folgenden Zeilen aus dem Gedicht Meine Zelle:
Man hätte mit mir, mit
jeder meiner Zellen
eine Himmelfahrt machen
können. Das Meßopfer
auf meinen Wunden
auf meiner Brust die
Litanei der Bitten
und Vergebung ist noch
Nicht dargebracht.
Ich sage Euch, und nicht
durch Blumen daß
die Litanei fehlt und
daß ich warte auf den
Kniefall und die Gerechtigkeit
und daß ein Freispruch
nur von mir kommen
kann. (KBW, 83 – 84)
Meine Zelle: dieser Körper, den die Sprache in einzelne Zellen zersplittert und einem anonymen man überlässt, ist verurteilt zu einer Leidenschaft, die nur noch in der irrealen Vergangenheit existiert und insistiert, während jetzt, im Präsens, die Litanei fehlt, die dieses verdammte Ich erlösen könnte, das nicht vergeben kann, ein Ich, das sich nicht freisprechen kann und das sich selbst festnagelt ans Kreuz des Ressentiments. Verse wie diese sind blasphemische Opfergaben. Andere Gedichte verletzen intime Tabus, sie zerren die ungeborenen Julikinder (KBW, 49) aus ihren Gräbern, „fromm und böse“ (KBW, 129), werben mit dem Tod in Selbstmordgedanken oder sie setzen den unerlösten Körper einem kalten, ja pornographischen Blick aus: „ich verstand / nichts, nur / diese Religion“ (KBW, 78). Der „Skandal“21 solcher Dichtung liegt, mehr noch als im moralischen Missbrauch der Opfer, im Höllensturz eines geistigen, ja geistlichen Anspruchs der Poesie, über den das lyrische Ich selbst sein hartes Urteil fällt. Ähnlich wie die Welt der Franza, die in den Todesarten ihre „Reise durch die Krankheit“ antritt, ist auch der Horizont dieser Gedichte „umsäumt von zerbrochenen Gottesvorstellungen“. (III, 447)
5. Pharmakon
Ingeborg Bachmanns lyrische Aufzeichnungen aus dem Nachlass sind verstörend in ihrer doppelten Lesbarkeit: als lebensgeschichtliche Dokumente einer Krankheit von Körper und Seele und als eigentümliches Manifest einer Poetik, das vom Scheitern, aber auch vom Überleben und von der Erlösungshoffnung der Poesie spricht. Erzählen diese Aufzeichnungen eine Geschichte, die vom Drama des schreibenden Ich handelt, das sich dem „Paradox eines kunstfernen Wegs“22 aussetzt und so die erlittene Gewalt zum Sprechen bringt? Auf den Leser wirken sie zunächst wie die Trümmer der früheren Utopie einer neuen Sprache, Bruchstücke eines Ausdruckstraums, der nur allzu oft einem therapeutischen Wort Platz machen muss. Das Wort als Droge und Trost kann den Schmerz lösen in einem Gesang, der in den verschiedenen Varianten des Mild und Leise oder in Habet acht das musikalische Schema eines Tagelieds aufruft und den Wagnerianischen Tristan wie eine Trostarie anklingen lässt: „Tot ist alles, alles tot“. (KBW, 101) Das Ich sucht den Schlaf des Bewusstseins im Klang seiner Worte, im Anklang an die Musik des Tristan wird der narkotische Effekt spürbar, der sich im spektakulären Gesamtkunstwerk Wagners verbirgt. Die therapeutische Wirkung des Narkotikums kann allerdings auch im Alkohol ertrinken wie im gleichnamigen Gedicht Alkohol – „Trinken, was trinken, / ich trinke, trinke“ (KBW, 151) – oder sie kann betäubt werden in der Droge: „Die Gnade Morphium, / aber nicht / die Gnade eines Worts“. (KBW, 53) So liest man in Das Narrenwort und in den Varianten von Gloriastrasse, in denen ein krankes Ich spricht: „Die Gnade Morphium, aber nicht die Gnade eines Briefs“. (KBW, 54) Es gibt aber auch Gedichte in der Sammlung, in denen das Weinen eine menschlichere Stimme annimmt, wie in Nacht der Liebe, wo das Ich endlich sterben kann:
Mein Rächer trat hervor und nannte sich Leben.
Ich sagte sogar: laß mich sterben, und meinte
furchtlos meinen lieberen Tod (KBW, 157)
Es gibt Momente, in denen der Ausdruckszwang zur Ruhe kommt wie in Dein Tod, und wieder: „Ich ruhe mich aus, / ein schwarzes Laken, von Worten“ (KBW, 173) – oder Verse, in denen ein erstmaliges Staunen über ein poetisches Wort zurückkommt wie in Enigma (KBW, 156) oder in Erste Schritte:
sprechen. das muß lang her sein
Ein Wort, Wort und Unterbrechen
habt Satz und Atemnot
mitten im Unterbrechen
kommt jetzt ein Wort ins Lot. (KBW, 159)
In einigen Gedichten schließlich deutet sich eine Heimkehr zur poetischen Sprache an, auf den Stationen einer Reise, auf der das Ich zugrunde gehen kann wie in Böhmen liegt am Meer, um so in Heimkehr über Prag, in Wenzelsplatz (KBW, 162) oder in Jüdischer Friedhof (KBW, 163) einem unpersönlichen Subjekt das Wort zu überlassen. „Auf einem Umweg, es kehrt heim / es spricht wieder“ (KBW, 161) – so lauten die Verse von Heimkehr. Im unpersönlichen Es will das Ich seine Heilung suchen: „versuch es zu kennen, es will heilen“ (KBW, 39) – so heißt es im Gedicht Im Lot.
Die wache Distanz zu diesem unbekannten heilsamen Es, die das Schreiben erst ermöglicht, droht allerdings in vielen dieser Gedichte einzustürzen. Das Es wird zur dissoziativen Kraft, die das schreibende Ich bedrängt mit seiner unmittelbaren Nähe und dessen Ausdruck symptomatisch blockiert. Im Entwurf über Georg Groddeck bezieht sich Ingeborg Bachmann auf dieses Es, das aus den Symptomen der psychischen wie physischen Krankheit spricht. Vor aller psychoanalytischen Interpretation oder Freud-Exegese interessiert sie die schöpferische Potenz und die Macht des Groddeckschen Es über das Ich: „Das Es ist für ihn ein Hilfswort, es ist kein Ding an sich, sondern es soll heißen, da ist etwas, das ist da und stärker und viel stärker als Ich“. (IV, 352) In der Büchnerpreisrede Ein Ort für Zufälle will die Bachmann dieses mächtige unpersönliche Subjekt der Krankheit direkt in ihrer Prosa inszenieren und den Wahnsinn buchstabieren, der „auch von außen kommen“ (IV, 278) kann, im ohrenbetäubenden und durchdringenden Lärm der Stadt Berlin, der die Wahrnehmung zerrüttet und das Krankenzimmer einer psychiatrischen Klinik zum Resonanzraum einer chaotischen Welt macht. In gattungstheoretischer Hinsicht mag es erstaunlich sein, dass Ingeborg Bachmann gerade in einer Rede den Versuch macht, das Sprechen über Literatur ins literarische Sprechen selbst zu übersetzen, im Unterschied zu den Gedichten aus dem Nachlass, die meist über die Krankheit sprechen und die poetologische Dimension in den Vordergrund stellen. Es ist die Prosa der Bachmann, die das delirante Es zum Sprechen bringt, dieses meldet sich allerdings auch in einigen Nachlass-Gedichten zu Wort, beispielsweise in Schallmauer, wo „dieser Wahn“ nahe am Explodieren ist und die Schallmauer durchschlägt: eine „Wahnkraft, für deren / Durchschlag der Himmel immer zu weich / und die Erde zu hart ist“ (KBW, 137).23 Im Wahn kann das Ich eine Brandmauer anstarren „ohne Gesicht“ (KBW, 130), um sich für den Moment einer Schrecksekunde dem eigenen Scheintod gegenüber zu sehen wie in An das Fernmeldeamt Berlin oder der „Lärmteppich“ der Stadt Berlin kann ein Stück realer Geschichtserfahrung aufreißen wie in Das deutsche Wunder. (KBW, 133) Doch können Verse wie diese die destruktiven Impulse einer dissonanten Welt zur Sprache erlösen? Oder allgemeiner gefragt: Zeichnet sich im Band der Weg einer Heilung durch das Schreiben und durch das pharmakon Schrift ab?
Im Spätwerk der Bachmann verbindet sich die Hoffnung auf eine Heilung im gesunden Wahn mit dem Vorstellungskomplex einer Reise in die ägyptische Wüste, so im Buch Franza und im Wüstenbuch. Im Gedicht Enigma wird in diesem Sinn die Nacht am Nil angerufen: „Am Nil in der Nacht, am Nil, / wo die Sterne dir bis in den Mund hängen / und dein trockenes Herz wieder befeuchtet wird“ (KBW, 156). Andere Verse stellen den Versuch dar, die Sprache in die Wüste zu führen und so die Wüste zum Purgatorium eines verwüsteten Herzens zu machen:
Die Wüste hat meine Augen begegnet mit Sand, von meinem
verwüsteten
Herzen konnt ich nur vorher sprechen, jetzt ist es verwüstet
wunderbar, die Sandschleier ziehen auf, die Dünen habens
genommen,
meine Blicke besänftigt mit ihrer unendlichen Zeichnung
mein Gang ans Rote Meer. Mehr sag, ich mehr, mehr noch
vom Sand. (KBW, 169)
Zeilen wie diese könnten von der poetischen Hoffnung sprechen, die Sprache aus der „unendlichen Zeichnung“ der Wüste neu zu erschaffen, doch schon das benachbarte und thematisch verwandte Gedicht Auflösung, das seine Hoffnung auf den schwarzen Kontinent setzt, liest sich wider den Willen der Autorin wie eine Karikatur solcher Wüstenfahrt der Poesie:
Ich rufe Dich von der Straße,
komm, hab schwarzes Haar, sei jung,
sei hart, tu weh, hier wo alle blond sind,
terra nova, Africa, ultima speranza. (KBW, 168)
Im selbstdestruktiven Gestus verfällt die poetische Leidenschaft der Sexualität. So auch in Immer wieder schwarz und weiß (KBW, 167), wo weniger von der Vermischung der Rassen als von den Versteckspielen eines weiblichen Ich die Rede ist, das nachts die „Königin von Sambesi“ spielen will: „Meine Haut ist farbig von deiner geworden. / Ach wie gut, daß niemand weiß, wie du heißt“ (KBW, 167). Im letzten Gedicht des Bandes schließlich, das sich im Titel An jemand ganz anderen wendet, wird die leidenschaftliche Hoffnung des schreibenden Ich ganz bewusst in einem poetischen Flirt verspielt:
[…] du sagst auch
: dunque, und ich sterbe und bete an,
während ich vor Träumereien die Rechnung
unseres Abends erhöhe, ich trinke noch
ein Glas und höre, ich höre ich verstehe.
vor lauter Zuhören
daß ich es nicht bin.
Ich habe mich aufgelöst und meine
Vergangenheit in dir, ich sitze am
Telefon und werde pronto sagen, und
ohne Hoffnung, daß es klingt […]. (KBW, 174 –175)
Ohne Erlösungshoffnung betet ein weibliches Ich noch einmal den gefallenen Abgott Mann an und löscht sich in dessen fremder Sprache aus, eine Fremdsprache, die trotz aller Bemühungen ohne Resonanz bleibt und so nichts mehr bewegt:
[…] ich will
mich auslöschen wenn ich spreche.
Deine Erleichterung, daß ich Sätze bilde und Fehler
mache, ist meine Erleichterung.
Das Gepäck, ein Schutthaufen, wird nicht mehr
bewegt. (KBW, 175)
Die bittere Ironie solcher Zeilen sollte der Leser – wohl auch der Absicht der Herausgeber des Bandes zum Trotz – nicht als letztes Wort aus dem poetischen Nachlass der Bachmann gelten lassen.
Die posthumen Gedichte bleiben mehrfach lesbar und wirken gerade deshalb verstörend auf den Leser. Sie inszenieren das intime Drama einer Lyrikerin, die mit der Rechtfertigung ihrer schriftstellerischen Existenz auch die Legitimität ihrer Poesie aufs Spiel setzt. Aus dieser Selbstzerstörung im Medium des poetischen Wortes spricht eine Verzweiflung, die die Wurzeln des poetischen Sprechens erfasst und dessen Prämissen freilegt. Als Dokumente einer radikalen Krise stellen diese Gedichte die „Problemkonstante“ (IV, 193) der früheren Poetik in Frage, den moralischen Anspruch der Dichtung ebenso wie ihre existentielle Beglaubigung im Schmerz. Sind diese Verse Symptome einer Krankheit oder das Manifest einer neuen Poetik? Auffällig ist die Spaltung des schreibenden Ich, das die destruktiven Affekte notiert und zugleich deren poetologische Relevanz aufzeigt. Selbstdestruktion und Reflexion treffen direkt und hart aufeinander in der Ich-Aussage dieser Gedichte, die sich immer wieder in autoreferentiellen Aporien festschreibt. Die Dominanz des poetologischen Sprechens über das poetische Wort scheint hier selbst Teil des Krankheitsbildes zu sein. So wach das meta-poetische Bewusstsein auch bleibt, es weist kaum den Weg einer via poetica, eher schon lesen sich die posthumen Gedichte als Abgesang auf eine Poetik, die das Selbstverständnis der Epoche geprägt hat, Schwanengesang auf die Lyrik der Nachkriegszeit, deren „unverwechselbare Wortwelt, Gestaltenwelt und Konfliktwelt“ (IV, 163) nur noch in Bruchstücken erkennbar bleibt: die „schwachsinnige Moral“ der Opfer, der scheiternde Ausdruckstraum, das sentimentale oder selbstdestruktive Pathos eines lyrischen Ich, das sich selbst überlebt hat.
In ihren Krisengeschichten kann sich die Literatur erneuern oder auch versagen; in der heroischen Negativität, im Durchbrechen der kanonischen Formen und der ästhetischen Codes und „Delikatessen“ kann ihr Scheitern zum Moment eines zweiten Gelingens werden, eine Konzeption, die der Bachmann keineswegs fremd war. Lässt sich das Bachmannsche „Adieu ihr schönen Worte“, das manchen Leser peinlich berühren mag in seiner klischeehaften Formulierung, in jene „Variationen über ein altes Thema“24 einordnen, in denen die Literatur der Moderne – vom Tasso bis zur Hamletmaschine – immer neu ihren Abschied zelebriert, ihr emphatisches, erhabenes oder auch minimalistisches Pereat ars, fiat opus?25 Wohl kaum. Die Schwierigkeiten beim Lesen der Gedichte aus dem Bachmannschen Nachlass scheinen sich dem eigenartigen Doppelgesicht dieser Texte zu verdanken; es sind ambivalente Dokumente einer lebensgeschichtlichen wie poetischen Krise, die man symptomatisch und zugleich poetologisch lesen kann, Aufzeichnungen einer Krankheit, die über die Zerstörung des lyrischen Ich hinaus weist und Fragmente einer unerlösten Poesie, die die utopische Richtung der früheren Poetik aufkündigt.