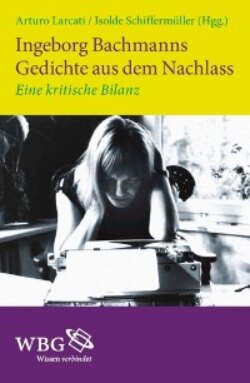Читать книгу Ingeborg Bachmanns Gedichte aus dem Nachlass - Группа авторов - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Krankheit und Politik. Bachmanns „Eintritt in die Partei“
ОглавлениеI. Die Gedichte von Ich weiß keine bessere Welt1 erscheinen einem wie die Verwirklichung der Forderung, die das Ich im Gedicht Keine Delikatessen an sich selber und sein Schreiben stellt: „Mit dem ungereinigten Schluchzen, / mit der Verzweiflung […] / werde ich auskommen. / Ich vernachlässige nicht die Schrift, / sondern mich.“ (I, 172)2 Die Verweigerung der künstlerischen Fiktion und die Ablehnung der Gesetze des schönen Werkganzen sind in den fragmentarischen Texten von Ich weiß keine bessere Welt an der Vernachlässigung der dichterischen Form abzulesen. Das hat in der Literaturkritik die Frage aufgeworfen, ob es sich hier überhaupt um Gedichte handle oder nur um Vorstufen zu Gedichten oder überhaupt nur um „Material zu Gedichten“, obwohl die Bestimmung des werkgenetischen Status nicht notwendig mit der Qualität und literarischen Bedeutung zu verknüpfen ist. Am bestimmtesten, genauer müsste man sagen, am rabiatesten und gleichzeitig konformsten, hat Peter Hamm seinen Verriss der Edition von Ich weiß keine bessere Welt3 mit der Unabgeschlossenheit der Texte begründet. In seinem Beitrag zur Zeit-Kontroverse anlässlich des Erscheinens der Edition empörte sich Hamm gegen das Unfertige und Zerrissene der Texte wie gegen die Editoren, die mit der Publikation Bachmanns Idee des geglückten Gedichts verraten hätten. In „diesem Band findet sich kein einziges abgeschlossenes Gedicht und schon gar nicht eines, das Ingeborg Bachmann je zur Publikation freigegeben hat“, so der Rezensent, der sich mit der Autorin einig zu wissen glaubt in der eigenen Idee von einem richtigen Gedicht, das „mehr und mehr vom auslösenden Affekt gereinigt“ und „zum objektiv gültigen Kunstwerk geläutert“ wird. Das klingt zwar überzeugend, aber mit Bachmanns Werk hat es wenig zu tun, vielmehr löscht Hamm hier auch das Skandalöse in Bachmanns früheren Gedicht-Editionen seit Die gestundete Zeit, das der große zeitgenössische Komponist und Freund Ingeborg Bachmanns schon 1954 aus ihren neuen Gedichten heraushörte: „You have in these new poems something alarming, scandalous, bewildering, startling. If you go on this way you’ll have the most beautiful scandals too, if you like it or not.“4 Dass dieser Skandal in der Bachmann-Rezeption der fünfziger Jahre mit dem Gerede vom schönen Gedicht verdrängt wurde, brachte die Autorin dazu, sich der kulinarischen Ästhetik immer radikaler zu verweigern und die „Todesart“ jenes Prinzips von Autorschaft, von dem Hamm noch fast fünfzig Jahre später nicht abzubringen ist, in den Blick zu rücken. Ihre Lyrik war von Beginn an die Infragestellung jenes Typus von Autorschaft, jenes, Malina-Prinzips‘ einer Kunst, die nicht ohne Auslöschung und Vernichtung von affektiven Ich-Anteilen zu bewerkstelligen ist. Das Unglück, dass sie mit diesem Typus eines auf Sublimierung beruhenden Kunstwerks verbindet, hatte sie bereits in den frühen Briefen an Felician (1945/46) dargestellt, und es ist kein Zufall, dass Hamm gerade auch dieses Buch nicht verstehen kann, es als Sakrileg ansieht und nichts als Diffamierung für die Publikation übrig hat, weil ihm die „Briefe“ als „unsäglich pubertä[r]“ vorkommen und er auch in diesem Fall der Schwester der Dichterin vorwirft, „ebenjenen Voyeurismus“ zu bedienen, den er bei der Edition von Ich weiß keine bessere Welt am Werke sieht. Damit Hamm seinen Begriff von Kunst und Autorschaft aufrecht erhalten kann, müsste er freilich den größten Teil von Bachmanns Werk unter Verschluss halten und die Stellen aus ihrem publizierten Werk wegsperren, wo er seinen eigenen Kunstbegriff in ein Zwielicht gerückt finden würde. Als „hätte er mich ausgeschieden, einen Abfall, eine überflüssige Menschwerdung“, sagt das weibliche Ich über seinen prekären Platz neben Malina, der Titelfigur, „eine unvermeidliche dunkle Geschichte“, die er „von seiner klaren Geschichte absondert und abgrenzt.“ (III, 22 f.) Am Ende des Romans wird diese Ausgrenzung als „Mord“ bezeichnet.
Mit Malina wollte Bachmann die Todesart der Autorschaft als Ouvertüre an den Beginn der Reihe der geplanten Todesarten-Romane stellen. Ein Aspekt dieser „Todesart“ des Ich im Werk ist jene Reinigung und Läuterung vom „Lebensschlamm“, die Hamm dem schönen Gedicht abverlangt: „Da den im Zustand des totalen Außersichseins herausgeschleuderten Worten und Sätzen der poetische Mehrwert versagt bleibt, werden wir Leser zwangsläufig in die erbärmliche Rolle von Voyeuren des Unglücks dieser Frau gedrängt“. (Peter Hamm)
Mit seiner Berufung auf den „poetischen Mehrwert“ besteht der Kritiker auf dem kapitalistischen Wertgesetz in der Literatur, so entschieden sich auch gerade die Gedichte von Ich weiß keine bessere Welt diesem Prinzip verweigern. Ob nicht auch ein Denken erbärmlich ist, das aus der Versagung des „poetischen Mehrwerts“ ableitet, dass der Leser dadurch „zwangsläufig“ in die Rolle eines Voyeurs versetzt wird? Ob Literaturkritik nicht wenigstens den Versuch der Autorin reflektieren müsste, sich dem alles beherrschenden Wertgesetz in der Literatur zu verweigern? Dazu wäre freilich ein anderer Typus von Kritik notwendig, ein anderes Wissen vom Kunstwerk und von der Gesellschaft, und es wäre dazu auch notwendig, sich nicht gegen Bachmanns eigene theoretische Überlegungen zu verschließen, sondern ihre Werke im Zusammenhang zu sehen, sie aneinander angrenzen zu lassen, auch an die Werke anderer Autoren und anderer Theorien der Literatur.
Mit dieser Forderung an die Literaturkritik ist nichts Unmögliches gemeint, keine erst zu erfindende neue Theorie der Literatur, sondern die Erweiterung des Blicks für das Werk Bachmanns. Nicht wenige Rezensenten widersprechen ja indirekt dem voyeuristisch fixierten Blick von Peter Hamm, der „hier also nur ein enormes Elends- und Erregungspotential als Material für Gedichte“ zu „besichtigen“ meint, wenn sie in den Texten von Ich weiß keine bessere Welt dichterische Strukturierungsverfahren erkennen, Beziehungen zu anderen literarischen Werken und anderen künstlerischen Genres entdecken und das Grundmotiv der Liebesklage, wie rudimentär, zerbrochen oder verzweifelt auch immer, als eines der Textzentren ausfindig machen. Ernst Osterkamp hat in seiner Rezension mit dem Titel Wer ein Messer im Rücken hat, dem fällt keine gepfefferte Metapher ein5, die künstlerische Form der Gedichte bei aller scheinbaren Formlosigkeit betont und auf die motivische Arbeit und Variation von Texten aus der großen Oper hingewiesen, auf Tosca und vor allem auf die Liebestod-Szene der Isolde in Wagners Tristan. Verse aus den Operntexten würden in Bachmanns Gedichten aufgegriffen, um sich darin zu spiegeln oder davon abzusetzen, auch, um sie für unzuständig zu erklären und sich von den großen Rollen und allen Spiegeln zu verabschieden. Das „Seht ihr Freunde, seht ihr’s nicht“ aus Isoldes Liebestod oder das „Tot ist alles, alles tot“ des König Markes werde bei Bachmann zum Ausdruck für den Tod der Liebe und für das Nicht-Überleben-Können des Ich: „Seht ihr Freunde, seht ihrs nicht! / daß ich’s nicht überlebt / auch nicht überstanden habe, seht ihrs nicht, / daß ich einwärts gehe, daß / fürderhin einwärts rede, daß / ich […] mein Wort einziehe.“ Osterkamp bemerkt zu diesem Zitat, dass hier Tristan gelöscht werde und nur „ein einsames Ich als Figur alles umfassender Klage“ zurückbleibe: „Diese Klage weist nicht über sich hinaus, weist immer wieder auf sich selbst zurück, und die Tristan-Motive dienen nur noch dazu, ihr einen universalisierenden Duktus zu verleihen.“ Obwohl sich die Formulierungen „wie kaum verstellte Notschreie einer Frau“ ausnehmen, vergesse Bachmann „auch bei diesen Gedichtentwürfen, die oft wie mit fliegender Feder aufs Papier geworfen erscheinen, nicht das poetische Kalkül“. Die Gedichte, die vom Verlorengehen der Gedichte sprechen und von der Unmöglichkeit, den Schmerz aufzuschreiben – „Meine Gedichte sind mir abhanden gekommen. / Ich suche sie in allen Zimmerwinkeln. / Weiß vor Schmerz nicht, wie man einen Schmerz / aufschreibt, weiß überhaupt nichts mehr“ –, reflektieren zugleich ihr „poetisches Verfahren“ und sie sind „deshalb nicht mit jener Art Schmerzensschrei zu verwechseln, die man ausstößt, wenn man tatsächlich ein Messer im Rücken hat.“ Die „Vielzahl der Motivverkettungen“ in dem Gedichtband, die „Wiederaufnahme einzelner Verse oder Versgruppen in unterschiedlichen Gedichten“, „die Vernetzung der Themen, Motive und Argumentationsfiguren“ und die in der Edition erkennbaren Ansätze textgenetischer Prozesse, die Osterkamp beschrieben hat, zeigen jedenfalls, dass es hier um etwas anderes geht als eine Materialsammlung für Gedichte.
Was dieses ,andere‘ sein könnte, möchte ich im Anschluss an die genaue, das Fragen ermöglichende Beschreibung von Osterkamps Rezension zu erklären versuchen. Es geht mir darum zu verstehen, was den „,kunstfernen Weg‘“6 ausmacht, den Bachmann damals, im imaginären Dialog mit diesem Celan-Wort, aber theoretisch obsessiver und unerbittlicher als er, für sich gewählt hat. Wenn man die Texte von Ich weiß keine bessere Welt als Vorstufen oder als Notate und Dokumente einer Krise bezeichnet, warum sollten sie nicht gerade dadurch besonders aufschlussreich für die Suche nach einem anderen Weg des Schreibens sein, wird doch in diesen Gedichten die persönliche Krise als Schreibkrise verstanden und im Schreiben ein Weg gesucht, der das Leben und Weiterleben ermöglichen sollte. Auch Osterkamp ist sich bewusst, dass diese Gedichte bzw. Vorstufen zu Gedichten textgenetisch aufschlussreich sind, weil sie zu einem anderen Begriff von Dichtung führen. In ihnen die Topik der Jahrtausend alten Liebeslyrik zu entdecken – Liebesklage, Liebesverrat, Anklage, Rache, Raserei –, bedeutet ja noch nicht, dass sie damit bereits verstanden sind. Die Zuordnung der Gedichte zu den alten genrespezifischen thematischen Motiven der Liebeslyrik ist auch nicht unproblematisch, weil sie dazu tendiert, den Protest, den Aufschrei, den Schmerz auf das Immer-Gleiche der alten Gattungsmuster festzulegen.
II. Eine erste, nicht unwesentliche Differenz gegenüber dem scheinbar immer Gleichen der alten Topoi des Liebesverrats liegt darin, dass bei Bachmann die Liebesklage mit der Anklage gegen den Missbrauch männlicher Autorschaft verschränkt wird. Das liebende Ich sieht sich zum Objekt gemacht, betrogen, ausgenutzt und beraubt, es ist ein Opfer der Liebe und zugleich ein Opfer der Literatur. Diese besondere Variante des Verratenseins in der Liebe verbindet sich in einigen Gedichten mit der Vorstellung, dass damit die eigene Kreativität ausgelöscht wurde und das eigene dichterische Werk als utopischer Selbstentwurf und Idee der Schönheit verloren gegangen ist: „Meine Gedichte sind mir abhanden gekommen“ – „Adieu, ihr schönen Worte, mit euren Verheißungen, / Warum habt ihr mich verlassen. / Ich habe euch hinterlegt … tut dort für mich ein Werk.“ (KBW 11)
Einer bloß biographischen Lesart, welche die Gedichte nur als Dokument des dramatischen Endes der Beziehung mit Max Frisch liest, wäre entgegenzuhalten, dass die thematischen Motive des Liebesverrats und des Verschwindens des weiblichen Ich schon in früheren Werken Bachmanns zu finden sind. Auch das Ausgesetztsein, die tödliche Gefährdung und den Kampf auf Leben und Tod findet man bereits in den bekannten ,schönen‘ Gedichten. In Bachmanns berühmtem Italien-Gedicht, Das erstgeborene Land, spricht ein Ich in der Todesgefahr nach einem Schlangenbiss, allein in einer menschenfeindlichen Landschaft auf sich selbst gestellt, aber in dieser äußersten Gefährdung entdeckt es die ihm eigene Kraft zum Widerstehen, indem es das tödliche Gift aus der Wunde saugt: „Und als ich mich selber trank / […] war ich zum Schauen erwacht.“ (I, 119) Ein Ich spricht hier, das in der Todesnot aus dem eigenen Inneren eine neue Kraft zum Leben gewinnt und sich damit die künstlerische Wahrnehmung wie neu erobert. Solche Szenen von bedrohlicher Ausgesetztheit und Widerstehen findet man in einigen Gedichten von Ich weiß keine bessere Welt, in denen es um Erste Schritte (KBW, 159) geht, so der Titel eines der Gedichte, die aus dem lähmenden Entsetzen hinausführen oder von einem Hass befreien wollen, der das Ich blind macht. In dem Gedicht mit dem Titel Ach findet man die Selbstbehauptung eines Ich, das sich erhebt, „um der nackten / Gewalt / und den gutgekleideten / Gewalten / zu trotzen“ (KBW, 26), in anderen Gedichten findet man den Tagtraum von der organisierten Revolte, und zu diesen Ausbruchs- oder Aufbruchsversuchen gehören auch die blasphemischen Gedichte, die in der orgiastischen Sexualität den Bruch mit der Scheinmoral der Biedermänner vollziehen und dem Ich die Verfügung über den eigenen Körper zurückgeben. (Mit einem Dritten sprechen; KBW, 76 –79) Dominant aber ist in den edierten Gedichten das rückhaltlose Registrieren eines aussichtslosen Zustands, das Nicht-mehr-weiter-Wissen, das Nicht-mehr-weiter-Können, das „Wer möchte leben / wenn er nicht zu atmen hat, / das schwarze Segel immer aufgezogen“, wie es in einer Anspielung auf den Tristan heißt. (Mild und leise; KBW, 99)
Von diesen Gedichten prallen die Forderung von „Reinigung“ und „Läuterung“ und die Idee des schönen Gedichts, das gegen sie in Stellung gebracht wird, als eine biedere Scheinmoral ab.
III. Die Gedichte von Ich weiß keine bessere Welt verlangen einen anderen Typus von Kritik, ein kritisches Wissen vom Kunstwerk und von der Gesellschaft. Es wird erst zugänglich, wenn man sie nicht mehr an vormodernen Begriffen wie Läuterung oder Reinigung misst, sondern aus ihnen selbst primäre Artikulationsformen des Entsetzens, der Schande, des Protests und des Widerstands herausbuchstabieren lernt. Als hilfreich erweisen sich dabei die theoretischen Reflexionen, die Bachmann damals, am Beginn der Arbeit an den Todesarten-Romanen und in der Zeit der Vorbereitung der Büchnerpreis-Rede niedergeschrieben hat. Sie kreisen um die Möglichkeit, krisenhaft erfahrene Zustände, psychische und physische Krankheitssymptome zu artikulieren und in der sprachlichen Artikulation der tiefgreifenden Krise zu einer neuen „Politik“ des Schreibens zu finden. Die Formel „Politik und Physis“, die Bachmann dafür geprägt hat, meint den Versuch, in möglichst großer Nähe zu primären körperlichen Erfahrungen, zur „Physis“, zu einer anderen „Politik“ des Schreibens zu finden:
Was ich unter Politik verstehe, hat sich herangebildet in mir, einem einzelnen, und nun mag das Wort hingeworfen werden zum erstenmal: nicht als Resultat denkender Überlegungen, sondern als eines der Physis. Damit möchte ich sagen: ich habe nicht eines Tages alle möglichen Theorien vorgesagt bekommen, in alle Praktiken Einsicht genommen, um mich für die eine oder andere zu entscheiden, […], sondern auf Grund einer langen umwegigen Geschichte der Physis, das heißt, daß ein im Prozeß befindliches Körperwerk, dessen Tentakel die andren Tentakel des gesellschaftlichen Körpers dauernd berührt, von ihnen abgestoßen und angezogen wird. (Politik und Physis; KS, 373)
Politik ist für sie keine abstrakte denkerische Entscheidung, sondern sie resultiert aus der „umwegigen Geschichte der Physis“ eines Ich. So wird die Krankheit per se politisch verstanden, und die Heilung ist ein komplexer Vorgang, der „ein im Prozeß befindliches Körperwerk“ betrifft. Das Schreiben zielt auf die Bewusstwerdung des Verhältnisses von „Politik und Physis“ und es zielt damit auf die Erhellung der unbewusst eingespielten Prozesse. Es geht dabei immer wieder um erste „Schritte“ der Artikulation, die aus den stummen körperlichen Symptomen hinausführen, es geht um die Wendung nach außen, um die Gebärde oder das Wort, das eine Verbindung herstellt zu den Worten anderer Menschen. Zitate, die für sie „das Leben“ sind – „Eben wie Leben“ (GuI, 69), Bachmanns eigensinnige Bestimmung von Intertextualität – verweisen auf diese tiefgreifende Begründung von Lesen und Schreiben, sie zeigt, was es mit dem lebendig machenden Wort auf sich hat und dass einem ein Wort wieder Halt geben kann in der Welt.
Ob die Texte von Ich weiß keine bessere Welt Gedichte sind oder Nicht-Gedicht, ob sie als Gedichte geglückt oder gescheitert sind, sie ,dokumentieren‘ die Grundprobleme des Schreibens in einer äußersten persönlichen Ausgesetztheit, in der die Fragen der Kunst eine bestürzende Notwendigkeit erhalten: Was ist es, was einen weiterschreiben und also weiterleben lässt, was ist der kunstferne Weg, der hier beschritten wird und von dem sich die Ästheten und Anwälte des geglückten Gedichts mit Grauen abwenden, weil hier nichts vom „Lebensschlamm“ (Peter Hamm) gereinigt ist, ein Skandal, dem man sich besser nicht aussetzt?
Das Wort vom „kunstfernen Weg“ kannte Bachmann aus Paul Celans Brief vom 21. September 1963, in welchem er ihr schrieb, er habe erfahren, dass es ihr „gar nicht gut gegangen sei“ und dass sie „eben erst wieder aus dem Krankenhaus zurück“ sei. Er habe selbst ein „paar nicht ganz erfreuliche Jahre hinter“ sich – „wie man so sagt“. Sein Gedichtband „Die Niemandsrose“ habe Verschiedenes davon „mit einverwoben“: „ich bin mitunter, denn das war so gut wie vorgeschrieben, einen recht ,kunstfernen‘ Weg gegangen. Das Dokument einer Krise, wenn du willst – aber was wäre Dichtung, wenn sie nicht auch das wäre, und zwar radikal?“7 In ihren ersten Entwürfen zur Büchner-Preis-Rede Ein Ort für Zufälle (TKA I, 174) hat Bachmann Celans Formulierung als Forderung für ihr Schreiben übernommen: „lasst uns auf dem Kopf stehen, auf einem kunstfernen Weg, der einmal einmünden kann, dort wo wieder Kunst kommt.“ Sie skizzierte damals, 1964, in der Auseinandersetzung mit Büchners Lenz-Novelle – es ist auch die Zeit der Arbeit am Romansujet von Franzas „Reise durch eine Krankheit“ (TKA II, 77) –, ihre Theorie eines Schreibens, das sich so rückhaltlos wie möglich dem Leidensdruck der Realität aussetzt, um deren destruktive Wirkungen zu erforschen: „Der Wahnsinn, die Nerven, das sind die sichtbaren Niederlagen in einer total gesunden Welt, in der die Mörder das Alibi erbringen können für die Zeit des Mords“, liest man in den Entwürfen zur Büchner-Preis-Rede: „es sind also die Kranken [auf] die zu zählen ist und denen das Gefühl für Unrecht und Ungeheuerlichkeit noch nicht abhanden gekommen ist.“ (TKA I, 175)
In den Skizzen zu einer Lesung aus dem Manuskript für ihr „Wüstenbuch“ spricht die Autorin von zwei Komponenten, von welchen die Erzählsituation dieses Buchs bestimmt sei: auf der einen Seite „von einem Delirium, von einer Krankheit, könnte man sagen, von schlechten Träumen“; auf der anderen Seite, „kontrapunktisch“, wie sie sagt, von einem „Ich, dem zuzutrauen ist, daß es sich auf einer Reise befindet, vielleicht weniger auf einer Reise als auf einem Weg der Heilung und in der Unmöglichkeit, verordnete Eindrücke zu haben“.8 In dieser Erzähl-Konstruktion – ein Ich-Teil, der sich der Krankheit, dem Delirium, den Albträumen aussetzt, und ein kontrapunktischer Ich-Teil, der sich „auf dem Weg der Heilung“ befindet und einer neuen, nicht ,verordneten‘ Wahrnehmung folgt – könnte man auch die Grundstruktur vieler Bachmann-Gedichte wiederfinden, und nicht zuletzt die der Gedichte von Ich weiß keine bessere Welt. In der Kontrapunktik von Krankheitszustand und Suche nach einem Weg, der herausführt, zeigen uns die Gedichte Grundimpulse des Schreibens, die zugleich Lebensimpulse sind. So hoffnungslos und verzweifelt und von aller Hilfe verlassen sich dieses Ich darstellt, es hat begonnen, sich in der Sprache nach außen zu wenden, in der eigenen Krankheit etwas Allgemeines, Politisches mitzudenken, allein schon dadurch, dass in den sprachlichen Formulierungen auf andere literarische Texte hingehört, oder, wie in Eintritt in die Partei, eine Politik des Widerstands in Erinnerung gerufen wird.
So könnte man die „Politik“ dieser Gedichte darin sehen, dass sie die Literatur in tiefgreifenden Lebens- und Überlebensprozessen verankern und die „Physis“ zum Ausgangspunkt des Schreibens nehmen. Das ist auch der erste Eindruck der Lektüre der Gedichte von Ich weiß keine bessere Welt: die elementare Realität der menschlichen „Physis“, die Unmittelbarkeit des Leidens und der Affekte, und, genauso radikal, die primärprozesshafte Artikulation einer kritischen „Politik“. Wenige andere Texte Bachmanns sind so unmittelbar politisch, als wäre hier die Radikalität der analytischen Moderne in einer extremen Krisensituation neu zurück erobert worden. Der sich durchgängig aufdrängende Eindruck der politischen Radikalität dieser Texte dürfte die Herausgeber dazu gebracht haben, das Gedicht Eintritt in die Partei an den Beginn der edierten Texte zu stellen, in welchem es um eine „unverordnete“ Politik geht, welche die individuelle Opfer-Existenz übersteigt.
IV. Das Gedicht Eintritt in die Partei gehört zeitlich in den Zusammenhang von Bachmanns Studien zum Verhältnis von Krankheit und Schreiben, mit denen sie sich auf die Büchner-Preis-Rede im Herbst 1964 vorbereitete. Es ist besonders erhellend im Hinblick auf die Frage des Verhältnisses von „Politik und Physis“, das ich, in Anlehnung an eine Formulierung von Jean Améry, als, Revolte in der Krankheit‘ bezeichnen möchte.
Ist denn ein Mensch nichts unter Brüdern wert?
Verleumdet und bespien, verhöhnt, verlästert,
wer weiß es nicht, für eine Guttat, die sich nicht beweist.
Die Ehre, verkauft an jedem Stammtisch.
In aller Mund als eine dreckige Anekdote.
Das Unmaß eines Gefühls ermordet
von geschäftiger Nutznießerei.
Mit der Aufstellung der Einnahmen
Beschäftigt die Skrupellosigkeit.
Ein Leben, ein einziges, zum Experiment
gemacht. So ists gelungen. Vollbracht.
Auch das Kaninchen, im Labor, aufgedunsen,
das sein Fell läßt nach dem Versuch,
auch die Ratte, abgespritzt, ohnmächtig
wird den Arm ihres Mörders nicht zerfleischen.
Auch die Fliege, gegen die eine Flitspitze
sich richtet, die Mücken, die eine Charta
der Mückenrechte noch nicht in Anspruch nehmen
sind meine Genossen.
Ich nehme in Anspruch meine Wenigkeit.
Wenn aber Gott Fleisch geworden ist
und ins Reagenzglas kommt und Farbe
bekennt, wenn er die Liebe sein sollte
und ich zweifle, daß etwas sein könnte
von dieser Art, wird mich das trösten.
Ich weiß, daß man die Opfer zwingen muß,
zueinander, ohne Vereinbarung noch.
Fliegenart will ein paar Tage, der Paria
einen Blick in den Kastenschlitz, die Ratte,
die Ich, die gänzlich Erniedrigten, wollen
die Rache, eh sie geschändet sterben –
wollen ein Wort des Bedauerns.
Die Kommune verzichtet.
Das Kapital einer zinsentragenden Grausamkeit
steht gegen das Kapital eines abnehmenden
Schmerzes.
Diese Gesellschaft richtet sich dennoch selbst.
Sterben ist es nicht, Aufstehen
ist das Wort. Ohne Verständnis
für die Ausbeutung diese Ausbeutung
beenden. Es komme die Revolution.
Es komme, so mag es denn kommen.
Ich zweifle. Aber es komme
die Revolution. auch von meinem Herzen, (KBW, 9 –10)9
Die verzweifelte Frage im ersten Vers – „Ist denn ein Mensch nichts unter Brüdern wert?“ – thematisiert das kapitalistische Wertgesetz, das sich als eines der bestimmenden Wortfelder durch das fragmentarische Gedicht zieht. Der Ausdruck „unter Brüdern“ ruft eine Formulierung aus Robert Musils Isis und Osiris in Erinnerung – „Aller hundert Brüder dieser eine“10 –, die in Bachmanns Franza-Roman leitmotivische Funktion erhält. Hier, in Eintritt in die Partei, verweist der Ausdruck auf die Leitidee der Brüderlichkeit in den religiösen und politischen Utopien von der frühchristlichen Antike bis heute. Durchgängig werden im Gedicht der nackte, geschundene Mensch, der „Homo sacer“, wie man mit Giogio Agamben sagen könnte, und seine Mitgeschöpfe als Objekt des kapitalistischen Wertgesetzes und der instrumentellen Vernunft dargestellt. Neben dem kapitalistischen Wertgesetz ist es das „Experiment“, das als Paradigma einer inhumanen Rationalität vorgeführt wird, die die Kreatur schändet: „Ein Leben, ein einziges, zum Experiment / gemacht. So ists gelungen. Vollbracht.“ Die Textsplitter der Passionsgeschichte – „Verleumdet und bespien, verhöhnt, verlästert“ und, in der dritten Strophe, „Vollbracht“ – erinnern an das paradigmatische Opfer des Jesus von Nazareth, auf das sich so viele Aufstände und politische Bewegungen berufen haben. Aber im Gedicht entspringt daraus kein Trost – „Wenn aber Gott Fleisch geworden ist / und ins Reagenzglas kommt und Farbe / bekennt, […] / wird mich das wenig trösten“ –, eher ist es den Menschen aufgegeben, Gott gemeinsam mit den gequälten Kreaturen, den „Genossen“ des Ich, zu befreien.
Mit dem Wertgesetz und mit dem Experiment spricht das Ich im Gedicht nicht nur die zentralen Paradigmen der instrumentellen Vernunft der Moderne an, sondern es erinnert auch an den literarischen und politischen Widerstand dagegen. Im Kontext ihrer Vorbereitung zur Büchnerpreis-Rede ist vor allem an Büchner zu denken, den revolutionären Dichter der Kreatur, wie ihn Paul Celan genannt hat. Bachmann radikalisiert in ihrem Gedicht Büchners Kritik der instrumentellen wissenschaftlichen Rationalität des Experiments, von der Woyzeck in seinem gleichnamigen Stück in die Krankheit getrieben wird. Sie greift damit eine ungewöhnliche kritische Tradition auf, die über Walter Benjamins Aktualisierung des Kreatur-Begriffs im Trauerspiel-Buch und über Horkheimer/Adornos Dialektik der Aufklärung bis zu Giorgio Agambens philosophischer Analyse der Experimente in den NS-Vernichtungslagern in Homo sacer führt.11
Bachmann dürfte sich durch die Studien zu ihrer Person, die Max Frisch für seinen Gantenbein-Roman anstellte, selbst als Objekt eines wissenschaftlichen Experiments gesehen haben. Aber der Text zeigt, wie ein zutiefst verletztes Ich fähig ist, die biographische Verletzung zu verwandeln in eine literarisch-politische Auseinandersetzung mit einer Welt, die dringend verändert werden muss. Jeder einzelne sprachliche Ausdruck protestiert gegen die beschämende Qual, die der Kreatur bereitet wird, die Dynamik des Gedichts drängt auf politisches Bewusstsein und Handlungsfähigkeit, die imstande wären, diese Leiden, „diese Ausbeutung / zu beenden.“ Die „Dialektik der Aufklärung“ wird hier, von einem krisenhaft erschütterten Ich, im Augenblick größter Gefahr, noch einmal gedacht, so dass sich die Formulierungen bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno wie ein Kommentar zum Gedicht lesen:
Daß sie [die Behavioristen] auf die Menschen dieselben Formeln und Resultate anwenden, die sie, entfesselt, in ihren scheußlichen physiologischen Laboratorien wehrlosen Tieren abzwingen, bekundet den Unterschied auf besonders abgefeimte Art. Der Schluß, den sie aus den verstümmelten Tierleibern ziehen, paßt nicht auf das Tier in Freiheit, sondern auf den Menschen heute. Er bekundet, indem er sich am Tier vergeht, daß er, und nur er in der ganzen Schöpfung, freiwillig so mechanisch, blind und automatisch funktioniert, wie die Zuckungen der gefesselten Opfer, die der Fachmann sich zunutze macht. […] Dem Menschen gehört die Vernunft, die unbarmherzig abläuft; das Tier, aus dem er den blutigen Schluß zieht, hat nur das unvernünftige Entsetzen, den Trieb zu Flucht, die ihm abgeschnitten ist.12
Und doch kann das Gedicht nicht vom philosophischen Kommentar eingeholt werden, weil in ihm auch die Wut und die Scham über diesen Zustand in den sprachlichen Ausdruck eingegangen sind und das Drängen nach Möglichkeiten der Veränderung, das die eigene Hilflosigkeit erfährt und sich auch „mit den Worten“ nicht mehr „zu helfen“ weiß (Keine Delikatessen). Und hilflos und verlassen wirken auch die aufgerufenen Shibboleths revolutionärer Losungen, die sich im Gedicht nirgends über die sterbliche und quälbare „Physis“ hinwegsetzen. „Sterben ist es nicht, Aufstehen / ist das Wort. Ohne Verständnis / für die Ausbeutung diese Ausbeutung / beenden. Es komme die Revolution.“
Das Gedicht denkt im Aufstand das „Aufstehen“ des Kranken mit, und in der Revolution das Wissen um das mögliche Scheitern, es bewahrt sich den Zweifel noch in der messianischen Hoffnung auf eine grundlegende Veränderung: „Es komme, so mag es denn kommen. / Ich zweifle. Aber es komme / die Revolution. auch von meinem Herzen,“. Die in Eintritt in die Partei angesprochene Politik, welche die für Schmerzen anfällige, sterbliche Physis kennt, hat Ingeborg Bachmann sogar in einem anderen Gedicht als ihre Idee der italienischen kommunistischen Partei bezeichnet.13
In allen Überlegungen zum eingreifenden Handeln ist bei Bachmann auch die Frage des Opfers gegenwärtig, die Problematik, die nie aufhörte, sie zu beschäftigen, ob und wie aus dem Opfer-Status auszubrechen wäre. Die Verse am Beginn der sechsten Strophe – „Ich weiß, daß man die Opfer zwingen muß, / zueinander, ohne Vereinbarung noch“ – gehören in den Zusammenhang dieses widersprüchlichen, in ihrem Werk immer wieder neu aufgegriffenen Opfer-Diskurses. Er nimmt im Gedicht Eintritt in die Partei eine ungewöhnlich radikale, aktivistische Richtung und trifft sich darin mit der Forderung, aus der „Moral der Opfer“ auszubrechen, die geradezu blasphemisch im Titelgedicht Ich weiß keine bessere Welt erhoben wird:
Ich weiß keine bessere Welt.
Die schwachsinnige Moral der Opfer läßt wenig hoffen.
Eine verruchte Frage, auf Ehre, allein,
kommt dem Gefolterten, dies Überlebens
sich wert zu zeigen, im Angriff, abzulegen
die schwachsinnige Moral der Opfer
sich zu erheben, […]
Auf die verruchten Fragen kommt sie
eines Tages, die lautlose, tätige Antwort. (KBW 20)