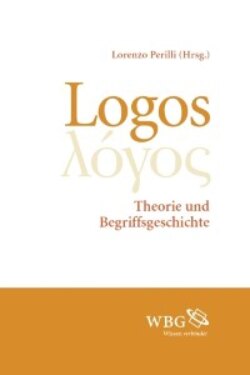Читать книгу Logos - Группа авторов - Страница 6
Vorwort
ОглавлениеAm 29. Mai 1927, hielt der berühmte Mathematiker Otto Toeplitz in Kiel einen Vortrag zum Thema „Das Verhältnis von Mathematik und Ideenlehre bei Plato“. Die Basis zu einer neuen, bahnbrechenden Darlegung einer der Hauptfragen des griechischen und somit des westlichen Denkens war gelegt. In Druck erschien der Text vier Jahre später in Berlin, im ersten Band der neugegründeten „Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik, Astronomie und Physik“. Drei herausragende Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der Altertumswissenschaftler Julius Stenzel aus Kiel, der Mathematiker und Wissenschaftshistoriker Otto Neugebauer aus Göttingen und Otto Toeplitz aus Bonn hatten zusammen entschieden, einen neuen – heute würde man sagen, interdisziplinären – Weg zu eröffnen. In einer neuen Interpretation des schwierigen, vielseitigen Begriffs Logos erzielte die gemeinsame Arbeit ihr erstes, bedeutendes Resultat, denn unter Berücksichtigung der mathematisch-geometrischen Bedeutung von „Verhältnis“ zwischen zwei Größen wurde ein Schlüssel für das genauere Verständnis der Grundgedanken der platonischen und der aristotelischen Lehre gefunden. Die entscheidende Rolle der Mathematik und der Zahlentheorie als Kennzeichen des griechischen Geistes insgesamt stand jetzt fest. Die zwei ersten Beiträge der Zeitschrift, die von Toeplitz und Stenzel stammen, bilden eine zusammenhängende Einheit, die in unserem Band als Ausgangspunkt wiederabgedruckt wird.
Diese Abhandlungen bildeten tatsächlich auch den Anfang einer Entwicklung, die sich durch das gesamte 20. Jahrhundert entfaltete, ohne sich jedoch durchsetzen zu können. Beide Beiträge, insbesondere der von Toeplitz, gaben Anstoß zu einer Reihe von Arbeiten in verschiedenen Fachgebieten: Musik, Philosophie, Mathematik. Die Theologie blieb zwar im Hintergrund, doch war die Komplexität der Bedeutung des theologischen Logos-Begriffs, die schon in dem berühmten ersten Satz des Johannes-Evangeliums zu erkennen ist, allen Vertretern dieser Forschungsrichtung bewusst. Der neutestamentliche Logos wurde eher als „dem griechischen Denken fremd“ betrachtet, als „grundsätzlich etwas anderes“ (s. unten, S. 278); sich von dessen Einwirkung zu befreien, blieb (und bleibt) trotzdem schwierig.
In diesem Band sind einige der wichtigsten Arbeiten aus dieser Forschungstradition gesammelt, mit dem Zweck, die grundlegende Einheit des Logos-Begriffs sowie die enge Verbindung zwischen den unterschiedlichen Gebieten des griechischen Wissens hervorzuheben. Der ausgezeichnete allgemeine Überblick von H. Kleinknecht, der nur Teil einer ausführlicheren Darlegung ist, vermag ein Bild der Entwicklung und der Komplexität, aber auch der Einheit von logos im Griechischen zu geben. Eine besondere Stellung hat natürlich in diesem Rahmen Heraklit, dessen Logos-Begriff zu den verschiedensten Interpretationen und zahlreichen Arbeiten Anlass gegeben hat. Eine einleuchtende Interpretation auf wenigen Seiten ist E. Minar geglückt. Ausgehend von der mathematischen Neigung, hebt er wichtige Aspekte der frühgriechischen Bedeutung des Wortes hervor. Parallel erscheinen einflussreiche Interpretationen wie diejenige von M. Heidegger, der in der Auseinandersetzung mit dem herakliteischen Logos-Begriff wertvolle Intuitionen mit philosophisch und semantisch fragwürdigen Gedankenspielen verbindet; trotz der Bedenken, die Heideggers Interpretationen der antiken Texte bei den Philologen und den Philosophiehistorikern erwecken, verdient sein Beitrag auch aufgrund des Einflusses, den er ausgeübt hat, einen Platz in diesem Sammelband. Die Studien des Freiburger Philosophen Heribert Boeder, und zwar besonders seine Analyse der zwei miteinander verbundenen Begriffe Logos und Aletheia, haben Heideggers Interpretation entscheidend geprägt. Merkmal von Boeders Ansatz ist sein Verzicht auf die Betrachtung des Logos-Begriffs im philosophischen Kontext, denn er fokussiert sich ganz auf die Dichtung der frühgriechischen Zeit und sucht somit ein „neutrales“ Licht auf den Begriff zu werfen. Aus demselben wissenschaftlich-kulturellen Zusammenhang stammte der Musik- und Sprachwissenschaftler Johannes Lohmann, der in Freiburg Kollege von Heidegger war und die Rolle des Logos-Begriffs in der griechischen Musik verfolgte. Er hatte auch den entscheidenden Anstoß zu Boeders Abhandlung gegeben.
Im weiteren Verlauf der Debatte rückten wieder die Mathematiker ins Zentrum. So haben z.B. die Figur des Theaitetos, das Thema der Inkommensurabilität oder die Funktion der Zahlen in den unterschiedlichsten Gebieten des griechischen Geistes zu manchen hervorragenden Beiträgen Anlass gegeben. Davon konnten für den vorliegenden Band nur einige Seiten ausgewählt werden, in denen die Rolle des Logos anerkannt und in einen breiteren Rahmen gestellt wird: sie stammen von Kurt von Fritz, Bartel L. van der Waerden und Siegfried Heller.
Maßgeblich für die Entscheidung, die wichtigsten und oft verkannten Beiträge zusammenzuführen und dem Leser zugänglich zu machen, war die Feststellung, dass moderne Mathematiker in dem Logos-Begriff den Schlüssel gesehen haben, nicht nur um nochmals – nach Toeplitz – eine adäquate Interpretation von Hauptfragen der antiken Philosophie wie der Ideenlehre Platos, der Logoslehre Heraklits und der theologischen Bedeutung des Logos-Begriffs vorzulegen, sondern auch um einige Begriffe und Verfahren der modernen Mathematik und Informatik tiefer zu begreifen. Darin lässt sich eine geistige Kontinuität ersehen; eine Brücke wird gebaut zwischen unterschiedlichen Epochen und Wissensgebieten, die eine gegenseitige Inspiration ermöglicht.
Mathematiker wie David Fowler oder Paolo Zellini haben nicht nur zum besseren Verständnis des Begriffes, sondern auch zu unserer Erkenntnis entscheidend beigetragen, dass ohne die Inanspruchnahme der Mathematik auch ein wesentlicher Teil der griechischen Philosophie und des griechischen Geistes überhaupt verborgen bleibt. Gegenüber der Mathematik hat der Philologe üblicherweise eine abwehrende, wenn nicht ungehaltene Reaktion; die Mühe, die die Lektüre der in diesem Band gesammelten Beiträge verlangt, verspricht aber eine sichere Belohnung.
***
Die Idee eines Buches über den Logosbegriff wurde vor einigen Jahren zuerst in München konzipiert; sie hat ihren Ursprung in den sommerlichen, später in Rom fortgeführten Gesprächen mit Paolo Zellini. Der Philosoph und Mathematikhistoriker Imre Toth hatte einen Text geliefert, der eine überarbeitete Fassung eines 1991 auf Französisch erschienenen Beitrags darstellt (Le problème de la mesure dans la perspective de l’être et du non-être. Zénon et Platon, Eudoxe et Dedekind: une généalogie philosophico-mathématique). Der Text umfasst mehr als 70 Seiten, und der Autor hatte mich gebeten, eine für den vorliegenden Band angepasste Fassung zu erstellen, die wir dann gemeinsam diskutieren wollten. Leider starb Imre Toth aber im Mai 2010 in Paris. Er hatte die gekürzte Fassung nicht mehr sehen können; deswegen die bedauerliche, aber unvermeidliche Entscheidung, seinen Beitrag nicht zu drucken. Der Musikologe A. Riethmüller hatte auch freundlicherweise den Vorschlag angenommen, seinen 1985 erschienenen Artikel Logos und Diastema in der griechischen Musiktheorie (Archiv für Musikwissenschaft 42, 1985, 18-36) im Band wieder abdrücken zu lassen: dies erwies sich leider für den Herausgeber aus zeitlichen Gründen nicht mehr möglich.
Meinen aufrichtigen Dank möchte ich der Alexander von Humboldt-Stiftung sagen, einer herausragenden Institution, die meine Forschung immer großzügig gefördert und einen Beitrag für die Kosten dieses Bandes zur Verfügung gestellt hat. Des weiteren gebührt mein Dank Christian Brockmann, der in den letzten Jahren meine Forschungstätigkeit unterstützt und mir ermöglicht hat, als Gast des Instituts für Griechische und Lateinische Philologie der Universität Hamburg meine Arbeit unter den besten Umständen zu Ende zu führen. Er hat die Arbeit fortwährend mit freundlichem und lebhaftem Interesse begleitet und mehreres dazu beigetragen. Mit besonderer Dankbarkeit denke ich an die ständige Hilfsbereitschaft von Carl Joachim Classen, der mir in vielen Fragen bereitwillig beigestanden hat. Herzlich danken möchte ich schließlich Susanne Rothe für die sorgfältige Lektüre einiger Teile des Buches.
Die Übersetzung der Beiträge von D. Fowler und E. Minar sowie der Einleitung hat Christine Henschel, die des Beitrags von Paolo Zellini hat Kathrin Wolf erstellt. Meine Schülerin Ambra Serangeli hat bei der Bearbeitung des danach entfallenen Textes von I. Toth sowie bei der Digitalisierung einiger Materialien effektiv geholfen.
Einige Beiträge, insbesondere der von K. von Fritz, werden hier nur teilweise abgedruckt; Auslassungen sind mit […] gekennzeichnet. Einfügungen des Herausgebers sind kursiv in [ ] angegeben. Die gestalterischen Merkmale der Beiträge (z.B. Verwendung der Kursivschrift, Zitierweise) wurden so weit wie möglich beibehalten, Seitenverweise auf in diesem Band enthaltene Beiträge wurden aktualisiert. Gezielte bibliographische Hinweise findet der Leser am Ende der Einleitung sowie nach den Beiträgen von Heller, Fowler, Zellini.
| Rom-Hamburg, im August 2012 | Der Herausgeber |