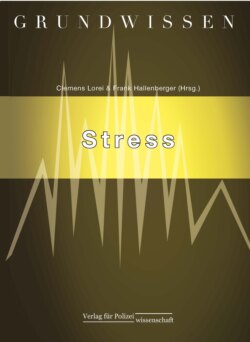Читать книгу Grundwissen Stress - Группа авторов - Страница 9
ОглавлениеStressmanagement
Dagmar Siebecke1, Gert Kaluza2
1 Dr., Technische Universität Dortmund
2 Prof. Dr., GKM-Institut für Gesundheitspsychologie, Marburg
Psychosozialer Stress stellt einen bedeutsamen (mit-) verursachenden, auslösenden oder verstärkenden Faktor bei weit verbreiteten chronisch-degenerativen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf- und Stoffwechselkrankheiten, bei psychosomatischen und psychischen Erkrankungen sowie bei einer Vielzahl weiterer Krankheitsbilder und Beschwerden dar (vgl. Beiträge von Arndt & Beerlage, Kastner und Polndorfer in diesem Buch sowie Kaluza & Renneberg, 20091). Daher kommt der Förderung individueller Kompetenzen zur Bewältigung alltäglicher Belastungen im Rahmen der Gesundheitsförderung eine zentrale Bedeutung zu. In ihrem Leitfaden Prävention schlagen die Spitzenverbände der Krankenkassen2 hierfür zwei Maßnahmenkomplexe vor:
• Maßnahmen zur Entspannung
• Maßnahmen zur multimodalen Stressbewältigung
Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. August 2010. Berlin: GKV.
1. Maßnahmen der Entspannung
Entspannungstechniken zielen physiologisch auf die Beeinflussung des vegetativen Nervensystems. Zum Ausgleich von Anspannungszuständen und Stressreaktionen, bei denen der aktivierende Part des Nervensystems, der Sympathikus (verantwortlich für körperliche Aktivierungs- und Erregungsmuster), wirksam ist, soll durch den Einsatz der Entspannungstechniken der für Entspannung zuständige Parasympathikus angeregt werden. Dadurch können körperliche Erregungszustände abgebaut werden (z. B. Senkung von Puls und Blutdruck, Förderung der Verdauungstätigkeit, Muskelentspannung, Beruhigung der Atmung). Über die körperliche Entspannung hinaus bewirken Entspannungstechniken auch einen Abbau psychischer Anspannung und fördern Erlebnisse innerer Ruhe und Gelassenheit.
Wagner-Link (20103) unterscheidet Entspannungstechniken auf muskulärer, vegetativer, emotionaler und kognitiver Ebene. Hinzu kommen Verfahren, die mit Bewegung verbunden sind sowie unsystematische Entspannungs-Ansätze (vgl. Tabelle 1).
Tabelle 1
Formen von Entspannungstechniken (vgl. hierzu auch Wagner-Link, 20104)
| Muskuläre Ebene | Konzentrative Muskelentspannung | Durch Konzentration auf einzelne Muskelgruppen werden diese entspannt. |
| Progressive Muskelentspannung | Zur Bewusstmachung von Spannungszuständen und zur gezielten Entspannung werden einzelne Muskelgruppen im Wechsel an- und dann wieder entspannt. Es folgt die bewusste, genießende Wahrnehmung der Entspannung. | |
| Vegetative Ebene | Autogenes Training | Autosuggestives Verfahren, bei dem durch intensive Vorstellungen von Entspannungsphänomenen (z. B. Wärme) das vegetative Nervensystem beeinflusst wird. |
| Atemtechniken | Bewusste, ruhige Atmung mit Betonung der Ausatmungsphase, ggf. gekoppelt mit Wortwiederholungen oder Zählen. | |
| Emotionale Ebene | Fantasiereisen | Lenkung der Wahrnehmung auf innere Bilder mit positiver, entspannender Konnotation. |
| Suggestive Musik | Lenkung der Wahrnehmung auf ruhige, entspannende Musik. | |
| Kognitive Ebene | Meditation | Methode der inneren Versenkung, mit dem Ziel der Konzentration auf den Augenblick und die Schulung der Achtsamkeit. |
| Verfahren in Bewegung | Tai-Chi/Qigong | Meditative Konzentrations-, Bewegungs- und Kampfkunstübungen zur Lenkung der Qi-Energie. |
| Yoga | Geistige und körperliche Übungen mit Elementen wie geistige Konzentration und Atemübungen, mit dem Ziel, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. | |
| Unsystematische Verfahren | Aktivitäten, die individuell zur Entspannung genutzt werden wie Schwimmen, Spazieren gehen, Massagen, Lesen, Hobbys etc. |
Die Wirksamkeit von systematischen Entspannungstechniken zum Ausgleich von Stress ist empirisch hinreichend belegt (vgl. Vaitl & Petermann, 19935). Die gesetzlichen Krankenkassen erkennen insbesondere die Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, das Autogene Training nach Schultz, Hatha Yoga, Tai-Chi und Qigong als förderungswürdige Entspannungsmethoden an (d. h. sie bezuschussen die Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen finanziell). Allerdings ist Voraussetzung für die Wirksamkeit, dass die Techniken regelmäßig angewandt und trainiert werden (vgl. Meichenbaum, 20036) und dies möglichst präventiv (also nicht erst in Phasen akuter negativer Beanspruchung, da es oft schwer fällt, ungeübt aus einer extremen Anspannung einen Entspannungszustand zu realisieren). Das beinhaltet auch eine selbstgesteuerte Anwendung: Da ein zentrales Ziel von Entspannungstechniken ist, sich selbst in oder nach Belastungssituationen zu beruhigen, sollte möglichst keine Abhängigkeit von speziellen Trainern oder Audioformaten bestehen. Zum Erlernen von Entspannungstechniken ist es zunächst sinnvoll, entsprechende Workshops zu besuchen oder Lehrmedien wie Audioformate7, Filme8 oder Apps9 zu nutzen. Für die flexible Nutzung ist es aber wichtig, Entspannung mehr und mehr selbständig zu trainieren.
Bei entsprechendem Training ist es möglich, die erforderlichen Zeiten für die Entspannung immer weiter zu reduzieren und Kurzformen zu nutzen. So kann man beispielsweise bei der progressiven Muskelrelaxation die Muskeln, die an- und entspannt werden, immer weiter zu Gruppen zusammenfassen, sodass schließlich eine einzelne Anspannung mit anschließender Entspannung genügen kann. Zudem ist es möglich, Ruheworte oder -gesten mit der Entspannung zu koppeln: Indem man während des Trainings im entspannten Zustand immer wieder ein bestimmtes Wort denkt oder ein bestimmtes Bild vor Augen hat oder eine Handhaltung einnimmt, kann die Entspannung auf diesen Reiz (Wort, Bild, Haltung) konditioniert werden. Das heißt, man lernt die enge Verknüpfung zwischen Wort, Haltung oder Bild und dem entspannten Zustand, sodass es durch die enge Kopplung beider schließlich genügt, beispielsweise nur noch das Wort zu denken, um in den entspannten Zustand zu gelangen. Die eigentlichen Entspannungsformeln und -techniken sind nicht mehr erforderlich. Insbesondere wenn man diese Wege der Spontanentspannung beherrscht, können Entspannungstechniken auch direkt in akuten Stresssituationen genutzt werden. Dies ist gerade im polizeilichen Alltag eine wichtige Voraussetzung für den praktischen Nutzen von Entspannungstechniken, da man in der Regel nicht einfach die belastende Situation verlassen kann. Ist man durch entsprechendes Training in der Lage, sich durch kurze Instruktionen, Worte oder Gesten zu beruhigen, so hilft dies auch in außergewöhnlichen, belastenden Situationen handlungsfähig zu bleiben.
Unsystematische Verfahren wie sportliche Aktivitäten, Lesen, Sauna, Briefmarken sammeln sind sehr individuell. Entsprechend ist es kaum möglich, empirische Daten über ihre Wirksamkeit zu erstellen bzw. auf den individuellen Einzelfall zu übertragen. Sonnentag (200110) hat untersucht, wie sich verschiedene Freizeitaktivitäten auf das Wohlbefinden auswirken. Dabei ist Wohlbefinden nicht mit Entspannung gleichzusetzen. Entspannung ist definiert als ein „Zustand reduzierter metabolischer, zentralnervöser unbewusster Aktivität“11. Dies führt in der Regel zu Wohlbefinden. Aber auch aktivierende Verhaltensweisen können das Wohlbefinden fördern. So konnte Sonnentag nachweisen, dass arbeitsbezogene Freizeitaktivitäten zu einer Verschlechterung des Befindens führen, soziale Aktivitäten sowie Tätigkeiten ohne Anstrengung bewirken eine teilweise Verbesserung und körperliche, sportliche Beschäftigung eine deutliche Verbesserung des Befindens. Ob eine Aktivität im individuellen Fall zu dem gewünschten Entspannungs- und Ausgleichseffekt führt, hängt auch von der Art der zuvor erlebten Belastung ab. So können nach einem körperlich anstrengenden Arbeitstag insbesondere geistig anregende Tätigkeiten ohne körperliche Anstrengung oder soziale Aktivitäten den richtigen Ausgleich darstellen. Nach einem Arbeitstag dagegen, der mit vielfältigen sozialen Kontakten gefüllt ist, sind eher Beschäftigungen ohne Kommunikationsbedarf sinnvoll.
Insgesamt dienen gut trainierte Entspannungstechniken dazu, Erregungsspitzen in akuten Stresssituationen zu dämpfen und negative Folgen körperlicher Stressreaktionen für die Gesundheit (z. B. Schlafstörungen, Kopfschmerzen …) zu begrenzen.
Bei regelmäßiger Praxis fördern sie eine Haltung innerer Ruhe und Gelassenheit, die dazu beitragen kann, dass Stressreaktionen weniger häufig und weniger intensiv erlebt werden. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Stress auslösenden Faktoren selbst zu beeinflussen. Hier setzen die Maßnahmen zur multimodalen Stressbewältigung an.
2. Multimodale Stressbewältigung
Das generelle Ziel von Programmen zur multimodalen Stressbewältigung besteht in der Förderung der körperlichen Gesundheit und des seelischen Wohlbefindens der Teilnehmer durch eine Reduktion der Häufigkeit und Intensität alltäglicher Belastungsempfindungen. Dieses Ziel wird durch eine Verbesserung der individuellen Bewältigungskompetenzen angestrebt.
Die meisten publizierten Stressmanagement-Ansätze bauen auf dem transaktionalen Stressansatz von Lazarus (1966,12 Lazarus & Launier, 198113) auf. Lazarus geht davon aus, dass ein Stressor nicht direkt eine Stressreaktion bei einer Person auslöst. Vielmehr liegen zwischen Auslöser und Reaktion individuelle Bewertungsprozesse.
Primäre Bewertungen
Bei der primären Bewertung schätzt das Individuum ein, inwiefern die Situation eine Bedrohung („threat“) oder Herausforderung („challenge“) darstellt oder ob durch sie bereits ein aktueller Schaden oder Verlust („harm-loss“) eingetreten ist.
Beispiel
Sie werden wegen des Verdachts häuslicher Gewalt in ein Mehrfamilienhaus gerufen.
„Wenn ich das jetzt vermassele, kann ich die gute Beurteilung und damit meine Karrierepläne vergessen!“ (Bedrohung) „Na typisch – jetzt fehlt mir die Zeit, meinen ausstehenden Bericht in Ruhe fertigzustellen, und den rechtzeitigen Feierabend kann ich auch vergessen!“ (Schaden-Verlust)
„Jetzt kann ich endlich zeigen, was ich im Deeskalationstraining gelernt habe.“ (Herausforderung)
„Das ist Routine.“ (stressneutral)
Sekundäre Bewertungen
Hier geht es um die Einschätzung eigener Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten. Eine stressbezogene sekundäre Bewertung liegt dann vor, wenn die Person ihre Möglichkeiten als nicht ausreichend für eine Bewältigung der jeweiligen Anforderung einschätzt.
Beispielhafte Bewertungen können auf das obige Beispiel bezogen sein:
Beispiel
„Das schaffe ich mit links. Ich habe viel Erfahrung – sowohl bei der Deeskalation als auch im Umgang mit Opfern.“
„Wenn Kollege Müller dabei ist, bin ich immer so verunsichert und kriege das bestimmt nicht souverän hin.“
„Den Stress halte ich nicht aus!“
Erst das Ergebnis dieser Bewertungsprozesse entscheidet darüber, ob beim Individuum eine Stressreaktion ausgelöst wird oder nicht (Abb. 1).
Abbildung 1
Entsprechend des transaktionalen Stressmodells setzten die multimodalen Stressbewältigungsansätze an bei den Stressaspekten
• Situation (Stressor),
• Bewertung und
• Stressreaktion.
Viele Autoren15 sprechen hier analog auch von S-O-R: Dabei steht S für Stressor, O für Organismus und R für Reaktion. Korrespondierend zu diesen Stressaspekten lassen sich pragmatisch drei Hauptwege (Modalitäten) des individuellen Stressmanagements unterscheiden (vgl. Kaluza, 200616):
• Instrumentelles Stressmanagement setzt an den Stressoren an mit dem Ziel, diese zu reduzieren oder ganz auszuschalten, z. B. durch Umorganisation des Arbeitsplatzes, durch Veränderung von Arbeitsabläufen, durch die Organisation von Hilfen etc. Instrumentelles Stressmanagement kann reaktiv auf konkrete, aktuelle Belastungssituationen hin erfolgen und auch präventiv auf die Verringerung oder Ausschaltung zukünftiger Belastungen ausgerichtet sein. Instrumentelles Stressmanagement erfordert über die für die Erfüllung der jeweiligen Anforderungen nötige Sachkompetenz hinaus sozial-kommunikative Kompetenzen und Selbstmanagementkompetenz als Fähigkeit zu einem eigengesteuerten und zielgerichteten Handeln.
• Kognitives Stressmanagement zielt auf eine Änderung eigener Merkmale in Form von persönlichen Motiven, Einstellungen und Bewertungen. Auch hier können sich die Bewältigungsbemühungen auf aktuelle Bewertungen in konkreten Belastungssituationen oder auf situationsübergreifende, habituelle Bewertungsmuster beziehen. Diese bewusst zu machen, kritisch zu reflektieren und in stressvermindernde Bewertungen zu transformieren, ist das Ziel kognitiver Interventionsansätze der Stressbewältigung (Meichenbaum, 200317, Schelp, Gravemeier & Maluck, 199718).
• Beim palliativ-regenerativen Stressmanagement steht die Regulierung und Kontrolle der physiologischen und psychischen Stressreaktion im Vordergrund. Es beinhaltet alle Versuche, unlustbetonte Stressemotionen wie Angst, Ärger, Schuld, Neid, Kränkung und den mit diesen einhergehenden quälenden physiologischen Spannungszustand positiv zu beeinflussen. Auch hier kann unterschieden werden zwischen solchen Bewältigungsversuchen, die zur kurzfristigen Erleichterung und Entspannung auf die Dämpfung einer akuten Stressreaktion abzielen (Palliation), sowie eher längerfristigen Bemühungen, die der regelmäßigen Erholung und Entspannung dienen (Regeneration).
Das heißt, in potenziell Stress auslösenden Situationen können verschiedene Coping-(Bewältigungs-) Strategien eingesetzt werden, um entweder die stressauslösende Situation zu entschärfen, die Situation umzubewerten oder für Ausgleich und Regeneration zu sorgen.
Beispiel
Sie erfahren, dass Ihre Beurteilung nicht so positiv ausgefallen ist, wie Sie erwartet haben.
Beispiele für instrumentelles Stressmanagement:
Sie schalten den Personalrat ein und reden mit Ihrem Vorgesetzten, um die Beurteilung besser nachvollziehen zu können, versuchen eine Korrektur zu bewirken und klären mit Ihrem Vorgesetzten, wie sie bei der nächsten Beurteilung eine Verbesserung erreichen können.
Beispiele für kognitives Stressmanagement:
Sie sagen sich: „Das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Die Beurteilungen hängen anscheinend mehr von der Karriereplanung als von der Leistung ab. Ich weiß, dass ich gut bin. Wenn ich an der Reihe bin für eine Beförderung, wird meine Beurteilung auch passend ausfallen.“ oder „Ich will ohnehin keine Karriere machen. Ich fühle mich in meinem aktuellen Job sehr wohl.“
Beispiele für palliativ-regeneratives Stressmanagement:
Sie reagieren sich durch einen Waldlauf ab und suchen Ablenkung durch einen Besuch bei Freunden, bei denen Sie „Dampf ablassen“ können.
Inzwischen wurden zahlreiche Stressmanagement-Trainings entwickelt und in ihrer Wirksamkeit überprüft, die dem dargestellten transaktionalen Stressmanagement-Ansatz folgen.
Beispiele sind:
• „Gelassen und sicher im Stress“ nach Kaluza (Kaluza, 2007, 201119)
• Verhaltenstraining zur Stressbewältigung nach Wagner-Link (201020, Weiterentwicklung des Stressbewältigungstrainings für die Polizei nach Brengelmann, 198821, vgl. auch Krauthan, 200422)
• Rational-Emotive Therapie gegen Stress (Schelp et al., 199723)
• Stressimpfungstraining nach Meichenbaum (Meichenbaum, 200324)
• „Gelassen bei der Arbeit“ (Wiegard et al., 200025)
• „Optimistisch den Stress meistern“ (Reschke & Schröder, 201026)
• Gesundheitsförderung und Selbstregulation durch individuelle Zielanalysen – GUSI (Storch & Olbrich, 201127; Programm zur Gesundheits förderung aufbauend auf dem Zürcher Ressourcen Modell, Storch & Krause, 201028)
In den Trainings wird in der Regel stressrelevantes Hintergrundwissen (Was ist Stress? Welche physiologischen Prozesse laufen bei Stress ab? Welche Zusammenhänge bestehen zwischen Stress und Gesundheit?) vermittelt und eine Stressanalyse oder -diagnostik durchgeführt: Durch klinische Interviews, Erfahrungsaustausch, Selbstbeobachtung, vorstellungsgestütztes Erinnern oder psychologische Testverfahren werden kritische Situationen sowie das eigene Denken, Verhalten und Erleben in stressauslösenden Situationen reflektiert und analysiert. Auf der Basis dieser Analysen werden dann individuelle Ansätze des Stressmanagements auf den drei Ebenen (instrumentelles, kognitives und palliativ-regenertives Stressmanagement) entwickelt und trainiert.
Im Folgenden werden zentrale Bausteine multimodaler Stressmanagementprogramme näher erläutert.
2.1 Instrumentelles Stressmanagement
Ziel des instrumentellen Stressmanagements ist es, eine potenziell stressauslösende Situation so zu beeinflussen, dass sie keine – oder zumindest weniger – negative Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten hat. Dies kann kurzfristig in der Situation selbst stattfinden oder langfristig durch präventive Maßnahmen.
Problemlösen
Probleme lösen Stress aus, wenn der Betroffene keine geeigneten Lösungsmöglichkeiten sieht – wenn also die sekundäre Bewertung im Sinne des transaktionalen Stressmodells von Lazarus & Launier29 (s. o.) negativ ausfällt. Stressmanagement-Trainings dienen daher auch dazu, die Teilnehmer bei der Suche nach und der Umsetzung von Strategien zum Umgang mit alltäglichen und beruflichen Problemen zu unterstützen und ihnen dadurch mehr Sicherheit zu geben. Die Fähigkeit der Teilnehmer zu einer lösungsorientierten, konstruktiven Auseinandersetzung mit Problemen soll verbessert werden. Problemlösungsdefizite, die auf den verschiedenen Stufen des Problemlösungsprozesses angesiedelt sein können, sollen ausgeglichen und die Teilnehmer zu einem systematischen Problemlösungsverhalten angeleitet werden.
Das Problemlösetraining dient implizit dem Erwerb einer allgemeinen, problemlösenden Grundhaltung, die (nach Goldfried & Goldfried 197630) aus folgenden Faktoren besteht:
• der Einsicht, dass Problemsituationen zum normalen Leben gehören,
• der Annahme, dass man solche Situationen aktiv meistern kann,
• der Bereitschaft, Problemsituationen im Augenblick ihres Auftretens wahr- und anzunehmen sowie
• der Entschlossenheit, der Versuchung zu impulsivem Handeln zu widerstehen.
In den verschiedenen Stressmanagement-Ansätzen (z. B. von Kaluza, Wagner-Link, Meichenbaum) werden unterschiedliche Konzeptionalisierungen des Problemlöseansatzes genutzt, die vor allem hinsichtlich der Anzahl der verwandten Problemlöseschritte variieren. Kaluza (201131) schlägt beispielsweise in Anlehnung an Grawe et al. (198032) sowie Kämmerer (198333) eine Gliederung in sechs Schritte vor:
Schritt 1: „Dem Stress auf die Spur kommen“: Die Teilnehmer werden zu einer systematischen Selbstbeobachtung von Belastungssituationen und -reaktionen angeleitet. Sie lernen, anhand eines vereinfachten verhaltensanalytischen Schemas ihre zunächst allgemein formulierten Stresserfahrungen als „Verhalten-in-Situationen“ zu konkretisieren.
Schritt 2: „Ideen zur Bewältigung sammeln“: Hier erfolgt, unter Beteiligung der gesamten Kursgruppe bzw. im Sinne einer kollegialen Beratung, eine bewertungsfreie Suche nach Möglichkeiten der Bewältigung der belastenden Situation in Form eines Brainstorming.
Schritt 3: „Den eigenen Weg finden“: Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Konsequenzen trifft der Teilnehmer eine Positiv-Auswahl unter den vorgeschlagenen Bewältigungsmöglichkeiten und entscheidet sich für einen der (ggf. auch eine Kombination mehrerer) Vorschläge.
Schritt 4: „Konkrete Schritte planen“: Hier geht es darum, das konkrete Vorgehen bei der Realisierung des ausgewählten Vorschlages möglichst genau zu planen. Rollenspiele und Vorstellungsübungen werden eingesetzt, um den Teilnehmer gut auf die Durchführung der Schritte im Alltag vorzubereiten.
Schritt 5: „Im Alltag handeln“: Dieser zentrale Schritt des Problemlöseprozesses, auf den alle vorhergehenden Schritte hinführen, findet außerhalb der Kursstunden statt.
Schritt 6: „Bilanz ziehen“: In diesem letzten Schritt der Problemlösesequenz geht es darum, die Ergebnisse der Durchführung (Schritt 5) zu bewerten und nach Gründen für das Gelingen oder Misslingen der Problemlösung zu suchen.
Die aufgeführten Schritte sind einem Gruppentraining entnommen. Sie gelten analog auch für das individuelle Problemlösen.
Selbstbehauptung und Kritik
Bei dem Thema der Selbstbehauptung und Kritik geht es um die Stärkung der sozialen Kompetenz, die erforderlich ist, um Grenzen zu ziehen, negative Emotionen wie Ärger zu bewältigen und „nein“ zu sagen. Es geht also um die Frage, wie eigene Interessen und Bedürfnisse formuliert werden können, ohne dabei Restriktionen oder Sanktionen befürchten zu müssen. Wiegard et al. (200034) arbeiten hier mit Vorstellungsübungen zur negativen Kritik, Erfahrungsaustausch und praktischen Übungen. Daraus werden mit den Teilnehmern Regeln zur Selbstbehauptung und zur Formulierung von Kritik entwickelt, wie beispielsweise
• deutliche, klare, laute Stimme verwenden
• häufiger Blickkontakt
• Ich-Botschaften verwenden (Gebrauch von „ich“ statt „man“ oder „wir“)
• keine unnötigen Entschuldigungen oder Rechtfertigungen
• klare, kurze Formulierungen
• beim Kritisieren konkret benennen, was stört (keine Verallgemeinerungen)
Für die Rolle des Kritisierten wird eingeübt:
• Zuhören (keine voreilige Rechtfertigung)
• Schwächen eingestehen
• berechtigte Kritik annehmen
• unberechtigte Kritik zurückweisen
• sich ggf. entschuldigen
• Blickkontakt halten
Im Rahmen des instrumentellen Stressmanagements geht es hier insbesondere um die Entwicklung und Erprobung von Verhaltensweisen. Wie Kritik gedanklich bewertet und verarbeitet wird, ist Thema des kognitiven Stressmanagements (s. u.). Dort geht es auch darum, wie ich mit meinen eigenen Ansprüchen umgehe, die letztendlich darüber entscheiden, ob es mir gelingt mich abzugrenzen und „Nein“ zu sagen. Instrumentelles und kognitives Stressmanagement greifen also stark ineinander.
Zeitmanagement
Zeitdruck ist ein nahezu allgegenwärtiger Hintergrundstressor für sehr viele Menschen. Ständiger Zeitdruck, das chronische Gefühl des Zeitmangels und Hetze sind nicht nur ein häufiger Auslöser für Belastungsreaktionen, sondern stellen auch ein großes Hindernis für eine palliative und regenerative Stressbewältigung dar. Ziel ist es, den persönlichen Umgang mit der Zeit zu reflektieren, eigene Verhaltensweisen und Einstellungen als mitverursachend für Zeitprobleme zu erkennen und Anregungen zu einer gesundheitsförderlichen Zeiteinteilung zu geben. Es geht darum, ein möglichst hohes Maß an Zeitsouveränität zu gewinnen und den Gebrauch der Zeit an den eigenen beruflichen, familiären und persönlichen Zielen auszurichten. Das Ziel ist nicht ein gefülltes, sondern ein er-fülltes Leben, in dem eine ausgewogene Balance zwischen Zeit für Arbeit und „freier“ Zeit, zwischen Zeit für sich und Zeit für andere herrscht.
Fazit
Zeitmanagement dient also nicht dazu, in dem Polizeialltag noch mehr unterzubringen und mehr zu leisten – die Arbeit zu verdichten. Zeitmanagement dient vielmehr dazu, Raum zu schaffen für ein Leben in Balance, bei dem Familie, Freunde, soziales Engagement, Gesundheit und persönliche Werte ebenso ihren Raum finden wie die Arbeit.
Wichtige Aspekte des Zeitmanagements sind beispielsweise im Programm „Gelassen und sicher im Stress“ (Kaluza, 201135)
• Die Unterscheidung zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit bei der Prioritätensetzung und Arbeitsplanung (nicht alles, was dringend ist, ist auch wichtig).
• Die Berücksichtigung persönlicher Leistungskurven bei der individuellen Arbeitsplanung (Leistungshochs sollten nicht mit Routinetätigkeiten „verschwendet“ werden, in Tiefpunkten der Leistungsfähigkeit fällt geistig anspruchsvolle Tätigkeit schwerer und dauert länger).
• Die Einplanung regelmäßiger Pausen. Seiwert (200536) weist mit seinem Bestsellertitel „Wenn Du es eilig hast, gehe langsam“ darauf hin, dass Ruhepausen ein wichtiges Instrument sinnvoller und effektiver Arbeitsgestaltung sind.
• Die realistische Einschätzung des Zeitbedarfs. Dies schließt die Einplanung von realistischen Pufferzeiten, Zeiten für soziale Interaktionen und Lernen ein.
• Nachkontrollen: Zeitmanagement sollte ein fortlaufendes, „lernendes System“ sein.
2.2 Kognitives Stressmanagement
Kognitives Stressmanagement setzt an den gedanklichen Möglichkeiten des Stressabbaus und der -bewältigung an. Ansatzpunkte sind die reflektierte Situationsbewertung, Selbstinstruktionen, Einstellungsänderungen, die Entwicklung bzw. Konkretisierung von Zielen sowie die Gefühlsregulation. Damit beziehen sich die Ansätze des kognitiven Stressmanagements auf die Bewertungsprozesse, die für die Entstehung von Stressempfindungen nach dem transaktionalen Stressmodell Lazarus (s. o.) Voraussetzung sind.
Reflektierte Situationsbewertung
Wie im transaktionalen Stressmodell dargestellt, führt erst die Situationsbewertung zu dem Empfinden von Stress. Folglich kann eine positive Gedankensteuerung dazu beitragen, belastende Situationen weniger negativ, neutral oder gar positiv zu erleben. Entsprechend kommt dem Bewertungsaspekt beim Stressmanagement eine zentrale Bedeutung zu. Die meisten Ansätze zur Stressbewältigung arbeiten daher an den Bewertungsprozessen, die in Stresssituationen ablaufen.
Hierzu ist es erforderlich, in einem ersten Schritt zu erkennen, wann und wie das Erleben und Verhalten durch eigene Bewertungen negativ beeinflusst wird. Dann gilt es, die stressverschärfenden Bewertungen zu hinterfragen und ggf. zu modifizieren.
Mentale Strategien des kognitiven Stress-managements in konkreten Situationen sind beispielsweise:
• Realitätstestung und Konkretisierung
• Blick auf das Positive, auf Chancen und Sinn
• Orientierung auf eigene Stärken und Erfolge
• Orientierung auf positive Konsequenzen und Entkatastrophisierung
• Relativierung und Distanzierung im Sinne einer realistischen Betrachtung, die nicht bagatellisiert, sondern den größeren Kontext ohne emotionale Verflechtung beleuchtet
Beispiel
Ihr Vorgesetzter schickt Sie nach Hiltrup an die DHPol, um dort vor den Studenten über die Ermittlungserfahrungen mit einer neuen Recherchesoftware zu berichten.
Ihre stressverschärfenden Gedanken:„Das darf doch nicht wahr sein! Immer ich! Ich habe so viel anderes zu tun, was dann alles liegen bleibt und mich zu Überstunden zwingen wird. Außerdem sind die Studenten in Hiltrup ja auch alle erfahrene Ermittler. Da kann ich mich ja nur blamieren!“
Realitätstestung und Konkretisierung: „Werde ich wirklich häufiger herangezogen als meine Kollegen? Wie wichtig und dringend sind die Dinge, die ich dafür liegen lassen muss?“
Blick auf das Positive, auf Chancen und Sinn: „Toll, dass der Chef mir das zutraut!“ oder „Vielleicht schlägt sich das positiv auf meine nächste Beurteilung nieder!“ oder „Vielleicht kann ich interessante Kontakte knüpfen!“
Orientierung auf eigene Stärken und Erfolge: „Als ich die Software hier in der Dienststelle vorgestellt habe, war das ein großer Erfolg.“ oder „Unter Zeitdruck arbeite ich eigentlich immer besonders effektiv – bislang habe ich solche Zusatzaufgaben immer gut in den Griff bekommen.“
Orientieren auf positive Konsequenzen und Entkatastrophisierung: „Ich werde sehr stolz sein, wenn ich das geschafft habe.“ Oder „Selbst wenn es nicht optimal läuft, passiert doch nichts weiter, als dass die Vorbereitung umsonst war. “
Relativierung und Distanzierung: „Meine Freunde würden sagen: Pfeif doch auf die Berichte – so ein Auftritt ist doch eine super Chance!“ oder „In fünf Jahren werde ich nur noch stolz an den Vortrag denken – die Überstunden habe ich schnell vergessen.“
Selbstinstruktion
Selbstinstruktion dient einer reflektierten, systematischen Handlungssteuerung. Aus früheren Erfahrungen automatisiert ablaufende stressverstärkende Kognitionen werden gestoppt und durch Selbstinstruktionen ersetzt, die eine konstruktive Stressbewältigung unterstützen. Storch & Krause37 widmen sich in ihrem Zürcher Ressourcen Modell u. a. dem Stoppen automatisierter Stressreaktionen, indem sie die Relevanz von Vorläufersignalen betonen: Stressreaktionen tauchen nicht aus heiterem Himmel heraus auf. Oft gibt es typische Muster in den Stress auslösenden Situationen, Kognitionen oder körperlichen Spontanreaktionen. Für diese Vorläufersignale muss eine Sensibilität entwickelt werden. Bei ihrem Auftreten sind Stopp-Instruktionen angezeigt. Das kann das Wort „Stopp!“ sein, aber auch andere Selbstinstruktionen oder selbstinduzierte Bilder, die dazu dienen, Automatismen zu unterbrechen, um dann geeignete Ressourcen einzusetzen.
Meichenbaum38 fordert in seinem Stressimpfungstraining zu Selbstinstruktionen mit den Zielen auf (S. 90)
• die Situationsmerkmale zu erkennen und sich auf zukünftige Stressoren vorzubereiten,
• selbstabwertende und Stress erzeugende Gedanken, Bilder und Gefühle zu kontrollieren,
• den Stress bewusst wahrzunehmen und ihn umzubewerten,
• negative Gefühle zu bewältigen,
• sich innerlich auf die Stressbewältigung einzustellen,
• das Resultat der Stressbewältigung zu bewerten und sich für die Bewältigungsanstrengung zu loben.
Entsprechend beziehen sich die Selbstinstruktionen auf folgende Phasen (Meichenbaum S. 92 f):
• Vorbereitung auf den Stressor (z. B. „Was habe ich zu tun?“, „Ich denke erst einmal darüber nach, was ich machen kann.“)
• Konfrontation und Bewältigung des Stressors (z. B. „Ein Schritt nach dem anderen!“, „Unterteile den Stress in übersichtliche Einheiten!“, „Ich verfüge über ein reichhaltiges Bewältigungsrepertoire.“)
• Kritische Momente – Überforderungsgefühle (z. B. „Mein Stress ist ein Signal“, „Atme tief durch!“, „Konzentriere dich auf die Gegenwart: Was habe ich konkret zu tun?“)
• Evaluation (z. B. „Es war nicht so schlecht, wie ich erwartet hatte.“, „Was kann ich daraus lernen?“)
Besonders effektiv scheinen Selbstinstruktionen zu sein, die auf Kompetenz und Kontrolle abzielen sowie solche, die dabei helfen, sich auf die Gegenwart zu konzentrieren und die Dinge so zu nehmen, wie sie sind.
Beispiele
Dinge nehmen wie sie sind:
„Es ist wie es ist. Was kann ich jetzt daraus machen?“
Kompetenz und Kontrolle:
„Ich bin gut vorbereitet.“ „Ich bin ein erfahrener Polizist.“ „Solange ich ruhig bleibe, behalte ich die Kontrolle.“
Konzentration auf die Gegenwart:
„Ein Schritt nach dem andern: Was ist jetzt als Nächstes zu tun.“
Einstellungsänderung – kognitive Umstrukturierung
Kognitives Stressmanagement setzt darüber hinaus auch an stressverschärfenden „Soll“-Werten und Einstellungen, den sog. persönlichen Stressverstärkern an: Damit gemeint sind grundlegende menschliche Bedürfnisse und Motive nach Zugehörigkeit und Liebe, nach Erfolg und Anerkennung, nach Sicherheit und Kontrolle oder nach Autonomie, die in einseitiger und absolutistischer Weise als Anspruch an sich selbst, an andere oder an die Welt überhaupt formuliert sind (z. B. „Alle Menschen sollen mich lieben.“; „Ich muss immer alles perfekt machen.“; „Ich muss immer alles selbst machen, damit es meinen Ansprüchen genügt.“ etc.). Ellis (199739) spricht von „Mussturbationen“, die als biografisch gewordene, generalisierte, irrationale Einstellungen die Wahrnehmung und Interpretation von konkreten Situationen prägen. Sie stellen gewissermaßen den Hintergrund dar, vor dem konkrete Anforderungssituationen als Bedrohung oder Schädigung zentraler Motive bewertet werden. Zum anderen zählen hierzu auch generalisierte Einstellungen der Hilflosigkeit („Ich bin ausgeliefert – habe keine Alternativen!“), eine geringe generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung („Ich kann nicht!“) und eine geringe Frustrationstoleranz („Ich halte das nicht aus!“). Diese prägen die Einschätzung der eigenen Bewältigungskompetenzen und der eigenen Belastbarkeit bzw. Widerstandskraft in konkreten Anforderungssituationen (sekundäre Bewertung sensu Lazarus).
Alle Stressmanagement-Ansätze, die in diesem Beitrag berücksichtigt werden, behandeln die Einstellungsänderung. Die meisten nutzen dabei das auf Ellis basierende Verfahren der Rational-emotiven-Therapie. Dabei gilt es, die persönlichen Einstellungen zu hinterfragen, irrationale (also überzogene, die Zielerreichung und die Befindlichkeit behindernde) Einstellungen zu erkennen und kritisch zu reflektieren.
Im nächsten Schritt geht es darum, diese unangemessenen, absolutistischen Einstellungen zugunsten funktionalerer Haltungen umzubewerten (vgl. z. B. Wagner-Link, S. 182 ff) und neue, angemessenere Einstellungen zu formulieren.
Tabelle 2
Typische Stressverstärker und mögliche „mentale Gegenmittel“ (Auszug aus Kaluza, 201140, S. 114)
| irrationale Einstellung | förderliche Gedanken |
| „Sei perfekt!“,„Ich darf keine Fehler machen!“ | Oft ist gut gut genug. |
| Aus Fehlern werde ich klug. | |
| Ich gebe mein Bestes und achte auf mich. | |
| „Sei beliebt!“,„Ich muss es allen recht machen.“ | Ich darf „nein“ sagen. |
| Nicht alle anderen müssen mich mögen. | |
| Kritik gehört dazu. | |
| „Sei stark!“,„Es ist schrecklich, auf andere angewiesen zu sein.“ | Ich gebe anderen die Chance, mich zu unterstützen. |
| Schwächen sind menschlich. | |
| Ich muss nicht alles selbst machen. | |
| „Sei vorsichtig!“,„Es ist entsetzlich, wenn etwas nicht so läuft, wie ich es geplant habe.“ | Ich akzeptiere, was ich nicht ändern kann. |
| Ich bleibe auch bei Ungewissheit gelassen. | |
| Ich muss nicht alles kontrollieren. | |
| „Ich kann nicht!“,„Ich kann den Druck einfach nicht aushalten.“ | Ich habe schon ähnliche Situationen gemeistert. |
| Ich vertraue auf mich. | |
| Alles geht auch wieder vorüber. |
Die neuen Einstellungen müssen verankert, das heißt sie müssen verinnerlicht werden und die irrationale Einstellung ersetzen. Dazu kommen beispielsweise Imaginationsübungen in Verbindung mit Entspannungstechniken sowie Rollenspiele, Praxisübungen, Wiederholungstechniken oder Merkhilfen zum Einsatz.
Auf gesundheitsrelevante Einstellungen geht auch die Resilienzforschung ein. Unter Resilienzfaktoren versteht man solche persönlichen Einstellungen und Eigenschaften, die dazu beitragen, dass ein Mensch trotz negativ belastenden Bedingungen gesund bleibt. Sie sind also Faktoren innerer Stärke und Widerstandkraft41. Resilienzfaktoren sind42:
• Akzeptanz für die eigene Person und die Realität („Es ist wie es ist!“ im Unterschied zum Hadern mit oder einem Verleugnen der Realität). Dabei meint Akzeptanz nicht ein resignierendes Hinnehmen dessen, was ist. Im Gegenteill: Oft ist das Annehmen einer Situation die Voraussetzug dafür, neue Handlungsoptionen zu entdecken.
• Realistischer Umgang mit Verantwortung: Übernahme der Verantwortung für das eigene Schicksal und die Problemlösung („Ich bin vielleicht nicht dafür verantwortlich, dass ich in diese Situation geraten bin, aber ich bin dafür verantwortlich, das Beste daraus zu machen“).
• Selbstreflektiert handeln: Sich selbst wahrnehmen und Einfluss auf die eigene Stimmung nehmen („Ich gehe achtsam mit mir um und weiß, wie ich meine Stimmung beeinflussen kann“).
• Handlungsorientierung: Die Lösung aktiv angehen („Ich nehme die Lösung in Angriff“).
• Optimismus: Bewusste Wahrnehmung positiver Erfahrungen sowie auch in schwierigen Situationen und Krisen noch eine positive Weltsicht einnehmen und sinnorientiert wahrnehmen („Ich suche auch in schwierigen Situationen nach positiven Aspekten“).
• Soziale Beziehungen pflegen („Ich pflege meine Freundschaften und sozialen Kontakte aktiv“).
• Zukunft gestalten: Lebensträume entwickeln und flexibel an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen („Ich habe Visionen – wenn ich merke, dass sie nicht zu verwirklichen sind, passe ich sie der Realität an“).
Resilienzfaktoren sind handlungs- und bewertungssteuernde Einstellungen, die, wie oben dargestellt, verinnerlicht und trainiert werden können.
Zukunftsvision – Ziele klären
Das Stressbewältigungsprogramm „Gelassen und sicher im Stress“ nach Kaluza widmet sich in diesem Zusammenhang in einem Zusatzmodul den persönlichen Zielen. Die Teilnehmer werden zu einer Reflexion und Klärung persönlicher Zielvorstellungen angeregt. Die Beschäftigung mit konkreten gegenwärtigen Belastungen im Alltag wird damit um eine Zukunftsperspektive erweitert. Die Klärung von eigenen Zielen kann helfen, eigene Prioritäten zu finden und im gegenwärtigen Alltag entsprechend zu handeln. Vor dem Hintergrund von definierten Zielen und einem positiven Zukunftskonzept können sich auch stressbezogene Bewertungen von alltäglichen Anforderungen so verändern, dass diese eher als Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel wahrgenommen werden können. Mit Zielen vor Augen erhöht sich die eigene Stresstoleranz und die Bereitschaft, sich mit unangenehmen, anstrengenden Situationen zu konfrontieren. Auch Personen, die ihren gegenwärtigen Alltag als wenig sinnvoll erleben, oder solche, die im Zusammenhang mit Verlustereignissen (Tod, Scheidung, Krankheit, Arbeitslosigkeit) Sinnverluste erlebt haben, können durch die Beschäftigung mit Zielen und Zukunft eine neue Sinnorientierung gewinnen. Ziele stellen, indem sie sinn- und identitätsstiftend wirken, selbst eine wichtige Ressource der Stressbewältigung dar.
Zur Herleitung der persönlichen Ziele werden zunächst Zukunftsvisionen – Wunschziele entwickelt. Kaluza (201143) arbeitet in seinem Stressmanagement-Programm mit Vorstellungsübungen: In entspanntem Zustand machen sich die Teilnehmer ein imaginäres Bild Ihrer Zukunft: „Wie sieht mein Leben in (beispielsweise) fünf Jahren aus, wenn alles so gelaufen ist, wie ich es mir vorstelle“. Dabei werden die Lebensbereiche Beruf, Familie, Person und Gemeinschaft betrachtet. Diese Visionen sind erstrebenswerte Zielzustände, wobei offengelassen wird, inwieweit diese durch eigenes Verhalten oder durch äußere Einflüsse oder Zufall erreicht werden können (Kaluza, 2011, S. 167). Aus diesen Visionen werden handlungswirksame Ziele entwickelt.
Handlungswirksame Ziele beziehen sich auf das persönliche Verhalten und Denken, welches erforderlich ist, um das Wunschziel zu erreichen: „Was will ich tun, damit ich dem Wunschziel näherkomme?“ Dabei geht es noch nicht um konkrete Handlungsplanung, sondern eher um ein positives Leitmotiv.
Handlungswirksame Ziele sollten (vgl. Storch & Krause44)
• zu 100 % der eigenen Kontrolle unterliegen (z. B. „Ich gehe offen auf andere zu.“ im Gegensatz zu „Ich habe einen großen Freundeskreis.“)
• als Annäherungsziel formuliert sein (z. B. „Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.“ im Gegensatz zu „Die Meinung anderer stört mich nicht mehr. “)
• mit positiven Gefühlen verbunden sein – für den Betroffenen persönlich attraktiv sein
Beispiele
Vision:
Ich bin beruflich erfolgreich. Meine letzte Beurteilung war sehr positiv. Ich gehe souverän mit schwierigen Situationen um. Meine Kollegen bewundern meine Gelassenheit.
Handlungsrelevantes Ziel:
Ruhig und gelassen gehe ich die Herausforderungen an.
Vision:
Sie sind körperlich fit und gesund. Ihre körperliche Attraktivität wird bewundert. Trotz Stresses sind Sie ausgeglichen, da Sie für entsprechenden Ausgleich sorgen.
Handlungsrelevantes Ziel:
„Ich nutze die Energie meines Körpers für Bewegung und genieße meine Ausgeglichenheit.“
In dem Gesundheitsförderungs-Programm GUSI (Olbrich & Storch45) steht die Verstetigung dieser handlungswirksamen Ziele im täglichen Leben im Vordergrund. Das heißt, die handlungswirksamen Ziele sollen bislang dominierende, Stress erzeugende Handlungsziele wie „Sei immer perfekt!“ oder „Sei immer und in jeder Situation stark!“ ersetzen und zum neuen Leitmotiv werden. Sie müssen entsprechend mental verankert und trainiert werden. Olbrich & Storch nutzen dazu
• Erinnerungshilfen wie Bilder, Farben, Motive, Kleidungsstücke, Rituale etc., die mit dem handlungsrelevanten Ziel assoziiert sind.
• Zieladäquate Körperverfassung: Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Psyche und Körper. Stress und negative Einstellungen führen zu einer entsprechenden Körperhaltung. Umgekehrt beeinflusst die Körperhaltung die Psyche. So werden Körperhaltungen trainiert, die zu dem handlungsrelevanten Ziel passen (z. B. aufrechte Haltung zur Stärkung des Ziels „Selbstbewusstes Auftreten“).
• Identifikation potenzieller Überlastungssituationen und Vorläufersignale, Nutzung von Stopp-Befehlen, die die Konzentration auf das handlungsrelevante Ziel ermöglichen.
• Soziale Ressourcen: Nutzung von persönlichen Netzwerken zur Unterstützung der Umsetzung der Ziele sowie als „Erinnerer“.
Aufbauend auf dem Handlungsziel können dann konkrete Verhaltensziele formuliert werden, deren Umsetzungswahrscheinlichkeit deutlich höher ist als ohne die Verankerung des persönlich attraktiven handlungsorientierten Ziels. Diese konkreten Verhaltensziele sollten entsprechend der Zielsetzungstheorie von Locke & Latham (z. B. 200246) herausfordernd und präzise formuliert sein. Im Managementbereich wird in diesem Zusammenhang häufig die S.M.A.R.T.-Regel postuliert (basierend auf Drucker 195647).
Danach sollten Verhaltensziele folgenden Kriterien genügen
• Spezifisch
• Messbar
• Attraktiv
• Realistisch
• Terminiert
Beispiele
Zur Umsetzung des handlungsrelevanten Ziels „Ruhig und gelassen gehe ich die Herausforderungen an.“ könnte ein konkreter Handlungsplan lauten:
„Bei der nächsten Verkehrskontrolle werde ich ruhig und konzentriert sein und tief durchatmen, bevor ich den Fahrer anspreche.“
Zur Umsetzung des handlungsrelevanten Ziels „Ich nutze die Energie meines Körpers und genieße meine Ausgeglichenheit.“ könnte ein konkreter Handlungsplan lauten:
„Zum Ausgleich für meinen Stress gehe ich montags, mittwochs und freitags nach der Arbeit 20 Minuten joggen.“
Gefühlsregulation – Emotionsarbeit
In der Polizeiarbeit kommt der Emotionsarbeit eine hohe Relevanz zu (vgl. Zapf et al., 200348, Lichtenthaler & Fischbach, 201049). Dabei geht es darum, dass es für die Arbeit erforderlich ist, eigene Gefühle nicht direkt sichtbar zu machen, sich neutral zu verhalten oder bewusst Gefühle zu zeigen, die in dem Moment zunächst nicht authentisch sind. Diese Diskrepanz wird als emotionale Dissonanz bezeichnet und ist ein wichtiger Stressor, der auf Dauer die Gesundheit beeinträchtigen kann (vgl. Hochschild, 199050).
Beispile
Obwohl Sie einem Zeugen gegenüber im Verlauf eines Verhörs sehr negative, aggressive Emotionen entwickelt haben, dürfen Sie dies gemäß Ihrer gewählten Verhörtaktik im Interesse des Vernehmungserfolgs nicht zeigen.
Beim Umgang mit emotionaler Dissonanz können zwei Wege gegangen werden: Surface Acting (Oberflächenhandeln: Man tut so, als ob man sich positiv oder neutral fühlen würde) oder Deep Acting (Tiefenhandeln: Man versucht, die gewünschte Emotion durch die Nutzung entsprechender kognitiver Strategien tatsächlich zu empfinden, s. o.). Studienergebnisse von Lichtenthaler & Fischbach belegen, dass Surface Acting hierbei die deutlich schlechtere Variante darstellt. Es zeigt sich, dass es bei häufigem Surface Acting vermehrt zu negativem Arbeitserleben, Burnout und psychosomatischen Beschwerden kommt. Surface Acting geht somit mit negativerem Arbeitserleben und geringerem Wohlbefinden bei der Arbeit einher.
Entsprechend sollte im Rahmen des Stressmanagement-Trainings erarbeitet werden, wie es gelingen kann, sich im Sinne des Deep Actings in die geforderte Emotion zu versetzen.
Mögliche Strategien werden mit den Teilnehmern vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrungen entwickelt. Relevante Strategien sind beispielsweise:
Empathie: Wenn es gelingt, die Beweggründe des Gegenübers zu verstehen, kommt es in der Regel nicht (oder weniger) zu negativen Emotionen wie Wut oder Aggression.
Entemotionalisieren: Durch rationale Betrachtung und Analyse der Situation können Emotionen reguliert werden.
Distanzieren: Durch die bewusste Reflexion „Das Gegenüber meint nicht mich, sondern die Situation an sich oder die Polizei als Institution“ kann es gelingen, Provokationen und Beleidigungen weniger persönlich zu nehmen.
Beispiele für Kognitionen, mit denen man sich in der oben geschilderten Verhörsituation emotional beeinflussen kann:
Beispiele
„Ich habe ihn in die Ecke gedrängt, deshalb versucht er, mich zu provozieren. Das würde ich an seiner Stelle vermutlich genauso machen.“ (Empathie, Versuch, die Beweggründe des Gegenübers zu verstehen)
„Er meint das nicht wirklich persönlich. Das ist genauso eine Taktik, wie ich eine anwende.“ (Entemotionalisieren, Situation rational bewerten)
Diese Strategien werden in Transferübungen (zunächst in Rollenspielen, dann im Arbeitsalltag) geübt.
2.3 Palliativ-regeneratives Stressmanagement
Palliativ-regeneratives Stressmanagement setzt an, wenn Belastungssituationen zu Beanspruchungs- und Stressreaktionen geführt haben. Ihr Ziel ist es, kurzfristig überschießende Aktivierung zu dämpfen und Handlungsfähigkeit sicherzustellen sowie langfristig für Ausgleich und Regeneration zu sorgen. Neben den bereits eingangs beschriebenen Entspannungstechniken geht es hier beispielsweise um regelmäßige Bewegung, um die Pflege des sozialen Netzwerkes sowie um angenehme Erlebnisse und das bewusste Genießen im Alltag.
Akutfallstrategien – „Methoden der kurzfristigen Erleichterung“
Kaluza (201151) schlägt als Strategie für akute Belastungssituationen die Quart-A-(4A-) Strategie vor. Sie ist besonders für solche Personen gedacht, die in ihrem beruflichen und/oder privaten Alltag häufiger in schlecht vorhersehbare Belastungssituationen geraten, die durch proaktive Bewältigungsbemühungen kaum kontrollierbar sind. Entsprechend handelt es sich um Strategien, die im Polizeialltag eine wichtige Rolle spielen können.
Für solche belastenden Situationen soll hier eine Strategie vermittelt werden, die zum Ziel hat, körperliche und seelische Erregung in diesen Situationen zu kontrollieren, Symptomstress zu vermeiden bzw. Stresstoleranz zu entwickeln sowie adäquates Handeln (falls erforderlich, möglich und gewollt) überhaupt zu ermöglichen. Die Quart-A- (4 x A) Strategie besteht aus vier Schritten:
Annehmen bedeutet, die Situation so zu akzeptieren wie sie ist. Das Annehmen der Situation beinhaltet zweierlei: Erstens das möglichst frühzeitige Wahrnehmen von Stresssignalen und zweitens eine klare und bewusste Entscheidung für das Annehmen (und damit gegen das Hadern mit der Realität). Dies entspricht dem Resilienzfaktor des Akzeptierens (s. unter Einstellungsänderung in Abschnitt 2.2).
Abkühlen bedeutet, überschießende körperliche und psychische Erregung in einer akuten Stresssituation zu regulieren. Wichtig ist hier auch wieder die bewusste Entscheidung für das Abkühlen (und damit gegen das Hineinsteigern in die Erregung). Das Abkühlen selbst kann dann durch gezielte, kurze Entspannungs-, Atem- oder Bewegungsübungen erreicht werden.
Analysieren bedeutet, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um zu einer bewussten und schnellen Einschätzung der Situation zu kommen.
Ablenkung oder Aktion: Je nach Ausgang der Kurz-Analyse geht es hier entweder um Ablenkung von der Situation (wenn keine aktive Bewältigung möglich oder sinnvoll ist) oder um gezielte Aktionen zur Änderung der Situation.
Beim Abkühlen und Ablenken setzen auch die „Methoden der kurzfristigen Erleichterung“ nach Wagner-Link (201052) an. Diese zielen auf
• das Kappen von Erregungsspitzen,
• das Unterbrechen der Eskalation bei der betroffenen Person und in der Interaktion sowie auf
• ein schnelleres Umschalten auf Erholung.
Als Maßnahmen, die entsprechend für Abkühlung und Ablenkung sorgen können, schlägt sie vor:
1) Wahrnehmungslenkung
2) Positive Selbstgespräche
3) Kontrollierte Abreaktion
4) Systematische Spontanentspannung
Ad 1) Die Wahrnehmung wird auf erregungsreduzierende, neutrale oder positive Gedanken oder Stimuli fokussiert. Beispiele für eine äußere Wahrnehmungslenkung sind die Beschäftigung mit anderen, angenehmeren Arbeiten – Kurzpausen, aus dem Fenster schauen, telefonieren etc. Innere Wahrnehmungslenkung richtet die Aufmerksamkeit weg von der Stress auslösenden Situation hin zu positiven Bildern oder Gedanken. Auf diese Weise soll körperliche und emotionale Erregung herunterreguliert werden, um wieder handlungsfähig zu werden bzw. zu bleiben.
Ad 2) Positive Selbstgespräche wurden unter dem Aspekt der Selbstinstruktion bereits thematisiert (siehe unter 2.2 Kognitives Stressmanagement).
Ad 3) Kontrollierte Abreaktion dient dazu, sich körperlich abzureagieren und somit das zu tun, wozu man physiologisch bei Stress programmiert ist. Es geht dabei nicht um ein Ausleben von Wut und Aggression am Gegenüber, sondern darum, sich gezielt und kontrolliert körperlich zu entlasten – quasi auszutoben. Abreaktion ist nur dann eine sinnvolle Stressbewältigungstechnik, „wenn sie jederzeit willkürlich erzeugt und abgestellt werden kann“ (Wagner-Link, S. 97). Ansonsten besteht die Gefahr negativer Auswirkungen auf Mitmenschen sowie des Verlusts an Selbstkontrolle.
Ad 4) Maßnahmen der Spontanentspannung beziehen sich auf Kurzformen von Entspannungstechniken, wie sie oben beschrieben wurden (siehe unter Abschnitt 1), die bei entsprechender Übung kurzfristig zur spontanen Beruhigung genutzt werden können. Auch das tiefe Durchatmen fällt hierunter. Dabei ist das richtige Atmen wichtig, da übermäßige Brustatmung und Betonung der Einatmung zu vermehrter Aktivierung und Hyperventilation und damit zu Schwindel führen können.
Beruhigende Atemtechniken sind dagegen:
• Tiefe Bauchatmung: Beim Einatmen sollte zunächst in den Bauch und erst dann in die Brust geatmet werden. Beim Ausatmen leert sich zunächst die Brust und dann der Bauch.
• Langsame Atmung
• Langsames Ausatmen: Das Ausatmen sollte etwas länger dauern als das Einatmen, da physiologisch gerade das Ausatmen der entspannende Vorgang ist. Man kann dazu beispielsweise langsam zählen: während des Einatmens „1, 2“, während des Ausatmens „3, 4, 5“.
• Verbunden atmen: zwischen Ein- und Ausatmung sollte keine Pause, kein Luftanhalten erfolgen. Das Einatmen geht direkt in das Ausatmen über.
Soziale Unterstützung – Netzwerkpflege
Positive soziale Beziehungen stellen eine zentrale Ressource des individuellen Stressmanagements dar (s. a. die Ausführungen zum Thema Einstellungsänderung/Resilienz in 2.2 „Kognitives Stressmanagement“).
Personen mit intakten sozialen Beziehungen in Familie, Freundeskreis und bei der Arbeit erkranken deutlich seltener psychisch oder physisch und leben länger als Personen ohne entsprechende soziale Unterstützung (vgl. z. B. Kaluza, 201153, Röhrle, 199454, von Holst & Scherer, 198855). Wagner-Link56 (S. 204) führt aus, dass sozialer Rückhalt, vertrauens- und respektvolle Zusammenarbeit und Umgang mit anderen sowie ein konstruktives angstfreies Arbeitsklima die tieferen Hirnregionen beruhigen. Belohnungsrelevante und angstmindernde Hirnstrukturen und Neurotransmitter wie Dopamin werden aktiviert.
Gerade in Stressphasen werden soziale Kontakte häufig vernachlässigt. Ein solches Verhalten beraubt die Personen einer wichtigen Ressource.
In Stressmanagement-Seminaren wird in der Regel mit Soziagrammen bzw. der grafischen Darstellung des persönlichen sozialen Netzes gearbeitet (siehe z. B. Wagner-Link, 201057, Reschke & Schröder, 200058, Kaluza, 201159). Ausgehend von der eigenen Person wird aufgezeichnet, welche Menschen zum relevanten sozialen Netz gehören. Besonders nahestehende Personen werden dicht an die eigene Person gezeichnet, entfernte Bekannte entsprechend in weiterer Entfernung. Dabei kann zwischen verschiedenen Personengruppen (z. B. Familie/Verwandte, Freunde, Arbeit/Kollegen etc.) unterschieden werden. Durch Linien verschiedener Stärke wird die Zufriedenheit mit der Beziehung symbolisiert (vgl. Abb. 2).
Abbildung 2
Basierend auf dieser Ist-Analyse wird erörtert, welche Kontakte man gerne verstärken möchte (Pfeile in Abb. 2) und wie dies erfolgen kann. Auch die Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen, werden im Gruppengespräch thematisiert. Hier kann beispielsweise mit der Methode des Brainstormings gearbeitet werden.
Auch Führungskräfte der Polizei empfehlen den kollegialen Austausch und die Vernetzung als wichtige Stressbewältigungsstrategie. Dabei betonen sie, dass man entsprechende Netzwerke selbst suchen und pflegen sollte, da von außen organisierte Kollegennetze nicht die notwendige Vertraulichkeit sichern können und zudem häufig Konkurrenzbeziehungen untereinander nicht auszuschließen sind. Wenn diese Netze aber der Besprechung von Problemen und Stress dienen sollen, werden direkte berufliche Konkurrenten oft nicht als passende Gesprächspartner empfunden. Auch private Netze sind wichtig, da sie zu Perspektivenwechseln anregen, Distanz und Ablenkung von beruflichen Problemen ermöglichen und Probleme ggf. relativieren.
Zufriedenheitserlebnisse – Genusstraining
Viele Menschen neigen dazu, unter Belastung Freizeitaktivitäten in Form von Hobbys, Sport und Spiel aufzugeben, soziale Kontakte einzuschränken und außerberufliche Interessen verkümmern zu lassen. Solange es sich um eine nur kurzfristige Belastung handelt, kann dies eine durchaus angemessene und erfolgversprechende Strategie darstellen. Bei länger andauernden Belastungen hingegen führt eine solche Selbsteinschränkung in einen fatalen Teufelskreis. Fehlende Erholungs- und Kompensationsmöglichkeiten führen auf die Dauer zu einer Abnahme der Widerstandskraft gegenüber Belastungen.
Ein Ziel von Stressbewältigungstrainings ist es daher auch, einen solchen Circulus Vitiosus dort, wo er besteht, zu unterbrechen und ein individuelles Repertoire palliativer und regenerativer Aktivitäten im Alltag zu verankern. Es geht darum, eine ganz persönliche regenerative „Gegenwelt“ (Eberspächer, 199860) zu entdecken, zu entwickeln und gegenüber den Anforderungen von Beruf und Alltag zu behaupten.
Die im Rahmen dieses Bausteines eingesetzten Methoden zielen neben der Information über grundlegende Erkenntnisse der Erholungsforschung (Allmer, 199661) zunächst in einem ersten Schritt darauf ab, einen neuen Zugang zu positiven Emotionen zu finden, frühere positive Erlebnisse wiederzubeleben und Lust auf neue Erfahrungen zu wecken. Hierzu werden erlebnisaktivierende Methoden eingesetzt.
Im Kleinen beginnt dies mit der Auseinandersetzung mit dem bewussten Genießen – das Wahrnehmen normaler angenehmer Erlebnisse im Alltag. Durch Reflexion dieser kleinen Alltagsfreuden werden Genussregeln entwickelt wie:
• Nimm dir Zeit zum Genießen
• Genieße bewusst
• Schule deine Sinne für Genuss
• Genieße auf deine eigene Art
• Planen schafft Vorfreude
Diese können geübt werden mit Hilfe von „Genusstagebüchern“ (Notieren der angenehmen Erlebnisse des Tages) oder „Glücksakten“ (Dokumentation glücklicher Momente bei der Arbeit). Hier können aber auch die Arbeitsverhältnisse beeinflusst werden, indem man sich im Arbeitsteam darum bemüht, z. B. in Besprechungen auch die positiven Erlebnisse und Erfolge zu würdigen.
Nachdem der Zugang zu positiven Emotionen gefunden wurde, geht man dann im zweiten Schritt von der Erlebnisebene auf die Verhaltensebene über. Hier geht es dann darum, konkrete, individuelle Aktivitäten (bzw. „Passivitäten“) verbindlich zu planen und umzusetzen (z. B. wieder einmal privat ein Fußballspiel oder mit dem Partner einen Tanzkurs zu besuchen). Dabei wird zunächst erarbeitet, was für jeden einzelnen eine angenehme Aktivität ist, sich dabei zu vergegenwärtigen, was das Angenehme daran ist – wie man sich fühlen wird, wenn man diese angenehme Aktivität gezeigt hat. Dieses angenehme Erlebnis wird dann möglichst konkret geplant und mit einem realistischen Zeitplan versehen.
Gesunde Lebensweise
Maßnahmen des regenerativen Stressmanagements dienen nicht nur dem Ausgleich körperlicher und seelischer Beanspruchungsfolgen, sondern wirken auch durch präventives Gesundheitsverhalten. Bewegung, gesunde Ernährung und erholsamer Schlaf sind Ressourcen die helfen, mit Belastungen besser umgehen zu können. Ungesunde Ernährung und unzureichender Schlaf stellen für den Körper zusätzliche Belastungen dar, die sich zum Alltagsstress addieren.
Bewegung
Stressbewältigung durch Sport und mehr Bewegung im Alltag setzt direkt an den physiologischen Stressreaktionen des Körpers an – nutzt die freigesetzten Energiepotenziale – und produziert zudem Endorphine, die als köpereigene „Glückshormone“ gelten. In dem Stressbewältigungsprogramm „Gelassen und sicher im Stress“ werden die Teilnehmer beispielsweise über die positiven Auswirkungen körperlicher Aktivität auf die körperliche und psychische Gesundheit informiert und es werden ihnen praktikable Wege zur Steigerung körperlicher Aktivität im Alltag aufgezeigt.
Besondere Bedeutung kommt dabei einerseits der Erhöhung der Bewegungsanteile im Alltag (z. B. Nutzung der Treppe gegenüber dem Aufzug) sowie andererseits der Förderung von (moderaten) Ausdauersportarten zu.
Polizeiarbeit ist zunächst ein bewegungsorientierter Beruf. Insbesondere im Zusammenhang mit der persönlichen Karriereentwicklung nehmen die Bewegungsanteile aber immer mehr ab, sodass körperliche Aktivität insbesondere bei Führungskräften wieder bewusst in den Alltag integriert werden muss.
Gesunde Ernährung
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) formuliert 10 Regeln für vollwertiges Essen und Trinken62:
• Vielseitig essen – Merkmale einer ausgewogenen Ernährung sind abwechslungsreiche Auswahl, geeignete Kombination und angemessene Menge nährstoffreicher und energiearmer Lebensmittel
• Reichlich Getreideprodukte und Kartoffeln mit möglichst fettarmen Zutaten
• Gemüse und Obst – Nimm „5 am Tag“ – möglichst frisch, nur kurz gegart
• Täglich Milch und Milchprodukte; ein- bis zweimal in der Woche Fisch; Fleisch, Wurstwaren sowie Eier in Maßen (maximal 300 - 600 g Fleisch pro Woche)
• Wenig Fett und fettreiche Lebensmittel (max. 60 - 80 g Fett pro Tag); pflanzliche Fette und Öle bevorzugen; auf versteckte Fette in Milchprodukten, Gebäck und Fertigprodukten achten
• Zucker und Salz in Maßen
• Reichlich Flüssigkeit (rund 1,5 l pro Tag); Wasser und andere energiearme Getränke bevorzugen; alkoholische Getränke nur selten und in kleinen Mengen konsumieren
• Schmackhaft und schonend zubereiten – bei niedriger Temperatur mit wenig Wasser und wenig Fett zubereiten
• Sich Zeit nehmen und genießen – nicht nebenbei essen
• Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben
Gesunder Schlaf
Schlaf ist wohl das wichtigste und effizienteste Regenerationsprogramm für Körper und Geist. Wer über lange Sicht ein Schlafdefizit aufbaut, gefährdet seine Gesundheit und Stresstoleranz, da bei zu wenig Schlaf das Stresshormon Cortisol die Übermacht gewinnt (Zulley, 200863). Die Folge ist ein Nachlassen der Abwehrkräfte. Wachstumshormone, die im Schlaf gebildet werden, fehlen. Das führt dazu, dass Körperzellen nicht mehr so schnell ersetzt werden. Nach Zulley verändert sich bei dauerhaftem Schlafmangel der Stoffwechsel, der Blutzuckerspiegel steigt, die Verdauung wird gestört und die Schilddrüse ist nicht voll funktionsfähig. Gleiche Symptome zeigt ein hoher Cortisolspiegel, der durch Stress bedingt ist (Schommer & Hellhammer, 200364). Die Effekte von Dauerstress und Schlafmangel addieren sich also.
Gerade bei Stress wird der Schlaf aber auch leicht beeinträchtigt. Bei dauerhaften, starken Belastungen kommt es häufig zu Ein- oder Durchschlafstörungen, die wiederum die Stresstoleranz verringern und negative Gedanken und Bewertungen wahrscheinlicher machen.
Kaluza (201165) nennt vor diesem Hintergrund 9 Regeln für einen gesunden Schlaf:
1 An regelmäßige Schlafens- und Aufstehzeiten halten
2 Körperliche Aktivität – allerdings nicht kurz vor dem Zubettgehen
3 Vermeidung koffeinhaltiger Getränke vor dem Schlafengehen – die wach machenden Abbauprodukte sind noch bis zu 14 Stunden nach dem Konsum im Körper nachweisbar
4 Nikotinkonsum einschränken wegen seiner aufputschenden Wirkung (min. 3 Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr rauchen)
5 Vermeidung von Alkohol vor dem Schlafengehen – Der Genuss von Alkohol hilft zunächst beim Einschlafen, führt aber zu häufigeren Schlafunterbrechungen und zu geringerer Erholung
6 Nicht hungrig, aber auch nicht mit Völlegefühl zu Bett gehen
7 Angenehme Schlafumgebung, die ausschließlich dem Schlaf gewidmet sein sollte (z. B. kein TV oder Arbeitsplatz im Schlafzimmer)
8 Entspannen vor dem Zubettgehen durch persönliche Einschlaf-Rituale (z. B. warmes Bad, leichte Lektüre, entspannende Musik, Entspannungsübungen)
9 Tipps beim Wachliegen:
• Erst schlafen gehen, wenn man müde ist
• Aufstehen, wenn man nicht schlafen kann
• Gedanken und Sorgen, die einem durch den Kopf gehen, aufschreiben
• Nicht außerhalb des Bettes schlafen
• Erst dann wieder ins Bett gehen, wenn man schläfrig ist
• Akzeptieren der Situation und die wache Zeit auf angenehme Art genießen
• Nicht auf die Uhr sehen
3. Ergänzende polizeispezifische Belastungsfaktoren als Thema der Stressbewältigung
Die Polizeiarbeit hat zwei ergänzende Spezifika, die besonders stressrelevant sind:
• Schichtarbeit – dauerhaft und zyklisch,
• potenziell traumatisierende Erlebnisse – als extremer, bedrohlicher Stressor
Bei beiden sind die Ursachen und Bedingungen nicht zu beeinflussen, aber die potenziell negativen Auswirkungen zu reduzieren.
Da auf den Umgang mit traumatisierenden Erlebnissen in dem Beitrag von Hallenberger in diesem Buch eingegangen wird, wird an dieser Stelle nur die Problematik der Schichtarbeit ausführlicher behandelt.
Schichtarbeit stellt in mehrfacher Hinsicht Anforderungen an das persönliche Stressmanagement. Zum einen kann das Arbeiten gegen die circadiane Rhythmik, verbunden mit den geforderten Umstellungen des Organismus zwischen Früh-, Spät- und Nachschicht als negativ belastend empfunden werden – stellt also einen Stressor dar (vgl. z. B. Rutenfranz & Knauth, 198266; Wirtz, 201067; Nollmann, 200968). Andererseits ist das Spektrum der Möglichkeiten für Ausgleich und Regeneration zu sorgen durch die zeitlichen Reglementierungen eingeschränkt – die Möglichkeit der Teilnahme an regelmäßigen Kursen oder an einem Vereinsleben ist eingeschränkt (Techniker Krankenkassen 200569).
Bei der Bearbeitung der Schichtproblematik geht es u. a. darum, die negativen Folgen des Arbeitens gegen die biologische Uhr möglichst gering zu halten. Hier werden beispielsweise Hilfen zum Umgang mit den wechselnden Schlafenszeiten (vgl. Zulley, 200870) und Verbesserung des Tagschlafs erarbeitet (z. B. Raumgestaltung zum Schutz vor Lärm, Licht und Wärme, Ernährungsverhalten bei Nachschicht) oder Ansätze des Umgangs mit Müdigkeit während der Arbeitszeit (Stichwort Sekundenschlaf) erläutert. Als wichtige Folge, die sich direkt auf die Ausgleichs- und Regenerations-Möglichkeiten auswirkt, wird vielfach von Betroffenen die Schwierigkeit der Teilhabe am sozialen Leben aufgrund der Schichtarbeit konstatiert (vgl. Hofmeister, 201071). Hier gilt es, Lösungen zu finden, wie soziale Kontakte und Beziehungen trotz der zeitlichen Einschränkungen gepflegt werden können. Themen dabei sind z. B. die Vereinbarung von Ruhezeiten mit Freunden oder der Familie, die Planung sozialer Aktivitäten, das Kontakthalten, die Transparenz des Schichtplans für Freunde oder die gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten mit der Familie.
Das Hadern mit der Tatsache des Schichtdienstes, einseitige Opferhaltungen und Hilflosigkeitseinstellungen erschweren nicht selten eine konstruktive Beschäftigung mit den Folgen der Schichtarbeit. Wichtige Aufgaben von Interventionen in diesem Bereich sind, solche dysfunktionalen Haltungen zu reflektieren und immer wieder eine Ressourcen- und Lösungsorientierung anzuregen („Es ist wie es ist! Was kann ich aus der Situation machen? Welche Chancen und Vorteile hat der Schichtdienst?“) (vgl. hierzu Techniker Krankenkassen 200572).
Es existieren keine evaluierten und publizierten Ansätze des Stressmanagements, welche sich explizit mit den Herausforderungen der Schichtarbeit auseinandersetzen. In der Praxis wird das Thema Schichtarbeit in unternehmensspezifischen Angeboten in allgemeine Stressmanagement-Ansätze integriert. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Gruppenansätze, bei denen mit einer Kombination aus Wissensvermittlung (z. B. zum Thema circadiane Rhythmik), Erfahrungsaustausch, Kleingruppen- und Einzelarbeit (z. B. Planung der Schlafzimmergestaltung) gearbeitet wird. Sinnvoll ist die Thematisierung des Umgangs mit Schichtarbeit zu einem möglichst frühen Zeitpunkt – beispielsweise während der Ausbildung. Bei berufserfahrenen Teilnehmergruppen stößt besonders der Erfahrungsaustausch auf positive Resonanz.
4. Inadäquate Mittel des Stressmanagements
Als nicht adäquate Mittel der Stressbewältigung sind beispielsweise Flucht, gedankliche Weiterbeschäftigung, Resignation und Selbstbeschuldigung zu nennen (vgl. Janke et al., 198573).
Bei Flucht versucht man sich der Situation zu entziehen. Diese Strategie bedeutet, dass man die Situation nicht unbedingt vermeidet, sie aber auch nicht bis zum Schluss durchsteht. Flucht kann in Einzelfällen sinnvoll sein. Als generelle Stressbewältigungsstrategie führt sie aber dazu, dass die Angst aufrechterhalten bleibt und das Selbstbewusstsein sinkt.
Mit der gedanklichen Weiterbeschäftigung ist ein ständiges Durchdenken der Vergangenheit gemeint. Man macht sich Vorwürfe oder stellt sich Fragen, auf die es keine Antwort gibt (Hätte ich doch! Warum nur? usw.). Es kommt zum Gedankenkarussell, was häufig mit Schlafstörungen verbunden ist. Mit der gedanklichen Weiterbeschäftigung ist an dieser Stelle nicht die zielgerichtete Auswertung der Situation im Sinne von: „Was könnte ich daraus lernen?“gemeint. Eine solche lösungsorientierte Auswertung wäre durchaus sinnvoll.
Resignation ist abzugrenzen von Akzeptieren (s. o.). Resignieren meint eher sich hängen lassen und jammern. Dies ist eine depressionsfördernde und passive Strategie. Das Ohnmachtsgefühl steigt und man fühlt sich noch schlechter.
Mit Selbstbeschuldigung ist nicht die realistische Fehlersuche gemeint. Bei der Selbstbeschuldigung wird ein unrealistisch hoher perfektionistischer Anspruch an sich gestellt, oder es wird die Verantwortung für Dinge übernommen, die von außen verursacht wurden. Sie wirkt sich negativ auf das Selbstbewusstsein und das Wohlempfinden aus.
Bei hohen Belastungen kommen häufig auch Alkohol, Aufputschmittel und Drogen sowie andere Suchtverhaltensweisen (Nikotin, Arbeitssucht, Sportsucht) zum Einsatz. Diese sind aber ebenfalls als nicht zielführend zu betrachten, da sie den Körper zusätzlich belasten und nur zeitlich sehr begrenzt und nur subjektiv entlastend wirken.
5. Zusammenfassung und Bewertung der Ansätze der Stressbewältigung
Tabelle 3 zeigt eine Übersicht der dargestellten Maßnahmen und stellt sie den Ansatzpunkten nach dem transaktionalen Stressmodell nach Lazarus gegenüber.
Tabelle 3
Die Wirksamkeit aller in den Abschnitten 1 und 2 dargestellten Ansätze konnte wissenschaftlich nachgewiesen werden. Relevant ist dabei, dass ein möglichst breites Spektrum an Bewältigungsstrategien am erfolgversprechendsten ist. Eine Person, die perfekt in einer Entspannungstechnik trainiert, aber nicht in der Lage ist, Probleme zu lösen oder Gedanken stressrelativierend zu steuern, wird immer nur kurativ tätig sein können. Eine andere Person, die über perfekte Problemlösestrategien verfügt, kann ausbrennen, wenn sie sich durch übertriebenen Ehrgeiz unter Druck setzt und nicht für Ausgleich und Regeneration sorgen kann.
Entsprechend ist ein möglichst breites Repertoire an Bewältigungsstrategien anzuzielen, die sowohl kurz- als auch langfristig ansetzen sollten. Wichtig ist dabei, dass viele Bewältigungsstrategien gelernt und/oder trainiert werden müssen, um in einem konkreten Belastungsfall greifen zu können. Entsprechend kommt der Prävention besondere Bedeutung zu. Das heißt: Stressbewältigungsstrategien sollten erlernt werden, wenn der Stress noch nicht überhand genommen hat. Somit ist die Auseinandersetzung mit Stressmanagement auch kein Zeichen von Schwäche oder Überforderung, sondern von vorausschauendem, rationalem und verantwortungsbewusstem Handeln.
Stressmanagement wirkt dabei in hohem Maße individuell. Maßnahmen der Prävention müssen zum Anwender passen, er muss deren Wichtigkeit einsehen und sie als erfolgversprechend beurteilen. Es hat keinen
Sinn, jemanden zu einer Entspannungstechnik zu drängen, der darin keinen Nutzen erkennen kann, oder jemanden mit Maßnahmen der Identitätsentwicklung zu konfrontieren, der diese für unnütze „Psychospielchen“ hält – das würde nur Widerstand erzeugen. Es muss nicht jeder jede Technik des Stressmanagements nutzen, der eigene Weg zählt. Offenheit und vielleicht auch Mut zum Ausprobieren, um zu prüfen, was individuell passend sein könnte, ist aber sicherlich ein sinnvoller Weg, um das persönliche Management-Repertoire zu erweitern.
Abschließend muss festgehalten werden: Der Begriff Stressmanagement legt nahe, dass Stress immer und in jeder Situation zu beeinflussen und zu steuern ist, woraus sich individuell die Überlegung ergeben könnte „Wenn ich meinen Stress nicht im Griff habe, habe ich versagt!“. Das ist sicherlich ein Fehlschluss. Auch für Personen mit sehr guten Stressmanagement-Kompetenzen gibt es Situationen, denen sie nicht gewachsen sind oder die sie stark belasten und aufwühlen. Individuelles Stressmanagement als Verhaltensprävention kann viel bewirken – aber nicht alles. Es sollte sinnvollerweise durch Maßnahmen der Verhältnisprävention ergänzt werden.
6. Literatur
Allmer, H. (1996). Erholung und Gesundheit. Grundlagen, Ergebnisse und Maßnahmen. Göttingen: Hogrefe.
Brengelmann, J. C. (1988). Stressbewältigungstraining 1: Entwicklung. Frankfurt: Peter Lang.
Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2011). Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE. Poster. Bonn: DGE.
Drucker, P. F. (1956). Praxis des Managements. Düsseldorf, Wien: Econ.
Eberspächer, H. (1998). Ressource Ich. Der ökonomische Umgang mit Stress. München: Hanser.
Ellis, A. (1997): Grundlagen und Methoden der Rational-emotiven Verhaltenstherapie. München: Pfeiffer.
GKV-Spitzenverband (2010). Leitfaden Prävention. Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von §§ 20 und 20a SGB V vom 21. Juni 2000 in der Fassung vom 27. August 2010. Berlin: GKV.
Goldfried, M. R. & Goldfried, A. P. (1976). Kognitive Methoden der Verhaltensänderung. In: F. H. Kanfer & A. P. Goldstein (Eds.), Möglichkeiten der Verhaltensänderung, 62-83. München: Urban & Schwarzenberg.
Grawe, K., Dziewas, H. & Wedel, S. (1980). Interaktionelle Problemlösungsgruppen – ein verhaltenstherapeutisches Gruppenkonzept. In: K. Grawe (Hrsg.), Verhaltenstherapie in Gruppen, 266-306. München: Urban & Schwarzenberg.
Hochschild, A. R. (1990). Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der Gefühle. Frankfurt/M.: Campus.
Hofmeister, M. (2010). Der Vergleich vom Dreischichtdienst gegenüber dem Einsatz im Zweischichtdienst mit Dauernachtwachen unter sozialen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. München: Grin.
Holst, D. von & Scherer, K. R. (1988). Stress. In: K. Immelmann, K. R. Scherer, C. Vogel & P. Schmoock (Hrsg.), Grundlagen des Verhaltens. 289-327. Jena: Gustav Fischer.
Janke, W., Erdmann, G. & Kallus, W. (1985). Der Stressverarbeitungsfragebogen (SVF). Handanweisung. Göttingen: Hogrefe.
Kaluza, G. (2007). Gelassen und sicher im Stress. Das Stresskompetenz-Buch. Stress erkennen, verstehen, bewältigen. Heidelberg: Springer.
Kaluza, G. (2011). Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer.
Kaluza, G. & Renneberg, B. (2009). Stressbewältigung. In: J. Bengel & M. Jerusalem (Hrsg.), Handbuch der Medizinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie, 265-272 Göttingen: Hogrefe.
Kämmerer, A. (1983). Die therapeutische Strategie „Problemlösen“. Theoretische und empirische Perspektiven ihrer Anwendung in der kognitiven Psychotherapie. Münster: Aschendorff.
Krauthan, G. (2004). Psychologisches Grundwissen für die Polizei. Ein Lehrbuch. 4. vollständig überarbeitete Auflage, 168-183. Weinheim, Basel: Beltz.
Lichtenthaler, P. W. & Fischbach, A. (2010). Belastungsfaktor oder Ressource? Fluch und Segen von Emotionsarbeit. In: præview – Zeitschrift für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention, 03/2010, 8-9.
Litzke, S. & Schuh, H. (2010). Stress, Mobbing, Burn-out am Arbeitsplatz. Berlin, Heidelberg: Springer.
Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. In: American Psychologist, 57(9), 705-717.
Meichenbaum, D. (2003). Intervention bei Stress. Anwendung und Wirkung des Stress impfungstrainings. 2. revidierte und ergänzte Auflage. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber.
Nollmann, A. (2009). Stress bei Schichtarbeit. München: Grin.
Olejniczak, C. (2011). Resilienz. Von den Stehauf-Menschen lernen. Fachvortrag bei der A+A 2011 am 21.10.2011 in Düsseldorf.
Reschke, K. & Schröder, H. (2010). Optimistisch den Stress meistern. Ein Programm für Gesundheitsförderung, Therapie und Rehabilitation. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: dgvt.
Röhrle, B. (1994). Soziale Netze und soziale Unterstützung. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.
Rutenfranz, J. & Knauth, P. (1982). Schichtarbeit und Nachtarbeit. Probleme, Formen, Empfehlungen. München: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung.
Schelp, T., Maluck, D., Gravemeier, R. & Meusling, U. (1997). Rational-Emotive Therapie als Gruppentraining gegen Stress. Seminarkonzepte und Materialien. Bern, Stuttgart, Toronto: Hans Huber.
Schommer, N. & Hellhammer, D. (2003). Psychobiologische Beiträge zum Verständnis stressbezogener Erkrankungen. In: H. Reinecker (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Modelle psychischer Störungen. 62-72. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
Seiwert, L. J. (2005). Wenn du es eilig hast, gehe langsam: Mehr Zeit in einer beschleunigten Welt. Frankfurt: Campus.
Siegrist, U. & Luitjens, M. (2011). Resilienz. Offenbach: Gabal.
Storch, M. & Krause, F. (2010). Selbstmanagement – ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Huber.
Storch, M. & Olbrich, D. (2011). Das GUSI-Programm als Beispiel für Gesundheitspädagogik in Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. In: W. Knörzer & R. Rupp (Hrsg.), Gesundheit ist nicht alles – was ist sie dann? Hohengehren: Schneider.
Techniker Krankenkasse (2005). Gesund bleiben mit Schichtarbeit. Informationen für Mitarbeiter und Führungskräfte. Hamburg: Techniker Krankenkasse.
Vaitl, D. & Petermann, F. (Hrsg.) (1993). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd1: Grundlagen und Methoden. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
Wagner-Link, A. (2010). Verhaltenstraining zur Stressbewältigung. Arbeitsbuch für Therapeuten und Trainer. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
Wiegard, U., Tauscher, N., Inhester, M.-L., Puls, W. & Wienold, H. (2000). „Gelassen bei der Arbeit“. Ein Trainingskurs zur Bewältigung von Stress am Arbeitsplatz. Modifizierte Version des Programms von Karin Siegrist & Thea Silberhorn „Stressabbau in Organisationen – Ein Manual zum Stressabbau. Münster: Institut für Soziologie.
Wirtz, A. (2010). Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten. Dortmund, Berlin, Dresden: BauA.
Zapf, D., Isic, A., Fischbach, A. & Dormann, Ch. (2003). Emotionsarbeit in Dienstleistungsberufen. Das Konzept und seine Implikationen für die Personal- und Organisationsentwicklung. In: K.-C. Hamborg & H. Holling (Hrsg.), Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, 266-288. Göttingen: Hogrefe.
Zulley, J. (2008). So schlafen Sie gut. München: Zabert Sandmann.
1 Kaluza, G. & Renneberg, B. (2009). Stressbewältigung. In: J. Bengel & M. Jerusalem (Hrsg.), Handbuch der Medizinischen Psychologie und Gesundheitspsychologie, 265-272 Göttingen: Hogrefe.
2 GKV-Spitzenverband (2010). Leitfaden Prävention.
3 Wagner-Link, A. (2010). Verhaltenstraining zur Stressbewältigung. Arbeitsbuch für Therapeuten und Trainer. Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
4 a. a. O.
5 Vaitl, D. & Petermann, F. (Hrsg.)(1993). Handbuch der Entspannungsverfahren. Bd1: Grundlagen und Methoden. Weinheim: Psychologie Verlags Union.
6 Meichenbaum, D. (2003). Intervention bei Stress. Anwendung und Wirkung des Stressimpfungstrainings. 2. revidierte und ergänzte Auflage. Bern, Göttingen, Toronto, Seattle: Hans Huber.
7 z.B. kostenfreie mp3-Downloads oder CD zu Progressiver Muskelentspannung, Atementspannung oder Tiefenentspannung einiger Krankenkassen sowie käufliche Anleitungen wie beispielsweise Hölker, R.M. (2007). Wege in die Entspannung + Gesunder Schlaf. Audio-CD – Atementspannung, Muskelentspannung, Visualisierung. Köln: Kölner Institut für Stressminderung. Mayer, K.C. (2006). Entspannungstraining nach Jacobson – Progressive Muskelentspannung mit Entspannungsmusik. Sindelfingen: Media Sound Art.
8 zahlreiche Filmbeiträge bei YouTube sowie käufliche Beiträge wie z.B. aus der Reihe Wellness-DVD: Autogenes Training – Langfristig den Stress bewältigen. Atementspannung – Stress-Abbau mit meditativer Atmung Qi Gong – Einfaches Entspannen durch sanften Energiefluss
9 Beispielsweise von Bielsoft: Autogenes Training 7 Wochen Kurs oder Progressive Muskelentspannung Kurs von Buenavista Studio s.l.: Yoga2go
10 Sonnentag, S. (2001). Work, recovery avtivities, and individual well-being: A diary study. Journal of Occupational Health Psychology, 6, 196-210.
11 Dorsch, F. (1992). Psychologisches Wörterbuch. Bern: Hans Huber. S. 176.
12 Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw Hill.
13 Lazarus, R. S. & Launier, R. (1981). Stressbezogene Transaktionen zwischen Personen und Umwelt. In: J. R. Nitsch (Hrsg.), Stress, Theorien, Untersuchungen und Maßnahmen, 213-259. Bern: Huber.
14 Kaluza, G. (2011). Stressbewältigung. Trainingsmanual zur psychologischen Gesundheitsförderung. 2. vollständig überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer.
15 Z. B. Wagner-Link a. a. O. oder Litzke, S. & Schuh, H. (2010). Stress, Mobbing, Burn-out am Arbeitsplatz. Berlin, Heidelberg: Springer.
16 a. a. O.
17 a. a. O.
18 Schelp, T., Maluck, D., Gravemeier, R. & Meusling, U. (1997). Rational-Emotive Therapie als Gruppentraining gegen Stress. Seminarkonzepte und Materialien. Bern, Stuttgart, Toronto: Hans Huber.
19 Kaluza, G. (2007). Gelassen und sicher im Stress. Das Stresskompetenz-Buch. Stress erkennen, verstehen, bewältigen. Heidelberg: Springer. Kaluza, G. (2011). a. a. O.
20 a. a. O.
21 Brengelmann, J. C. (1988). Stressbewältigungstraining 1: Entwicklung. Frankfurt: Peter Lang.
22 Krauthan, G. (2004). Psychologisches Grundwissen für die Polizei. Ein Lehrbuch. 4. vollständig überarbeitete Auflage, 168-183. Weinheim, Basel: Beltz.
23 a. a. O.
24 a. a. O.
25 Wiegard, U., Tauscher, N., Inhester, M.-L., Puls, W. & Wienold, H. (2000). „Gelassen bei der Arbeit“. Ein Trainingskurs zur Bewältigung von Stress am Arbeitsplatz. Modifizierte Version des Programms von Karin Siegrist & Thea Silberhorn „Stressabbau in Organisationen – Ein Manual zum Stressabbau. Münster: Institut für Soziologie.
26 Reschke, K. & Schröder, H. (2010). Optimistisch den Stress meistern. Ein Programm für Gesundheitsförderung, Therapie und Rehabilitation. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Tübingen: dgvt.
27 Storch, Maja & Olbrich, Dieter (2011). Das GUSI-Programm als Beispiel für Gesundheitspädagogik in Präventionsleistungen der Deutschen Rentenversicherung. In: W. Knörzer & R. Rupp (Hrsg.), Gesundheit ist nicht alles – was ist sie dann? Hohengehren: Schneider.
28 Storch, M. & Krause, F. (2010). Selbstmanagement – ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bern: Huber.
29 a. a. O.
30 Goldfried, M. R. & Goldfried, A. P. (1976). Kognitive Methoden der Verhaltensänderung. In: F. H. Kanfer & A. P. Goldstein (Eds.), Möglichkeiten der Verhaltensänderung, 62-83. München: Urban & Schwarzenberg
31 a. a. O.
32 Grawe, K., Dziewas, H. & Wedel, S. (1980). Interaktionelle Problemlösungsgruppen – ein verhaltenstherapeutisches Gruppenkonzept. In: K. Grawe (Hrsg.), Verhaltenstherapie in Gruppen, 266-306. München: Urban & Schwarzenberg.
33 Kämmerer, A. (1983). Die therapeutische Strategie „Problemlösen“. Theoretische und empirische Perspektiven ihrer Anwendung in der kognitiven Psychotherapie. Münster: Aschendorff.
34 a. a. O.
35 a. a. O.
36 Seiwert, L. J. (2005). Wenn du es eilig hast, gehe langsam: Mehr Zeit in einer beschleunigten Welt. Frankfurt: Campus.
37 a. a. O.
38 a. a. O.
39 Ellis, A. (1997): Grundlagen und Methoden der Rational-emotiven Verhaltenstherapie. München: Pfeiffer.
40 a. a. O.
41 vgl. z. B. Siegrist, U. & Luitjens, M. (2011). Resilienz. Offenbach: Gabal.
42 Olejniczak, C. (2011). Resilienz. Von den Stehauf-Menschen lernen. Fachvortrag bei der A+A 2011 am 21.10.2011 in Düsseldorf.
43 a. a. O.
44 a. a. O.
45 a. a. O.
46 Locke, E. A. & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. In: American Psychologist, 57(9), 705-717.
47 Drucker, P. F. (1956). Praxis des Management. Düsseldorf, Wien: Econ.
48 Zapf, D., Isic, A., Fischbach, A. & Dormann, Ch. (2003). Emotionsarbeit in Dienstleistungsberufen. Das Konzept und seine Implikationen für die Personal- und Organisationsentwicklung. In: K-Ch. Hamborg & H. Holling (Hrsg.), Innovative Personal- und Organisationsentwicklung, 266-288. Göttingen: Hogrefe.
49 Lichtenthaler, P. W. & Fischbach, A. (2010). Belastungsfaktor oder Ressource? Fluch und Segen von Emotionsarbeit. In: præview – Zeitschrift für innovative Arbeitsgestaltung und Prävention, 03/2010, 8-9.
50 Hochschild, A. R. (1990). Das gekaufte Herz. Zur Kommerzialisierung der Gefühle. Frankfurt/M.: Campus.
51 a. a. O.
52 a. a. O.
53 a. a. O.
54 Röhrle, B. (1994). Soziale Netze und soziale Unterstützung. Weinheim: Psychologie-Verlags-Union.
55 Holst, D. von & Scherer, K. R. (1988). Stress. In: K. Immelmann, K. R. Scherer, C. Vogel & P. Schmoock (Hrsg.), Grundlagen des Verhaltens. 289-327. Jena: Gustav Fischer.
56 a. a. O.
57 a. a. O.
58 a. a. O.
59 a. a. O.
60 Eberspächer, H. (1998). Ressource Ich. Der ökonomische Umgang mit Stress. München: Hanser.
61 Allmer, H. (1996). Erholung und Gesundheit. Grundlagen, Ergebnisse und Maßnahmen. Göttingen: Hogrefe.
62 Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2011). Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE. Poster. Bonn: DGE.
63 Zulley, J. (2008). So schlafen Sie gut. München: Zabert Sandmann.
64 Schommer, N. & Hellhammer, D. (2003). Psychobiologische Beiträge zum Verständnis stressbezogener Erkrankungen. In: H. Reinecker (Hrsg.), Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie. Modelle psychischer Störungen. 62-72. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
65 a. a. O.
66 Rutenfranz, J. & Knauth, P. (1982). Schichtarbeit und Nachtarbeit. Probleme, Formen, Empfehlungen. München: Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung.
67 Wirtz, A. (2010). Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten. Dortmund, Berlin, Dresden: BauA.
68 Nollmann, A. (2009). Stress bei Schichtarbeit. München: Grin.
69 Techniker Krankenkasse (2005). Gesund bleiben mit Schichtarbeit. Informationen für Mitarbeiter und Führungskräfte. Hamburg: Techniker Krankenkasse.
70 a. a. O.
71 Hofmeister, M. (2010). Der Vergleich vom Dreischichtdienst gegenüber dem Einsatz im Zweischichtdienst mit Dauernachtwachen unter sozialen und betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. München: Grin.
72 a. a. O.
73 Janke, W., Erdmann, G. & Kallus, W. (1985). Der Streßverarbeitungsfragebogen (SVF). Handanweisung. Göttingen: Hogrefe.