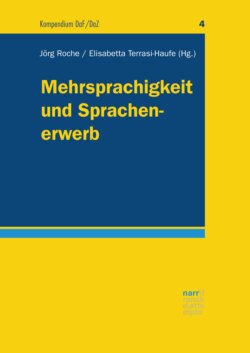Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 44
2.2.3 Zur Problematik der Referenzfunktion der L1 und des BICS und CALP-Ansatzes
ОглавлениеDie Festlegung auf die Referenzfunktion der L1, der Bezug auf das strukturelle Verhältnis der beteiligten Sprachen, die globale Zuordnung von Schwellen und die bipolare Festlegung von bildungs- und umgangssprachlichen Kompetenzniveaus sind trotz ihrer weiten Verbreitung in einer Reihe von Aspekten problematisch. Der Übergang von Schwelle zu Schwelle oder in einen anderen Modus erfolgt nicht abrupt, sondern ist sowohl intra- als auch intermodal (mündlich, schriftlich) fließend. Der Einfluss sprachlicher Struktursysteme auf den Erwerb sprachlicher Kompetenzen ist – wie bereits dargestellt – umstritten. Die Modellierung von Mehrsprachigkeitsmodellen an den Struktureigenschaften von Sprachen festzumachen, wie beispielsweise im foreign language acquisition model, behandelt nur Teilaspekte des Sprachenerwerbs und des Managements von Mehrsprachigkeit. Die Annahme einer reinen Mutter- oder Herkunftssprache der Lerner, die gänzlich anders ist als die Zielsprache, berücksichtigt vor allem bei Kindern der zweiten, dritten und späteren Migrantengeneration nicht die Mischungsprozesse der Sprachen. Für Kinder aus Migrantenfamilien ist die Sprache der Eltern oft nicht ihre eigene Muttersprache, sondern bestenfalls Familiensprache. Deshalb sind Ansätze fehlleitend, die unkritisch und pauschal auf die Muttersprache der Migrantenkinder aufbauen. Diese Einschränkung gilt in verstärktem Maße für Familien, in denen die Eltern unterschiedliche Erstsprachen beherrschen (vergleiche hierzu auch Brizić 2009, 2008). Die Identifikation der Kinder und Jugendlichen mit den Sprachen der Eltern steht in einem wechselseitigen Verhältnis zum Sozialprestige der Sprachen in der Umgebungsgesellschaft. Das Prestige der Sprachen hat Auswirkungen auf die Selbsteinschätzung sprachlicher Kompetenzen und beeinflusst Sprachenerwerb und Sprachenerhalt sowie Identitätsbildung. Kinder mit der Familiensprache Türkisch verweigern zum Beispiel in deutschsprachiger Umgebung oft den Gebrauch des Türkischen und scheuen sich auch davor, anzugeben, dass sie die Sprache kennen und wie gut sie sie können (vergleiche Brizić 2009). Von besonderer Relevanz im cognitive academic language proficiency-Ansatz sind die in der Regel schwach ausgeprägten schriftsprachlichen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Die von Cummins (1981, 1982, 1991) vorgenommene Globalkategorisierung als cognitive academic language proficiency verlangt hier eine weitere Differenzierung in die unterschiedlichen funktionalen Bereiche der Schriftlichkeit (Bildungssprache, Arbeits- und Berufssprache, Alltagssprache). Das heißt, bei der Diagnose des Kompetenzproblems werden im cognitive academic language proficiency-Ansatz Aspekte der institutionellen Verwendung von Sprachen in Bildung, Beruf und öffentlicher Verwaltung zu wenig berücksichtig, und zwar in der Zielsprache, aber meist noch stärker in den Familiensprachen. Schriftlichkeit und Mündlichkeit bezeichnen nicht ein bi-polares Kontinuum sprachlicher Kompetenzen. Vielmehr sind sie je nach Textgattung unterschiedlich ausgeprägt und es gibt, zumal in einer zunehmend von Medien beeinflussten Zeit, eine Fülle von Misch- und Übergangsformen. Auch Bildungssprache ist kein monolithischer Komplex (siehe hierzu auch die Ausführungen zu den Milieustudien in Lerneinheit 2.3). Die Gleichsetzung kognitiver Kompetenzen mit Bildungssprache und ihre Kontrastierung mit alltagssprachlichen Kompetenzen suggeriert eine klare Trennung konträrer Modi. Der Begriff Kognition wird dabei in restriktiver Weise auf elaboriertes und systematisches Lernen bezogen, das zudem eine gewisse Affinität zur Schriftsprache ausdrückt. Gleichzeitig verschwimmen im Begriff academic die Grenzen zwischen bildungs- und wissenschaftssprachlichen Normen. Mit den in Folge der cognitive academic language proficiency und basic interpersonal communicative skills-Kategorisierung vorgenommenen Modifikationen (Cummins 1991) wurde versucht, diese Beschränkungen durch eine Kombination von conversational and academic language proficiency aufzulösen, aber dieser Kompromiss ändert nichts Grundsätzliches an den unklaren Definitionen von Kognition und Sprachkompetenz in den genannten Modellen.
Verschiedene Untersuchungen an Schulen mit bilingualen Zweigen, die auf der Grundlage der Schwellen- und Interdependenzhypothese durchgeführt wurden, belegen, dass mehrsprachige Schülerinnen und Schüler oft bessere Leistungen in Fächern erbringen, in denen Sprache vermittelt wird. Bemerkenswerterweise erzielen diese Schülerinnen und Schüler oft aber auch in anderen Fächern besonders gute Ergebnisse. Es wird vermutet, dass die gut ausgeprägte Sprachenbewusstheit der mehrsprachigen Schülerinnen und Schüler Transfereffekte auf die allgemeine kognitive Entwicklung bewirkt. In einer longitudinalen Vergleichsstudie zur Überprüfung der Interdependenzhypothese untersuchten zum Beispiel Bournot-Trites und Reeder (2001) die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit der L1 Englisch von der 4. bis zur 7.Klasse in einer bilingualen Schule in Kanada, und zwar in Bezug auf sprachliche Kompetenzen in Englisch (L1) und Französisch (L2) und in Bezug auf ihre Leistungen in Mathematik. Die Aufteilung der Gruppen erfolgte nach dem Anteil des Französischunterrichts: Eine der Gruppen erhielt 50 % des Unterrichts in der Zweitsprache Französisch, die andere 80 %. Auch der Mathematikunterricht der zweiten Gruppe erfolgte auf Französisch. Die Rahmenbedingungen der beiden Gruppen wurden ansonsten soweit wie möglich identisch gehalten. So hatten beide Klassen bis auf wenige Ausnahmen die gleichen Lehrer und wurden nach den gleichen Lehrplänen unterrichtet. Es zeigte sich, dass die Lerner beider Gruppen im Englischunterricht die kanadischen Standards von gleichaltrigen monolingualen Schülern übertrafen, zum Beispiel in Leseverstehenstests. Beachtlich sind aber auch die Ergebnisse der Mathematiktests, die in den beiden letzten Schuljahren der Untersuchung auf Englisch durchgeführt wurden. In allen getesteten mathematischen Bereichen des Stanford Diagnostic Mathematics Test schnitten die Schüler der 80 %-Französischgruppe deutlich besser ab, als die Schüler, die den Mathematikunterricht auf Englisch hatten. Das zeigt nicht nur, dass das in einer Sprache erworbene Wissen bei einem entsprechend gut entwickelten Sprachstand in andere Sprachen übertragen werden kann, sondern auch, dass die vertiefte Zweitsprachenkompetenz mit anderen Fertigkeiten (zum Beispiel abstrakten mathematischen Fertigkeiten oder Leseverstehen) positiv korreliert. Da die Gruppen aus dem gleichen sozialen Umfeld stammten und die Unterrichtsbedingungen weitgehend identisch waren, liegt es nahe, der unterschiedlichen Intensität der Vermittlung der Zweitsprache die Hauptverantwortung für die Ausprägung der besseren Ergebnisse in den Sprachtests und bei den Transferleistungen in die Mathematik zuzuschreiben.
Experiment
Führen Sie eine Umfrage durch. Fragen Sie die ersten 15 Personen, die Ihnen heute über den Weg laufen nach den Sprachen, die sie beherrschen, wie sie sie gelernt haben (Familie, Alltag, Schule, Sprachkurs, …), dem Niveau auf dem sie sie schriftlich und mündlich beherrschen (nach dem GER) und erkundigen Sie sich nach ihrem Bildungsabschluss. Lassen Sie die erhobenen Daten korrelieren. Sind Mehrsprachige gebildeter beziehungsweise verfügen sie über höhere kognitive Fähigkeiten?
Eine Kausalität kann dadurch bisher jedoch nicht nachgewiesen werden. Das Forschungsspektrum zu Aspekten der Mehrsprachigkeit ist damit nicht erschöpft. So beschäftigt sich eine Reihe weiterer Studien zum Beispiel mit soziobiographischen und sozialen Bedingungsfaktoren gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit, zu denen Kriterien wie Status, Prestige und gesellschaftlicher Wert der Mehrsprachigkeit (siehe die Auflistung zur Problematik der Referenzfunktion der L1 oben), Freiwilligkeit beziehungsweise Erzwungenheit und Individualität beziehungsweise Kollektivität der Sprachnutzung, territoriale Gebundenheit der Sprache, Institutionalität (Grad des offiziellen Status der Sprache) sowie migrationsbedingte Erscheinungen oder auch pathologische Mischformen gehören (vergleichen Sie dazu die Behandlung von sprachlichen Variationserscheinungen in Neuland (2006) und die Mehrsprachigkeitsdimensionen bei Oppenrieder und Thurmair (2003) sowie die Analyse der pädagogischen Aspekte bei Dirim (2005) und Mecheril, Dirim, Gomoll, Hornberg und Stojanov (2010)). So lässt sich darstellen, dass kombinierte und koordinierte Formen der Mehrsprachigkeit den Wissenstransfer unabhängig von der Sprache, in der das Wissen erworben wird, begünstigen. Wissensbestände sind bei ausgeglichener Mehrsprachigkeit – wie es auch die Interdependenzhypothese postuliert – aus allen beteiligten Sprachen in ähnlicher Weise abrufbar oder aktivierbar.