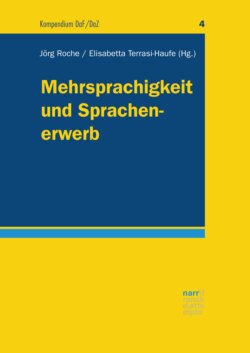Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 43
2.2.2 Einfluss der L1
ОглавлениеIn den Mehrsprachigkeitsmodellen, die sich dagegen an die KontrastivhypotheseKontrastivhypothese anlehnen, spielen Aspekte der gegenseitigen Beeinflussung der Sprachen eine wichtige Rolle (InterferenzInterferenz), aber Ausmaß und Qualität des Einflusses von vorerworbenen Sprachen und Kulturen werden in den Modellen unterschiedlich stark gewichtet. Die Kontrastivhypothese geht davon aus, dass die erworbenen Vorsprachen, vor allem aber die L1, einen Einfluss auf den weiteren Sprachenerwerb haben.
Bei der Modellierung von L1 und L2 werden allerdings homogene Sprachgebilde vorausgesetzt. Das heißt, dass Konzepte der sprachlichen Variation dort nicht berücksichtigt werden. In dem foreign language acquisition model (FLAM) von (Groseva 1998) etwa kommt der strukturellen Verwandtschaft der Sprachen eine wichtige Bedeutung zu: Die nähere Sprache übernehme demnach über bewusste und unbewusste Sprachlernstrategien die Funktion der Kontroll- und Korrekturinstanz für die weiteren Sprachen. Erst mit zunehmenden Sprachlernerfahrungen würden die Strategien vertieft und reflektiert. Als Resultat des Erwerbsprozesses entstehe ein L2-System, das alle charakteristischen Merkmale der Zielsprache, aber auch Interferenzerscheinungen aus der L1 sowie spezifische und nach Ansicht des Lerners besonders erfolgreiche Lern- und Kommunikationsstrategien in der L2 enthalte.
Diese bewusst gelernte L2 wird nach unserer Ansicht zu einer Art Korrektur- und Kontrollinstanz für jede weitere nächste Fremdsprache (L3, L4 etc.). (Groseva 1998:22)
Auf die katalytische Funktion des kognitiven Entwicklungsstandes beim Sprachenerwerb hebt dagegen die SchwellenhypotheseSchwellenhypothese ab. Sie geht davon aus, dass die vermeintliche Globalkompetenz der Erstsprache eine Referenzfunktion für die kognitive Entwicklung und damit für den L2-Erwerb hat. Ursprünglich wird aus dieser Referenzfunktion eine kausale Wirkung abgeleitet. Demnach sind gut ausgeprägte Sprachkompetenzen in der L1 Bedingung für den L2-Erwerb und guter L2-Erwerb ist die Grundlage zur Entwicklung höherer kognitiver Kompetenzen.
Abbildung 2.5:
Schwellen- und Interdependenzhypothese (nach Skutnabb-Kangas & Toukomaa 1977)
Der InterdependenzhypotheseInterdependenzhypothese zufolge sind also bestimmte minimale Niveaus in den Sprachen erforderlich, wenn der Sprachenerwerb positive Effekte auf die allgemeine kognitive Entwicklung der Lerner haben soll (vergleiche Abbildung 2.5). Diese Niveaus werden in Bezug auf die Kompetenz in der Erstsprache definiert und meist an Alter oder sozioökonomischem Status festgemacht. Die Hypothese besagt, dass der Erwerb einer fremden Sprache eher negative Effekte auf die kognitive Entwicklung eines jungen Lerners habe, wenn der Lerner nur eine niedrige Kompetenz in seiner Erstsprache besitze. Das Resultat sei dann ein doppelter SemilingualismusSemilingualismus, eine niedrige Kompetenz in Erst- und Zweitsprache. Über dieser Schwelle, in so genannten Standardfällen, in denen die Erstsprache zwar gut entwickelt ist, die Zweitsprache aber weniger gut, sind demnach die Effekte auf die kognitive Entwicklung neutral, das heißt, weder positiv noch negativ. Erst im additiven Bilingualismusadditiver Bilingualismus, bei einer hohen Kompetenz in Erst- und Zweitsprachen, lassen sich positive Effekte auf die allgemeine kognitive Entwicklung feststellen. Skutnabb-Kangas und Toukomaa (1977) fassen diese Hypothesen in dem Diagramm in Abbildung 2.5 zusammen. Diese frühen Hypothesen zur Mehrsprachigkeit haben unter anderem dazu geführt, Förderunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund in deren Erstsprache einzuführen (muttersprachlicher Unterricht wie Türkisch für Kinder mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland und Österreich), wenn diese nicht gut ausgebildet war. Erst nach der Etablierung der Grundlagen der Erstsprache kam der Unterricht in der neuen Umgebungssprache (zum Beispiel Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache) hinzu. Die Hypothesen sind später durch Cummins‘ Differenzierung zwischen Bildungssprache (Cognitive Academic Language Proficiency, CALP) und instrumentellen umgangssprachlichen Fertigkeiten (Basic Interpersonal Communicative Skills, BICS) weiterentwickelt worden (Cummins 1981). Diese Differenzierung ist ein wesentliches Kriterium für die Bewertung der allgemeinen kognitiven Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler. Im Sinne von Cummins globaler Unterscheidung lässt sich bei Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund vor allem ein Mangel an Kompetenzen in konzeptioneller Schriftlichkeit feststellen. Auch ihren schriftlichen Arbeiten in der Schule liege demzufolge ein Konzept von Sprache zugrunde, das eigentlich mündlich sei. Die konzeptionelle Mündlichkeit lasse sich als Grundlage medial schriftlicher Produktionen von Schülerinnen und Schülern und damit als Fehlerquelle des Unterrichts und Ursache für schlechte schulische Leistungen identifizieren. Zu der Unterscheidung von konzeptioneller Mündlichkeit und Schriftlichkeit und unterschiedlichen medialen Realisierungen siehe Dürscheid und Brommer (2009).