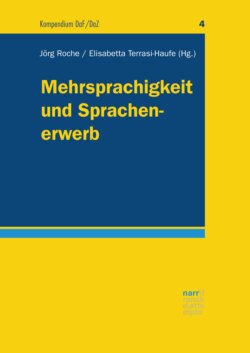Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 21
1.2.6 Mehrsprachigkeit und Sprachwandel
ОглавлениеIn Sprachenkontaktsituationen wirken die in Kontakt befindlichen Sprachen selbstverständlich einen gegenseitigen Einfluss aus. Mehrsprachigkeit beeinflusst nicht nur das Sprachverhalten von Menschen als Individuen oder Gruppen beziehungsweise Bürger und Bürgerinnen, sondern auch die Sprachen selbst. Im Sprachenkontakt gehen von Mehrheits- und Minderheitensprachen unterschiedliche Impulse aus. Sprecher und Sprecherinnen von Minderheitensprachen werden den Einfluss auf ihre Sprache eventuell eher zulassen als es Sprecher und Sprecherinnen von offiziellen, standardisierten oder Nationalsprachen tun würden. Weinreichs Beobachtung des Sprachenkontakts im deutsch-, französischsprachigen Teil der Schweiz ist dahingehend interessant:
Die Erkenntnis, dass die eigene Muttersprache keine standardisierte Sprache ist, die in allen Situationen der formalisierten Kommunikation angewandt werden kann (staatliche Aktivitäten, Literatur, Radio, Schule, und so weiter) sorgt oftmals dafür, dass die Sprecher anderen Einflüssen gegenüber gleichgültig eingestellt sind. In der Schweiz ist die funktionale ‚Unterlegenheit‘ des Schwyzerdütsch (eine überwiegend gesprochene Sprache) im Vergleich zum Französischen – eine Sprache mit uneingeschränkten Funktionen – so tief im Bewusstsein vieler Sprecher verankert, dass der Ablauf, Wörter aus dem Französischen für das Schwyzerdütsch zu borgen, in Grenzgebieten als so natürlich wahrgenommen wird, wie die Unwirtlichkeit des Französischen, Lehnwörter aus dem Schwyzerdütsch zu übernehmen. (Weinreich 1953: 88)
Von der dialektalen Varietät können solche Entlehnungen dann auch in die Standardsprache übernommen werden. Das gilt im schweizerischen Standarddeutschen zum Beispiel für Wörter wie Velo (‚Fahrrad‘), Perron (‚Bahnsteig‘) oder pressieren (‚es eilig haben‘).