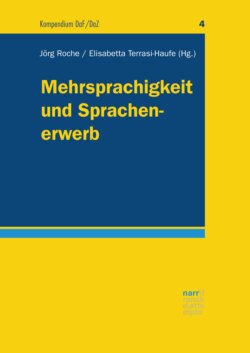Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 20
1.2.5 Mehrsprachigkeit und Kommunikation historisch betrachtet
ОглавлениеDie Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven auf das Phänomen der Mehrsprachigkeit hilft dabei, ihre kommunikativen Aspekte besser zu verstehen, denn Mehrsprachigkeit entsteht eigentlich durch Sprachenkontakt. Wie Sie sich vorstellen können, wird eine Person zunächst mehrsprachig, weil sie einen bestehenden Kommunikationsbedarf erfüllen muss. Der Kommunikation liegen wiederum unterschiedliche Motive zugrunde. Sie dient zur Erfüllung bestimmter Funktionen und wird nur dann möglich, wenn die notwendige Kompetenz dafür vorhanden ist. Wie wir gesehen haben, sind die Aspekte, die zur Bestimmung von Mehrsprachigkeit herangezogen werden, die gleichen wie die, die zur Charakterisierung des Kommunikationsprozesses verwendet werden können:
1 Kompetenz (wenigstens ein Mindestmaß davon) als essenzielle Voraussetzung dafür, Kommunikation einzuleiten und durchzuführen;
2 Funktion, da Kommunikation immer zielgerichtet ist und
3 Verhalten, das den Kommunikationsakt letztendlich ausmacht.
Das führt mit sich, dass die Betrachtung von Mehrsprachigkeit auch die Erforschung von Kommunikation aus soziolinguistischer Perspektive umfasst.
Braunmuller und Ferraresi (2003: 2) liefern eine breitangelegte historische Darstellung mehrsprachiger Verhaltensmuster in Europa. Sie behaupten, dass Mehrsprachigkeit vor der Herausbildung der Nationalstaaten in Europa, die die Auffassung „ein Staat – eine Nation – eine Sprache“ zur Folge hatte, als Normalfall empfunden wurde und dass „die Verwendung von anderen Sprachen außer jener der Mehrzahl der Einwohner keinesfalls etwas Besonderes für die Mittel- und Oberschichten Europas in den Jahrhunderten vor 1800 war“.
Als ein Ergebnis von Sprachenkontakt war Mehrsprachigkeit immer schon eine notwendige Voraussetzung für Handel und andere Arten von Kontakten außerhalb der eigenen Gemeinschaften. Die Mitglieder der Mittel- und Oberschicht vor 1800 mussten zum Beispiel die kaiserliche Lingua Franca beherrschen, oder die Sprachen der jeweils anderen, um innerhalb großer Kaiserreiche arbeiten zu können. Vor der Entstehung von Nationalstaaten und der Entwicklung von Diskursen zur nationalen Identität wurde Sprache eher funktional als politisch-symbolisch betrachtet. Die Verwendung mehrerer Sprachen war daher in unterschiedlichen Bereichen der Normalfall. Im mittelalterlichen England wurde Latein beispielsweise als die Sprache der Kirche und der gesetzlichen Verwaltung verwendet, wobei letzteres auch vom Angelsächsischen abgedeckt wurde und anglonormannisches Französisch als Schrift- und Literatursprache verwendet wurde. Die deutsche Oberschicht verwendete andererseits vor Mitte des 18. Jahrhunderts Französisch als die Sprache der Kultur und der Bildung, und in der dänischen Marine wurde bis 1773 Deutsch gesprochen (vergleiche Braunmuller & Ferraresi 2003: 2).
Dennoch hat sich die Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit seit dem 19. Jahrhundert bis heute gewandelt, zumindest in der Auffassung von Sprechern und Sprecherinnen höhergestellter Sprachen. Wir neigen nicht dazu, insgesamt verallgemeinernd über den aktuellen Status der Mehrsprachigkeit im globalen Sinne zu sprechen. Wie David Crystal (1997: 362) anmerkt, ist „Mehrsprachigkeit […] die natürliche Lebensform für hunderte Millionen überall auf der Welt“. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass Gemeinschaften in kleineren und industriell weniger entwickelten Ländern üblicherweise zwei oder mehrere Sprachen sprechen und Einsprachigkeit in vielen weiterentwickelten, insbesondere westlichen Ländern zu finden ist, in denen die Mehrheitssprache eine der weltweit am weitesten verbreiteten Sprachen ist. Für die Angehörigen der letzteren Gruppe gilt, dass sie immer noch die Einsprachigkeit als Normalzustand wahrnimmt und Mehrsprachigkeit als Spezialfall betrachtet wird.
Die Einstellung gegenüber Mehrsprachigkeit ist heutzutage, dank vieler politischer Bemühungen, meist positiv. Wir sprechen heutzutage vermehrt davon, dass Mehrsprachigkeit als Potenzial und Bereicherung anzusehen ist. Vermutlich ist die Wahrnehmung von Mehrsprachigkeit aber überall auf der Welt unterschiedlich. Wie wir in Lerneinheit 1.3 sehen werden, führen manche politischen Richtlinien auch dazu, Mehrsprachigkeit eher als Problem zu betrachten und manchmal werden Minderheitensprachen als Störfaktoren für die „Supersprachen“ gehalten. Die unterschiedlichen Meinungen gehen von der Auffassung aus, dass nur eine Sprache (insbesondere Englisch) die Sprache für offizielle Angelegenheiten sein sollte, bis hin zur Vorgabe für alle europäischen Bürger zwei Fremdsprachen zu lernen. Trotzdem scheint Mehrsprachigkeit im politischen und soziolinguistischen Diskurs eine größere Gewichtung zu bekommen, da sie, ob es uns gefällt oder nicht, mit fundamentalen Werten wie den Menschenrechten, linguistischer und kultureller Diversität und dem Spracherhalt verbunden ist.