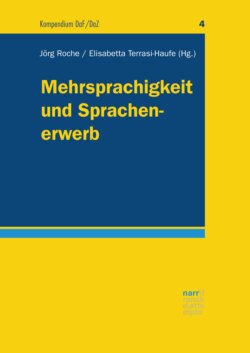Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 5
1. Mehrsprachigkeit
ОглавлениеZentraler Gegenstand dieses Bandes ist Mehrsprachigkeit als das Ergebnis von multiplem Spracherwerb, also Sprachenerwerb. Die Mehrsprachigkeitsforschung hat sich in den vergangenen Jahren von einer Bestimmung von Mehrsprachigkeit als die Muttersprachler ähnliche Beherrschung mindestens zweier Sprachen hin zu einer dynamischeren und vielfältigeren Betrachtung des Phänomens entwickelt. Unmittelbare Bedeutung für das Thema dieses Moduls haben vor allem funktionale Klassifizierungen mehrsprachiger Kompetenzen in Abhängigkeit vom Lern-, Arbeits- oder Erwerbsumfeld, von den kommunikativen Zielen und von der gewählten Sprachenfolge. Damit kann die unterschiedliche Ausprägung mehrsprachlicher Kompetenzen vor allem in Abhängigkeit von der kommunikativen Absicht und Reichweite (Zweck, Ziele) und unabhängig vom strukturellen Einfluss der Sprachen dargestellt werden. Die Dominanz einer Sprache lässt sich demzufolge funktional begründen, betrifft aber – anders als dies die früheren globalen Klassifizierungen getan haben – unter Umständen nur bestimmte Fertigkeitsbereiche und ist temporär.
In den folgenden Kapiteln erhalten Sie einen Einblick in das Phänomen der Mehrsprachigkeit aus mehreren Perspektiven. Zunächst geht es darum einzuführen, wie mehrere Sprachen in einzelnen Individuen, zwischen ihnen, in mehrsprachigen Gebieten und politischen Systemen koexistieren. Im Übergang zu Kapitel 2 fokussieren wir dann das Individuum. Nach einer Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Mehrsprachigkeit und Migration in 2.1 wird in Lerneinheit 2.2 auf die Unterscheidung zwischen der inneren Mehrsprachigkeit, die sich auf die Beherrschung unterschiedlicher Register oder Varietäten einer Sprache bezieht, und der äußeren Mehrsprachigkeit, die dagegen Kenntnisse in unterschiedlichen Sprachen umfasst, eingegangen. Auf weitere Aspekte dazu wird später in Kapitel 6 genauer eingegangen. Dort erhalten Sie Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen, wie schwierig es ist, einzelne Varietäten und Sprachen zu bestimmen und voneinander abzugrenzen. Davor aber beschäftigen Sie sich in Lerneinheit 2.3 sowie in Kapitel 3 und 4 mit verschiedenen dynamischen Modellen, die Mehrsprachigkeit als Ergebnis von Sprachenerwerb und Sprachenverarbeitung abbilden. Im Anschluss daran geht es in Kapitel 5 um Phänomene, die für den Sprachengebrauch von mehrsprachigen Individuen typisch sind: Code-Switching und Transfer. Kapitel 7 fokussiert dagegen die Entwicklung von Sprachen als Folge von Kommunikation in Sprachkontaktsituationen. Der Band schließt mit zwei Lerneinheiten zur Analyse von mündlichen und schriftlichen Lernersprachen und einem Überblick der empirischen Forschungsmethoden ab, die in diesem Forschungsfeld eingesetzt werden. Letzterer dient zur Reflexion der Komplexität des Untersuchungsgegenstands und zur kritischen Hinterfragung von Forschungsergebnissen und kann auch begleitend zur Darstellung von Forschungsergebnissen in den anderen Lerneinheiten gelesen werden. Eine umfassendere Darstellung relevanter Forschungsmethoden und Anleitungen zu deren Umsetzung finden Sie im Band »Propädeutikum«.