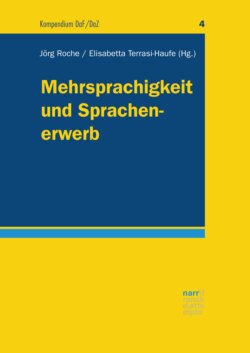Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 42
2.2.1 Innere und äußere Mehrsprachigkeit
ОглавлениеNach der These der natürlichen Mehrsprachigkeit beginnt diese nicht mit fremdsprachigen Codes. Auch „monolinguale“ Kinder erwerben im Laufe ihrer Sozialisation mit viel Erfolg und viel Vergnügen spielerisch und experimentell mehrsprachige Kompetenzen, die man als Varietäten der Sprache beschreiben kann. Diese natürliche Mehrsprachigkeit, die Wandruszka (1979) innere Mehrsprachigkeitinnere Mehrsprachigkeit nennt, entwickelt sich Zeit des Lebens mit dem Erschließen neuer Lebens- und Arbeitsbereiche weiter, obwohl gesellschaftliche Sanktionen und mangelnde Förderung in den frühen Jahren nicht selten die Entwicklung behindern.
Schon in unserer Muttersprache lernen wir ein dynamisches PolysystemPolysystem kennen, in dem die Sprachen verschiedener Lebenskreise, denen wir angehören, ineinandergreifen und sich vermischen. (Wandruszka 1979: 314)
Äußere Mehrsprachigkeitäußere Mehrsprachigkeit bezeichnet den Erwerb von Fremd- oder Mischsprachen (Hybridsprachen). Die anthropologische Dimension der inneren und äußeren Mehrsprachigkeit ergänzt das Variationsspektrum, das in der nachfolgenden Liste anhand der wichtigsten Dimensionen skizziert ist. Dabei sind die drei klassischen Kategorien des Diasystems nach Coseriu (1988a, 1988b; siehe Lerneinheit 6.1 in diesem Band) um weitere Variationsperspektiven (unterschiedlicher linguistischer Forschungsansätze) ergänzt. Damit ergeben sich auch Mehrfachzuordnungen.
Sprachliche Variation kann demnach aus unterschiedlichen Perspektiven untersucht und erklärt werden:
anthropologisch: in Bezug auf die innere und äußere Mehrsprachigkeit
diatopisch: in Bezug auf groß- und kleinräumige Dialekte; Regionalsprachen, Nationalsprachen, Kontakt- (Minderheiten-)Sprache, In-Group-Sprachen
diastratisch: in Bezug auf Schicht- und Gruppensprachen, Soziolekte, Ethnolekte, Jugendsprache, Alters-, Geschlechtsspezifik
diasituativ: in Bezug auf öffentliche beziehungsweise private Register, Ethnolekte, Soziolekte
diachronisch: in Bezug auf die historische Entwicklung von Sprachen, zum Beispiel die Entstehung von Kreolsprachen aus Pidgins
diaphasisch: in Bezug auf Kommunikationsbedingungen und Situativität, Stile und Register
medial beziehungsweise modal: in Bezug auf Schriftlichkeit und Mündlichkeit, wie sie sich etwa in Diglossien manifestieren
ontogenetisch: in Bezug auf den individuellen Sprachenerwerb und Sprachverlust, etwa in Aphasien
phylogenetisch: in Bezug auf die (chronologische) Entwicklung eines Sprachsystems
adaptiv: in Bezug auf adressatenspezifische Anpassungen, etwa kindgerichtete Sprache (Ammensprache, Motherese), Xenolekte, Pidgins, Gerolekte, Code-Switching
transkulturell: in Bezug auf Neologismen, Transkulturalität
didaktisch: etwa in Bezug auf die Sprache des Unterrichts, Lehrersprache
Diese Kategorien sind außerdem um die pragmatische Dimension zu ergänzen, da letztlich jede Art von sprachlicher Variation immer auch pragmatisch begründet werden kann.
Im Zusammenhang mit sprachlicher Variation spricht List (2004: 133) von „quersprachiger Kompetenz“ und bezeichnet damit ein fruchtbares Potenzial, die symbolischen Dienste unterschiedlicher sprachlicher Medien und Register zu erkennen, zwischen ihnen zu unterscheiden, sie womöglich selbst zu mischen oder wechselnd zu benutzen und quer durch sie hindurch zu handeln. Quersprachige Variationsstrukturen sind Ausdruck der natürlichen Kreativität im Umgang mit Sprache. Kinder und Jugendliche schaffen sich aus diesem Grund Geheimsprachen oder imitieren mit Freude und Leichtigkeit andere Kinder, Erwachsene, Cartoonfiguren oder öffentliche Stars. Lerner einer fremden Sprache haben vor allem deshalb Zugangsschwierigkeiten zu dem dargestellten Variationsspektrum der Sprachen, weil es am Anfang des Erwerbs von außen betrachtet unkonturiert erscheint und weil aus diesem Grund im Unterricht die Vielfalt oft reduziert, vermieden oder in die fortgeschrittenen Stufen ausgelagert wird. Eine erwerbsfördernde Funktion könnten aber gerade solche Variationstypen übernehmen, die den Lernern aufgrund ihres Erwerbsstandes besonders nahe sind, nämlich solche Strukturen, die von den Lernern auf ihren jeweiligen Erwerbsstufen verarbeitbar sind oder den Strukturen ihrer Erwerbsstufen entsprechen (vergleiche auch Kapitel 7 in diesem Band).