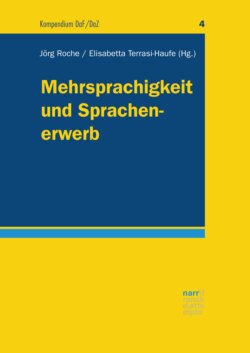Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 27
1.3.2 Sprachenpolitik und deren Einfluss auf Machtverhältnisse zwischen Sprachen
ОглавлениеDer verfassungsmäßige Status einer Sprache hat einen Einfluss darauf, in welchen Situationen eine Sprache benutzt wird und welche Einstellungen die Bürger und Bürgerinnen eines Landes zu dieser Sprache haben. Daneben spiegelt er nicht immer die tatsächliche Sprachensituation wider. Sogar Staaten, die sich als absolut einsprachig bezeichnen, müssen sich mit der Frage nach dem Umgang mit Minderheitensprachen in der Bildung, in der öffentlichen Verwaltung und in den kulturellen Domänen auseinandersetzen, um mögliche Sprachenkonflikte zu lösen oder ihnen vorzubeugen. Die Aufteilung von Staaten in verfassungsmäßig einsprachige oder mehrsprachige Gemeinschaftsordnungen ist daher wenig relevant für unsere Analyse des Vorkommens von Mehrsprachigkeit und für den tatsächlichen (nicht den beschriebenen) Umgang der Staaten mit diesem Umstand. Unsere Analyse beruht darauf, welche Formen die Machtverhältnisse zwischen Sprachen in mehrsprachigen Gesellschaften annehmen, und wie die Staaten auf diese Verhältnisse reagieren, ungeachtet dessen, ob die Staaten offiziell ein- oder mehrsprachig sind.
Wenn wir nun die Machtverhältnisse betrachten, unterscheiden wir zwischen mehreren Arten mehrsprachiger Muster. Eines davon beinhaltet Situationen, in denen zwei oder drei Sprachen mehr oder weniger friedlich nebeneinander koexistieren, wie die offiziellen Sprachen in der Schweiz und in Belgien. Zu demselben Muster zählen wir auch die Situationen, in denen zwei oder mehr Sprachen nebeneinander koexistieren, aber doch in Konkurrenz treten, allerdings ohne um ihr Überleben zu kämpfen. Dies ist beispielsweise beim Englischen und Französischen in Kanada der Fall. Hier sind die betroffenen Sprachen nicht vom Aussterben bedroht und ihre Sprecher und Sprecherinnen gehören nicht zur Kategorie der Sprachminderheiten.
In anderen Fällen geht es um Situationen, in denen eine der Weltsprachen, zum Beispiel die ehemalige Kolonialsprache oder Englisch, die keine Erstsprache innerhalb des Staates darstellt, als Kolonialsprache fortbesteht. Im Falle von Englisch spricht man hier häufig vom Englischen als associate official, also als angegliederte Amtssprache, wie es in Indien der Fall ist (vergleiche Spolsky 2004: 173). In diesem Fall ist es ebenfalls so, dass diese Sprache keinen politischen Druck ausübt und deshalb keine große Gefahr für den Erhalt der Mehrsprachigkeit darstellt. Die Dominanz solcher Sprachen, wie im Falle Indiens, ist zum Beispiel auf die Wirtschaft beschränkt (oder sie wird als eine Instanz des globalen sprachlichen Imperialismus klassifiziert) und wird kaum die linguistic human rights bedrohen. Die einstige Kolonialsprache spielt aber aufgrund ihrer zahlreichen Sprecher und Sprecherinnen, wegen ihres offiziellen Status und sozialen Prestiges, immer noch eine wichtige Rolle. Mehrsprachige Leitlinien dieser Staaten berücksichtigen die Position ehemaliger Kolonialsprachen sowohl in der Sprachenpolitik, als auch im politischen Diskurs und deshalb ist die neue Mehrheitssprache weniger stark, als sie trotz ihres offiziellen Status erscheinen mag. Kasachstan und Kirgisistan, in denen Russisch immer noch eine Amtssprache ist und unter anderem in Bildung und Medien weit verbreitet ist, sind dafür typische Beispiele.
Es gibt noch eine weitere Situation, in der es um die Interaktion zwischen Lokalsprachen (oder einer Lokalsprache) und einer Handelssprache geht: Sie kann heute fast ausnahmslos in jedem Teil der Welt beobachtet werden, wo Englisch unter anderem für geschäftliche Zwecke, in einigen Medien, bei sozialen Ereignissen und in bestimmten Bildungseinrichtungen verwendet wird. Die Frage, ob die Position der englischen Sprache in solchen Situationen guten oder schlechten Einfluss auf die Sprachenvielfalt in der entsprechenden Umgebung nehmen kann, ist nicht leicht zu beantworten.