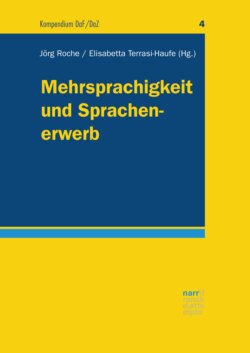Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 28
1.3.3 Von der territorialen Einsprachigkeit hin zur Mehrsprachigkeit
ОглавлениеAls nationalstaatliche Vorstellungen im Europa des 18. Jahrhunderts aufkommen, wird Sprache zumeist als Marker der nationalen Identität angesehen (vergleiche auch Lerneinheit 1.2). Zu späteren Zeitpunkten wird diese Vorstellung sogar noch stärker, als sich Nationalstaaten herausbilden. Neben anderen Mitteln nutzen Nationalstaaten die Sprachen, um ihre Existenz aufzuwerten und zu legitimieren sowie um verschiedene Gruppen unter einem nationalen Kollektiv zu vereinen. Aus diesem Grund werden Sprachen standardisiert, oder manchmal sogar erfunden, so wie im Falle einiger zentralasiatischer Sprachen in der ehemaligen Sowjetunion, um als Zeichen der Mitgliedschaft zu einer größeren (nationalen) Gruppe zu dienen. Shohamy stellt dazu fest:
Um seine Existenz zu beschützen, musste der Nationalstaat strikte Regeln, Regulierungen und eine Anzahl symbolischer Marker erfinden, um bei seinen Mitgliedern festzustellen, wer dazugehörte oder nicht. Die erste Vorgabe war „biologischer“ Natur, d.h., man war Deutsch, Spanisch oder Chinesisch, wenn man in den ‚Stamm‘ hineingeboren wurde, oder ‚vom selben Blut war‘. Aber der Nationalstaat suchte kontinuierlich nach zusätzlichen symbolischen Markern als klarere und deutlichere Kennzeichen der Zugehörigkeit. Zu den Markern, die zusätzlich zu den biologischen und physiognomischen Indikatoren genutzt wurden, zählten jene einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Kultur, gemeinsamer Vorfahren, einer gemeinsamen Religion und […] einer gemeinsamen Sprache. (Shohamy 2006: 26)
Die Förderung nicht nur der Nationalsprachen, sondern auch ihrer Standardvarietäten war laut Spolsky essenziell für die nationalstaatliche Idee:
Sowohl die Französische Revolution als auch die deutsche Romantik vertraten eine Auffassung von Nationalismus, dem die Annahme zugrunde lag, dass eine einzige vereinende Sprache die beste Definition und der beste Schutz für die Nationalstaatlichkeit sei. Eine angemessene Nationalsprache auszuwählen und sie von ihren ausländischen Einflüssen zu bereinigen, war eine bedeutende Leistung. (2004: 57)
Die Tendenz zur Förderung von Standards ist während der Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und auch danach immer noch sehr ausgeprägt. Doch die schwindenden nationalstaatlichen Vorstellungen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts fördern den Diskurs zur Sprachenvielfalt und zu den sprachlichen Menschenrechten. Internationale politische Organisationen, die zum Ende der Kolonialzeit und des Zweiten Weltkriegs entstehen, legen strikte Regeln zur Sicherung der Menschenrechte fest. Sowohl die jungen postkolonialen Staaten, als auch die Staaten mit einer bereits länger währenden Eigenstaatlichkeit, die traditionsgemäß einsprachige Richtlinien verfolgen, werden unter Druck gesetzt. Letztere werden dafür kritisiert, dass sie keine soliden Mechanismen etabliert haben, um für den Schutz und die Förderung von Minderheitensprachen zu sorgen, um sprachliche und kulturelle Vielfalt zu erhalten und um die Verwendung von Minderheitensprachen im Bildungswesen, am Arbeitsplatz und in den Medien zu fördern. Zusammen mit den internationalen Organisationen übt zu diesem Zeitpunkt auch die Zivilgesellschaft Druck aus, die sich nach dem Scheitern des radikalen Nationalismus im neuen Europa lautstark Gehör verschafft. Junge postkoloniale Staaten sind diesem Druck ebenfalls ausgesetzt, da ihre Sprachenpolitik den Minderheitensprachen fast ausnahmslos keinen Platz einräumt (insbesondere zur Zeit ihrer Gründung).
Der verstärkte Ruf nach Demokratisierung in den vergangenen Jahrzehnten hat die Frage nach den Minderheiten höchst dringlich werden lassen. Respekt und Akzeptanz von Minderheitensprachen waren und sind einige der Anforderungen, die internationale Institutionen sowohl an neue Staaten, als auch an jene mit einer längeren Nationalstaatsgeschichte stellen. Die Reaktionen der unterschiedlichen Staaten fallen ungleich aus, aber insgesamt ist die Tendenz dahin gegangen, ein neues Grundgerüst für die Gesetzgebung und die Umsetzung zu schaffen, das zwar den unterschiedlichen Sprachen nicht immer den gleichen Status, aber immerhin eine wesentliche Funktion einräumt.