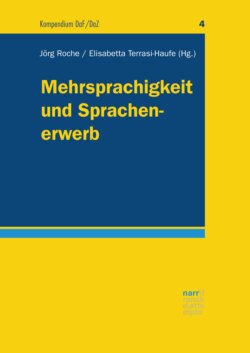Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 37
2.1.1 Mehrsprachigkeit in Migrations- und Bildungsforschung
ОглавлениеReduziertes Sprachverständnis als Hindernis
Die in Europa und den USA stark verbreitete gesellschaftliche Ausrichtung auf den monolingualen Modusmonolingualer Modus lässt Fremdsprachigkeit vor allem – zumal im Kontext von Zuwanderung und Integration – weitläufig als Problem erscheinen, nicht als Chance. Dahinter verbirgt sich oft die Annahme, Sprache und Identität ließen sich nur in Reinnatur und von anderen Sprachen und Kulturen strikt getrennt einander zuordnen. Nach diesem „Reinheitsgebot der Identität“ führt alles andere zu Vermischungen, Verwirrungen, sozialer Entfremdung und Identifikationsproblemen.
Hansen (2003) führt diese Beschränkungen auf einen begrenzten Nationenbegriff zurück und Oberndörfer (2005) zeigt unter Rückgriff auf Herder und dessen kritische Charakterisierung des Nationenverlustes in Frankreich, wie hieraus die Konzepte der ‚Sprachnation‘ und der ‚Nationalsprache‘ entstanden sind. Oberndörfer (2005) macht weiter deutlich, wie im Zuge dieser Diskussion die Restaurierung oder Schaffung der Volkssprachen beginnt: Aus Dialekten werden verschriftlichte und standardisierte Sprachen, andere Dialekte werden aus alten Überlieferungen völlig neu gebildet oder mit bestehenden Dialekten kombiniert. Dies geschieht unter dem Diktat der Ideologie: „Ohne eigene Sprache keine echte Volksnation, kein Recht auf politische Selbstbestimmung und Separation“ (Oberndörfer 2005: 232).
Die Ausschließlichkeit der Zuordnung von Staatsgebiet sowie Nation und Nationalsprache bestimmt auch heute die politische Diskussion in jungen Nationalstaaten und autonomen Gebieten, und zwar gerade dort, wo sie lange politisch gebannt war. In der aktuellen Integrationsdebatte in den deutschsprachigen Ländern schwingen diese Beschränkungen in Begriffen wie ‚Leitkultur‘, ‚kulturelle Identität‘ und ‚Staatssprache‘ mit und motivieren den Vorschlag, die Rolle der deutschen Sprache im Grundgesetz zu verankern. Eine gewisse Zeit lang ist von Gegnern und Gegnerinnen der Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität angesichts dieser monolingualen Ausrichtung angenommen worden, dass sich Mehrsprachigkeit insgesamt negativ auf die beteiligten Sprachen und eher „verwirrend“ auf den allgemeinen Geisteszustand ihrer Sprecher und Sprecherinnen auswirken würde. Auch als politische Waffe gegen die Eingliederung ethnischer Minderheiten wurden diese vermuteten negativen Effekte der Mehrsprachigkeit zum Beispiel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland mobilisiert (vergleiche auch die Ausführungen von Wolff (2006) zu ähnlichen Tendenzen in Großbritannien). Dass auch in der Migrationsforschung und der Bildungsforschung ökologische Konzepte der Mehrsprachigkeit bisher kaum angekommen sind, soll im Folgenden genauer betrachtet werden. Das reduzierte Sprachverständnis in Gesellschaft und Migrationsforschung führt immer wieder zu Fehleinschätzungen des Integrationsstandes und der Integrationsfähigkeit sowohl bei Migranten als auch bei der Mehrheitsbevölkerung.
Dabei treten zwei Defizitbereiche in der Behandlung des Themas ‚Sprache und Integration‘ auf: Erstens wird Integration weitgehend am Grad der Übernahme des Verhaltens oder der Annäherung an das Verhalten der Mehrheitsgesellschaft gemessen (Kopftuchfrequenz, Teilnahme am Sportunterricht, religiöse Praktiken, Medienverhalten und vieles mehr). Die Weiterentwicklung von Mehrkulturalität und Mehrsprachigkeit in einem dynamischen System des Kultur- und Sprachenausgleichs wird dabei ausgeblendet. Zweitens wird der Grad der tatsächlichen Annäherung der Migrantenpopulation an die Mehrheitsgesellschaft in der Öffentlichkeit weitgehend unterschätzt. Viele einschlägige Studien widerlegen die Negativ-Klischees über Migranten und zeigen dagegen ein variantenreiches Bild der Migration und Integration (siehe die Studie Muslimisches Leben in Deutschland des BAMF von Haug, Müssig & Stichs 2010; die Gutachten des Sachverständigenrates der Stiftungen mit dem Integrationsbarometer 2016 und mit dem Migrationsbarometer 2017).
Experiment
Die folgende Tabelle schlüsselt exemplarisch den Besuch religiöser Veranstaltungen nach Herkunftsregionen auf. Werten Sie die Tabelle aus: welche Tendenzen können Sie erkennen:
Abbildung 2.1:
Muslimisches Leben in Deutschland (Haug, Müssig & Stichs 2010: 161
Die BAMF-Studie Muslimisches Leben in Deutschland (Haug, Müssig & Stichs 2010) veranschaulicht unter vielen anderen Aspekten, dass der Einfluss religiöser Traditionen als vermeintliche Hürde zur Integration oft überschätzt wird. Bei diesem Aspekt wird unterstellt, dass eine starke muslimische Prägung eine eher distanzierte Haltung zum Aufnahmeland und gleichzeitig eine strenge Bindung an die Heimat und ihre religiösen und gesellschaftlichen Interessengruppen impliziert. Aus der Studie ergibt sich aber, dass durchschnittlich nur circa ein Drittel der Muslime in Deutschland häufig religiöse Veranstaltungen besucht und sich nur ein Teil der Muslime in Deutschland an religiösen Festen und Handlungen beteiligt. All dies sieht die BAMF-Studie als Indikator dafür, dass der Assimilation vor dem Ausbau transkultureller, mehrsprachiger Kompetenzen der Vorrang gegeben wird.
Als allgemeines Problem wird in vielen Studien dagegen die mangelnde Integrationsbereitschaft der Mehrheitsgesellschaft und deren geringes Interesse an den neuen Mitbürgern festgestellt. Auch die Studie Migranten und Medien (ARD, ZDF 2011) dokumentiert, dass der Integrationsgrad der Migranten in Deutschland weiter vorangeschritten ist, als von der Öffentlichkeit und den Medien dargestellt. Die Mehrheit der Migranten und Migrantinnen in Deutschland nutzt demnach bevorzugt deutschsprachige Medien. 76 % der Menschen mit Einwanderungshintergrund sehen regelmäßig deutschsprachige Fernsehprogramme, 60 % hören deutschsprachiges Radio und 53 % nutzen deutschsprachige Internetangebote. Nur eine Minderheit nutzt ausschließlich heimatsprachige Medien (13 % Fernsehen, 2 % Radio, 5 % Internet).
Bildung, Sprachkenntnisse und Integration
Der Erwerb der Zielsprache, etwa durch die Medien, wird von den meisten Befragten als Schlüssel zur Integration und zur Bildung und damit als Grundlage für persönliche und berufliche Karrieren angesehen. Schüler und Schülerinnen „mit Migrationshintergrund“ (auch MiHi) sind zumindest in Deutschland jedoch mit vielfältigen Hürden im Bildungssystemkonfrontiert.
So gestaltet sich der Übergang von der Schule in einen Beruf in Deutschland beispielsweise besonders schwierig. Die Abbrecherquoten in Schul- und Berufsausbildung zeigen einen im Durchschnitt um den Faktor vier erhöhten Wert gegenüber Schülern und Schülerinnen ohne Migrationshintergrund (siehe unter anderem OECD 2007, 2010; Bildungsgerechtigkeit; Jahresgutachten 2007 der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft; Politik-Check Schule vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln und der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, siehe Seim 2008). Eine Studie der Bertelsmann Stiftung (Werner, Neumann & Schmidt 2008) beziffert die volkswirtschaftlichen Kosten mangelnder (auch sprachlicher) Integration in der Bundesrepublik Deutschland auf € 16 Milliarden pro Jahr. Als eine der wichtigsten Ursachen dafür werden allgemein mangelnde (bildungssprachliche) Sprachkenntnisse geltend gemacht, und dies, obwohl entsprechende Lehrziele in den Curricula der allgemein- und berufsbildenden Schulen bereits berücksichtigt werden.
Wie stark Integration und Sprachkenntnisse zusammenhängen, weisen am deutlichsten die Sinus-Studie (2008) und ein kürzlich herausgebrachter Zwischenbericht des vhw-Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung (2016) auf Basis qualitativer Daten von Sinus-Institut Sociovision aus. So zeigt ein Exkurs zu den Daten des Zwischenberichts aus Abbildung 2.2 noch stärker, dass „in den soziokulturell modernen Lebenswelten ein bikulturelles Selbstverständnis die Norm“ und die „moderne Mitte“ sogar zu einer „post-integrativen Perspektive“ neigt und sich damit als „selbstverständlicher Teil der Mitte der Gesellschaft“ betrachtet, wobei andererseits auch „deutliche Segregationstendenzen in den traditionell geprägten Milieus und am sozial unteren Rand der Population“ erwähnt werden müssen (vhw 2016: 7f).
Abbildung 2.2:
Kulturelle Identität in der Milieulandschaft (vhw 2016: 6)
Die Sinus-StudieSinus-Studie (2008) zeigt eine vielfältige und differenzierte Milieulandschaft. Diese ist in insgesamt acht Migrantenmilieus unterteilt, die sich in Bezug auf den sozialen Status und die damit verbundenen Wertvorstellungen, Lebensstile und ästhetischen Vorlieben unterscheiden. Die Einteilung der Milieus geschieht nicht nach globalen ethnischen Merkmalen. Dadurch wird die Ausbildung gemeinsamer lebensweltlicher Muster bei Migranten aus unterschiedlichen Herkunftskulturen (Ethnien) deutlich. Die Sinus-Studie kommt daher zu dem Schluss, Menschen des gleichen Milieus mit unterschiedlichem Migrationshintergrund verbinde mehr miteinander als mit dem Rest ihrer Landsleute aus anderen Milieus. Der Integrationsgrad in die Zielgesellschaft sei wesentlich von der Bildung und der sozialen Herkunft abhängig: Je höher das Bildungsniveau und je urbaner die Herkunftsregion, desto leichter und besser gelinge die Integration in die Aufnahmegesellschaft. Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit, Religion und Zuwanderungsgeschichte beeinflussen die Alltagskultur, seien letzten Endes aber nicht milieuprägend und identitätsstiftend für das Milieu.
Die Sinus-Studie verdeutlicht, dass die meisten Migrantenmilieus jeweils auf ihre Weise um Integration bemüht sind und sich als Mitglieder der multikulturellen deutschen Gesellschaft verstehen. Bei drei der acht Milieus kann man starke Assimilationstendenzen erkennen (statusorientiertes Milieu, adaptives Integrationsmilieu, multikulturelles Performermilieu). Bei drei anderen Milieus finden sich zwar zum Teil Haltungen einer Integrationsverweigerung (religiös-verwurzeltes Milieu, entwurzeltes Milieu, hedonistisch-subkulturelles Milieu), aber die große Mehrheit der befragten Migranten will sich in die Aufnahmegesellschaft einfügen, ohne jedoch ihre kulturellen Wurzeln zu vergessen. Vor allem viele jüngere Befragte der zweiten und dritten Generation haben ein bikulturelles Selbstbewusstsein entwickelt und sehen Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit als Bereicherung – für sich selbst und für die Gesellschaft. Die Migrantenmilieus werden in der Sinus-Studie folgendermaßen dargestellt:
Abbildung 2.3:
Soziale Lage und Grundorientierung der Sinus-Migranten-Milieus in Deutschland (Wippermann & Flaig 2009: 8)
Die wichtigsten Ergebnisse der Sinus-Studie (2008) in Bezug auf Sprachen lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Viele Migranten und Migrantinnen, insbesondere in den soziokulturell modernen Milieus, haben ein bikulturelles Selbstbewusstsein und eine postintegrative Perspektive. Integration ist für sie kein Thema mehr. Dabei betrachten viele Migrationshintergrund und Mehrsprachigkeit als Bereicherung – für sich selbst und für die Gesellschaft. 61 % der Befragten sagen von sich, sie hätten einen bunt gemischten internationalen Freundeskreis. In den gehobenen Milieus liegt dieser Anteil deutlich über 70 %.
Als wichtigen Integrationsfaktor betrachten auch die Migranten die Beherrschung der deutschen Sprache. 85 % sind der Meinung, dass Zuwanderer ohne die deutsche Sprache keinen Erfolg haben können.
68 % der Befragten schätzen ihre deutschen Sprachkenntnisse als sehr gut oder gut ein. Weitere 26 % geben an, mittlere oder zumindest Grundkenntnisse zu haben.
65 % unterhalten sich im engeren familiären Umfeld überwiegend oder auch ausschließlich auf Deutsch, für 82 % ist Deutsch die Verkehrssprache im Freundes- und Bekanntenkreis.
Die geringsten Deutsch-Kenntnisse finden sich im Segment der traditionsverwurzelten Migrantenmilieus.
Die Deutschkenntnisse sind unter Migrantengruppen also recht unterschiedlich ausgeprägt und dementsprechend sind auch die Bewusstheit für die Notwendigkeit sprachlicher Kompetenzen, sowie die Bereitschaft sie zu erwerben, differenziert gestaltet. Die Heterogenität der Zielgruppe und die dort unterschiedlichen Einstellungen zum Sprachenlernen sowie die unterschiedlichen sprachlichen Kompetenzniveaus legen grundsätzlich eine nicht segregative Sprachförderung nahe. Wenn ethnische Faktoren nicht milieubildend wirken, können sie auch nicht Maßstab für ethnisch segregierende Fördermaßnahmen sein.
Bewertung der Sprachfertigkeiten in der Migrationsforschung
In Bezug auf Aussagen zu Sprachkompetenzen haben Migrationsstudien mehrheitlich ein großes Problem, auf das hier hingewiesen werden soll. Die Interpretation von Zusammenhängen zwischen Integration und Sprachenerwerb enthält eine Reihe von Ungenauigkeiten, die sich aus der Erhebung und Analyse der Sprachdaten ergeben. Nur ausnahmsweise stehen belastbare Daten zur Bewertung des Sprachstandes der Migranten und Migrantinnen zur Verfügung. Da verlässliche Daten meist nicht vorliegen oder nur mit großem Aufwand zu erheben sind, behilft sich die Migrationsforschung in der Regel mit Selbsteinschätzungen der Betroffenen. Wie auch in anderen Bereichen der Sozialforschung haben sich Selbsteinschätzungen aber als wenig zuverlässig erwiesen. Verschiedene empirische Vergleichsstudien zwischen Verfahren der Selbstevaluation (self-assessment) und der Kriterien basierten Fremdevaluation haben aber gezeigt, dass die Selbstevaluation in einem bestimmten Rahmen bedingt verlässliche Ergebnisse produzieren kann (vergleiche Dlaska & Krekeler 2008).
Um verlässliche Aussagen über sprachliche Aspekte machen zu können, muss in einer Untersuchung, die seriös mit dem Thema Sprachenerwerb und Sprachkompetenzen umgeht, ein objektivierbarer Maßstab angelegt werden, wie er etwa in standardisierten Sprachstandsprüfungen gegeben ist. Nicht jeder beliebige Test ist hierfür geeignet, weil die wenigsten der verfügbaren Sprachtests nach testwissenschaftlichen Maßstäben konzipiert sind (siehe auch Kapitel 3 und 4 im Band »Unterrichtsmanagement«). Die Testerstellung und -durchführung bedarf nicht nur einer Validierung, sondern auch einer Kalibrierung in Bezug auf unterschiedliche Testgenerationen (test-equating) und in Bezug auf das Training der Tester oder Testerinnen und Bewerter oder Bewerterinnen (inter-rater-reliability). Diese Kalibrierung ist besonders bei den in der Regel offeneren produktiven Fertigkeiten notwendig, um individuelle Präferenzen der Bewerter und Bewerterinnen bei der Bewertung auszugleichen. Für die Bewertung von sprachlichen Leistungen bieten sich neben aufwändigeren, auf adäquate kommunikative Kompetenzen ausgerichteten Tests aus organisatorischen Gründen auch Verfahren an, die in Bezug auf Themen und Aufgaben selektiv (bestimmte Kernkompetenzen) messen. Am bekanntesten sind dabei repräsentativ messende C-Tests, die trotz komprimierten Formats und geringer Redundanz nicht nur grammatische Kompetenzen, sondern auch die allgemeine Sprachkompetenz, zum Beispiel zum Zwecke der Einstufung, evaluieren können (Eckes & Grotjahn 2006).
Experiment
Wie gut beherrschen Sie die deutsche Sprache? Orientieren Sie sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER). Führen Sie anschließend den Beispieltest zum Online-Spracheinstufungstest onSet auf https://refugees.onset.de/ (Stand: 1. Juni 2017) durch.
Abbildung 2.4:
Formulierung der sechs Niveaustufen im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER 2017)
Vergleichen Sie die Ergebnisse Ihrer Selbsteinschätzung mit jenen des Online-Tests. Was können Sie feststellen? Diskutieren Sie im Forum.
Betrachtet man die Methoden der Studien, die herangezogen werden, um damit den vermeintlich mangelnden wirtschaftlichen und integrativen Nutzen von Mehrsprachigkeit zu begründen (so zum Beispiel Esser 2006) so stellt man fest, dass dort unter den sprachlichen Fertigkeiten fast ausschließlich subjektive Einschätzungen nach dem Muster „wie gut verstehen/sprechen … Sie die Sprache X?“ zur Anwendung kommen. Aus der Ungenauigkeit und Heterogenität der Angaben ergibt sich, dass weder die untersuchten Populationen noch ihre Selbsteinschätzungen miteinander zu vergleichen sind. Mit solchen Verfahren aber ist ein großer Teil der Migrationsforschung in Bezug auf die Feststellung von Sprachkompetenzen und Mehrsprachigkeit und deren Rolle bei der Integration nur begrenzt brauchbar.
Aufenthaltsdauer und Arbeitsmarkt
Von Interesse für die Migrationsforschung ist vor allem die Bemessung des wirtschaftlichen Nutzens von Mehrsprachigkeit. Wie beeinflussen die sprachlichen Kompetenzen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, welche Karrieren ergeben sich daraus, welche Einkommensniveaus können dadurch erreicht werden, oder sind der Mangel an Sprachkenntnissen sowie ein ausländischer Akzent ausschlaggebend für schlechtere und schlechter bezahlte Anstellungen? Wenn Mehrsprachigkeit einen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert hätte („kulturelles Kapital“), dann müssten sich überproportional gute Chancen für Menschen ergeben, die mehrere Sprachen beherrschen, also zum Beispiel Migranten und Migrantinnen, die die Sprachen ihrer Heimat oder ihrer Familien und die Zielsprache beherrschen.
In einer Metastudie zu verschiedenen deutschen und internationalen Studien hat Esser versucht, den oben genannten Fragen nachzugehen, nicht zuletzt um den wirtschaftlichen Wert der Mehrsprachigkeit im Kontext der Integrationsbemühungen zu bemessen (Esser 2006). Dabei liegt der Studie, die hier wegen ihres politischen Wirkungsanspruchs exemplarisch behandelt wird, folgende Annahme zugrunde: Der Sprachenerwerb ist theoretisch als eine, mehr oder weniger intentionale Investition unter bestimmten sozialen Bedingungen aufzufassen, die allgemein von der Motivation, dem Zugang, der Effizienz und den Kosten dieser Investition abhängig ist (vergleiche Esser 2007).
In den Ergebnissen zeigt sich, dass Migranten und Migrantinnen meist schlechter bezahlt werden als Einheimische, und diejenigen, die die Sprache schlechter oder gar nicht sprechen werden schlechter bezahlt als diejenigen, die sie perfekt sprechen. Daraus zieht Esser den Schluss, Mehrsprachigkeit habe insgesamt keinen beruflichen und wirtschaftlichen Nutzen für die betroffenen Migranten oder die Gesellschaft (Esser 2006). Die Mehr-Sprachenkompetenzen beförderten nicht die berufliche Karriere, das Lohnniveau der Mehrsprachigen sei niedrig, „kompetente Bilingualität bleibt die Ausnahme“ (Esser 2006). Die Herkunftssprachen hätten, außer Englisch, keinen wirtschaftlichen Wert und sollten daher zu Gunsten der Zielsprache Deutsch und allenfalls des Englischen als international hochwertiger Verkehrssprache aufgegeben werden. In seiner Metaanalyse unterlaufen Esser eine Reihe gravierender Fehler. Die Bestimmung des Sprachstandes stützt sich – wie dargestellt – auf wenig verlässliche Selbsteinschätzungen. Die herangezogenen Studien behandeln die sprachlichen Fertigkeiten weder in der L1 noch in der L2 anhand von validierbaren Kriterien (etwa Blackaby, Clark, Leslie & Murphy 1994; Blackaby, Leslie, Murphy & O'Leary 1998). Wenn man den wirtschaftlichen Nutzen von Mehrsprachigkeit messen will, sind die Qualität der sprachlichen Kompetenzen der Befragten und die im Beruf tatsächlich erforderliche Qualität von (Mehr-) Sprachenkenntnissen in differenzierter Weise zu berücksichtigen.
Genauso ist auch die Qualität des Aufenthalts und Zugangs zur Zielsprache und nicht nur die Verweildauer im Zielland beim Erwerb von Sprachkompetenzen zu berücksichtigen. Der quantitative Messindikator ‚Verweildauer‘ liefert keine hinreichende Erklärung von qualitativen Ursachen oder Effekten. Problematisch an der Metaanalyse von Esser und den herangezogenen Daten ist ferner, dass sie von wenig vergleichbaren Informantengruppen stammen. Diese sind zudem nicht selten in Berufen tätig, bei denen sprachliche Kompetenzen nur eine nachrangige Rolle spielen (vergleiche die Studien von Berman, Lang & Siniver 2003; Kalter 2006). Wenn man einen Beruf hat, in dem Sprachen im Normalfall nicht gebraucht werden und in dem das Qualifikationsniveau vergleichsweise niedrig ist, kann man nicht erwarten, dass die Mehrsprachigkeit die Defizite des Qualifikationsniveaus ausgleichen kann. In der Studie von Berman, Lang und Siniver (2003) etwa werden vor allem Programmierer, Computertechniker, Bauarbeiter und Tankstellenkassierer in den Vereinigten Staaten untersucht, zu deren Berufsfeld eigentlich keine extensiven fremdsprachigen Fertigkeiten gehören. In der deutschen Studie von Dustmann und van Soest (2002), die sich auf eine der wichtigsten Datensammlungen der Sozialforschung, das Sozioökonomische Panel (SOEP), stützt, werden „bildungsferne“ Migranten aus Italien, Spanien, der Türkei, Jugoslawien und Griechenland aus der Gesamtheit isoliert, um damit Aussagen über den (mangelnden) Nutzen fremdsprachiger Kompetenzen für die Arbeitstätigkeit und die berufliche Karriere abzuleiten.
Viele der von Esser herangezogenen Studien zum Arbeitsmarkterfolg enthalten nur ungenaue Angaben über die untersuchten Berufe (etwa Chiswick & Miller 2002; Davila & Mora 2001; Hayfron 2001). Wieder andere gehen in Bezug auf die Fertigkeiten und Biographien der untersuchten Personen sehr selektiv vor. Bei Kalter (2006) werden die Befragten mit Hochschulabschluss oder Fachhochschulabschluss explizit aus der Erhebungsgruppe herausgenommen. So darf es nicht verwundern, dass sich aufgrund einer selektiven Datenbasis nur wenige Effekte für den Nutzen der Mehrsprachigkeit auf dem Arbeitsmarkt ergeben.