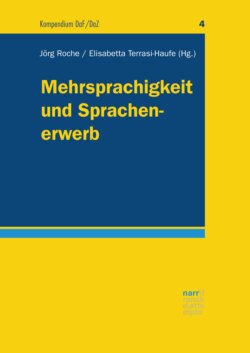Читать книгу Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb - Группа авторов - Страница 30
1.3.5 Mehrsprachigkeit als ein „Muss“ in der modernen Sprachenpolitik: Was haben die Sprachen und ihre Sprecher und Sprecherinnen davon?
ОглавлениеWenn sprachenpolitische Richtlinien bewertet werden, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Erstens versteht man unter einer mehrsprachigen politischen Richtung, dass ein Staat den Minderheitensprachen einen gewissen Platz einräumt. Zweitens werden die Richtlinien aus der Perspektive beurteilt, ob sie wirksame Instrumente zum Schutz der Sprachenvielfalt bieten, ob sie dem SprachenerhaltSprachenerhalt beitragen und ob sie ausgestorbene oder im Verfall begriffene Sprachen vor dem Sprachentod bewahren können beziehungsweise wiederbeleben können. Dabei handelt es sich um einen traditionellen Ansatz, der Mehrsprachigkeit in der Sprachenpolitik mit Fragen nach den Menschenrechten, der Menschenwürde und dem kulturellen Erbe verbindet. Dieser Ansatz hat Entscheidungsträger in der Sprachenpolitik dazu ermutigt, sich mit den unterschiedlichen Dimensionen von Mehrsprachigkeit aus Perspektiven wie ‚Sprache als Menschenrecht‘, ‚Sprache als ein Mittel zum Ausdruck der nationalen Identität‘, ‚Sprache als kulturelles Kapital‘, ‚Sprache und ihr Wert aus wirtschaftlicher Perspektive‘ sowie ‚die ökologische Stellung der Sprache in einem Ökosystem‘ auseinanderzusetzen. Diese Betrachtungsweise lässt, sowohl im politischen als auch im akademischen Diskurs, neue Bezugspunkte zum Vorschein treten. Zum Beispiel reichen die Argumente zur Verfechtung der Mehrsprachigkeit nun vom Erhalt der Menschenwürde bis hin zur Rolle der Sprache in der wirtschaftlichen Stellung der Einzelnen. Der Diskurs zu Sprache als ein grundlegendes Menschenrecht überlagert nun den abstrakteren Diskurs zur Rolle der Sprache in der politischen oder sozialen Integration. Ein allgemeineres Verständnis der Sprache als ein Symbol der nationalen Identität wird von einer konkreteren und greifbareren Auffassung von Sprache als Ausdruck der persönlichen beziehungsweise gruppenbezogenen Identität ersetzt. Diese Betrachtungsweise lässt andere Perspektiven zu: ‚Sprache als Teil eines Wertesystems‘, ‚Sprache als kulturelles Erbe und als Träger indigenen Wissens‘ und ‚Sprache als ein Schlüsselfaktor in der persönlichen Entwicklung‘. Die Entwicklung der ÖkolinguistikÖkolinguistik als ein neues Feld in der Soziolinguistik hat für weitaus mehr Aufmerksamkeit für den Stellenwert von Sprache im gesamten Ökosystem gesorgt.
Warum machen sich Wissenschaftler beziehungsweise Wissenschaftlerinnen und Entscheidungsträger beziehungsweise Entscheidungsträgerinnen in der Politik Sorgen um den Fortbestand einer mehrsprachigen Welt und ihrer Förderung durch Sprachenpolitik, insbesondere da Sprachen (und kulturelle Gruppen) seit dem ersten Erscheinen unserer menschlichen Vorfahren kommen und gehen (siehe Ricento 2006: 232)? Erstens gibt das Schicksal der Sprachen Linguisten und Linguistinnen Grund zur Sorge, da Sprache ihr direktes Forschungsfeld darstellt. Zweitens geht es beim Verfall und beim Verlust von Sprachen nicht nur um die Sprachen an sich, sondern auch um Kulturen, kulturelles Erbe und um indigenes Wissen. Wenn eine Sprache stirbt, dann reißt sie eine gesamte Kultur und ein reichhaltiges Depot indigenen Wissens mit wertvollen Informationen über lokale Gesellschaften mit sich. Mit dem Verlust einer Sprache bricht auch die Weitergabe traditionellen Wissens und sozialer Werte an die nächsten Generationen ab. Und die Aussichten sehen nicht gerade rosig aus. Wie Krauss (2007: 2) feststellt, liegt die Anzahl der Sprachen, deren Erhalt als gesichert bezeichnet werden kann, bei etwa 300, was circa 5 % aller existierenden Sprachen entspricht.
Das Scheitern des Schutzes der Sprachenvielfalt führt zum Verlust vieler Sprachen, was in direkter Verbindung zur Problematik der Menschenrechte steht. Normalerweise handelt es sich bei den rückläufigen Sprachen um solche, die von Minderheiten gesprochen werden. Die Sprachen von Mehrheiten sind besser durch sprachenpolitische oder andere politische Richtlinien geschützt und deshalb genießen Sprecher und Sprecherinnen von Mehrheitssprachen weitaus mehr Vorteile als jene der Minderheitensprachen, sei es in der Politik, in der Bildung, in der Wirtschaft oder in soziokulturellen Bereichen. Aus dieser Perspektive wird der Schutz von Mehrsprachigkeit zu einer Frage des Beschützens von Minderheitensprachen und kulturellem Erbe.
Experiment
Stellen Sie sich vor, Ihre Familiensprache ist in ihrer Existenz bedroht oder würde nicht weiterexistieren. Was würde passieren? Was würde verloren gehen? Wie würde sich Ihr Leben verändern?
Einer der Schwerpunkte in der Verfechtung solcher Schutzmaßnahmen ist die bewusste staatliche Intervention im Namen der schwächeren Sprecher- und Sprecherinnengruppe. Wie groß auch immer der Wille und die Entschlossenheit einer Minderheitensprachgruppe selbst sein mögen, ohne die bewusste staatliche Einflussnahme (welche die funktionale Inklusion und die finanzielle Unterstützung der entsprechenden Minderheitensprache einschließen sollte), wird die Sprachpflege nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Wie maßgeblich der Wunsch und Wille der Gemeinschaft selbst auch sein mag, so ist der Gemeinschaft möglicherweise nicht in allen Fällen vollends bewusst, welchen Wert der Erhalt ihrer eigenen Sprache und Kultur hat, insbesondere, wenn die durch die Mehrheitssprache angebotenen Möglichkeiten sehr einladend sind. Ein anschauliches Beispiel für eine solche Einflussnahme war die maßgebliche Unterstützung der Regierung für die Wiederbelebung der irischen Sprache, die nach der irischen Unabhängigkeit 1922 zu einer Amtssprache erhoben wird. Trotz der Tatsache, dass die Motivation der irischen Bevölkerung zur irischen Sprache zu wechseln, aufgrund der sich wandelnden wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse geringer ist als erwartet, ist die Unterstützung durch die Regierung entscheidend für den Erfolg dieser Maßnahme. Andere Beispiele sind die Wiederbelebung des Maorischen in Neuseeland, oder des Hebräischen in Israel (vergleiche Spolsky 2004: 44f).
Fishman identifiziert das Fehlen staatlicher Einflussnahme als eine „Null-Politik-Politik“ gegenüber schwächeren Sprachen, und stellte fest, dass „die meisten Sprachverschiebungen von formaler und schriftlicher Sprache verursacht oder bewusst erleichtert wird (zum Beispiel durch Eroberung oder andere bedeutende Verschiebungen des Status Quo), anstatt dass sie einfach passieren“ (Fishman: 2006: 318). Zum Beispiel erleichterten die Entscheidungsträger und -trägerinnen in der Sprachenpolitik den Umstieg von den Lokalsprachen zum Russischen, indem sie die Qualität russischer Schulen gegenüber den lokalsprachlichen verbessern und diese damit aufwerten, die russische Sprache am Arbeitsplatz fördern und die Bildungspolitik so gestalten, dass die Verwendung von Lokalsprachen in fortschrittlicher Wissenschaft und Technologie beschränkt ist.
Experiment
Führen Sie Interviews mit 20 Personen, die sich selbst als zweisprachig oder mehrsprachig bezeichnen. Erstellen Sie eine Liste der Sprachen, die jeder beziehungsweise jede von ihnen kennt. Wie viele von ihnen beherrschen ‚weniger bekannte Sprachen‘ (oder solche, die benachteiligt sind) als ihre eigene? Fragen Sie diese Personen nach den Gründen, aus denen sie diese Sprachen gelernt haben. Analysieren Sie Ihre Daten und identifizieren Sie die Hauptmotive, die zum Erlernen einer Sprache führen (ohne zu verallgemeinern).
Vermutlich wird Ihre Liste mehrsprachige Personen umfassen, die sich um das Erlernen von Sprachen bemüht haben, die bekannter sind als ihre eigene. Dies zeigt auch, warum Einsprachigkeit am weitesten unter Sprechern und Sprecherinnen der bekanntesten Sprachen verbreitet ist.