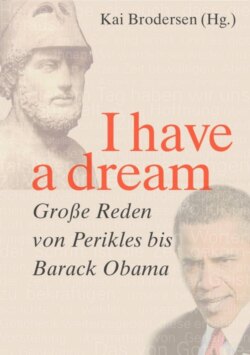Читать книгу I have a dream. - Группа авторов - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Perikles: Athen, die Schule von Hellas (430 v.Chr.)
ОглавлениеIn 45.000 Exemplaren wurde zwischen 1938 und 1944 der Text einer antiken Rede gedruckt, deren Zeitbezug sich nicht auf den ersten Blick erhellte: die Rede des griechischen Staatsmanns Perikles (um 495-429 v.Chr.) für die Gefallenen von Athen, die der griechische Historiker Thukydides im 5. Jahrhundert v.Chr. in seinem Geschichtswerk (2,35-46) über den Peloponnesischen Krieg wiedergegeben hatte. Die Übersetzung der Rede, die der Dichter Rudolf Georg Binding (1867-1938) zwei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erstmals publiziert hatte, fand nun, schon vor Beginn und besonders während des Zweiten Weltkriegs, erneut eine große Leserschaft: Die ersten 20.000 Exemplare des Büchleins erschienen 1938, weitere 10.000 zwei Jahre später und nochmals 15.000 im Jahr 1944; nach dem Kriegsende wurden erneut 10.000 Exemplare aufgelegt – eine für einen antiken Text ganz ungewöhnlich hohe Auflage. Was aber ist der ursprüngliche Kontext der Rede?
Thukydides schildert, in welcher Situation Perikles sprach: „Im selben Winter (431/30 v.Chr.) begingen die Athener nach Brauch der Vorfahren die öffentliche Leichenfeier für die ersten Gefallenen dieses Krieges auf folgende Weise: Die Gebeine der Verstorbenen stellen sie drei Tage vorher in einem Holzbau aus, und jeder bringt seinem Angehörigen Ehrengaben nach eigenem Ermessen. Dann beim Leichenbegängnis führen sie auf Wagen Zypressenholzsärge hinaus, für jeden Stamm einen; darin liegen die Gebeine der einzelnen Stammesangehörigen. Eine Bahre wird leer mitgetragen, ausgestattet für die Vermißten, die man bei der Bergung der Toten nicht gefunden hatte. Am Zug nimmt jeder, der will, teil, Bürger und Fremde, auch die angehörigen Frauen sind am Grab anwesend und wehklagen. Dann setzen sie die Toten im öffentlichen Grabmal bei, das in der schönsten Vorstadt liegt. … Wenn sie es mit Erde bedeckt haben, hält ein von der Stadt gewählter, als klug bekannter und hochangesehener Mann die den Toten gebührende Lobrede. Dann gehen sie weg. So begraben sie also ihre Toten; und während des ganzen Krieges, sooft es vorkam, hielten sie sich an diesen Brauch. Bei dieser ersten Feier wurde nun Perikles, Sohn des Xanthippos, gewählt zu reden. Zur gegebenen Zeit trat er vom Grab weg auf eine hohe Rednerbühne, errichtet, damit er möglichst weithin von der Menge gehört werden könne, und sprach so.“ Diese Rede also gibt Thukydides anschließend wenn nicht im Wortlaut, so doch „unter möglichst engem Anschluß an den Gesamtsinn des wirklich Gesagten“ (vgl. dazu S. 8) wieder.
In der Altertumswissenschaft ist freilich umstritten, ob die Rede in der Tat den „Gesamtsinn“ des im Jahr 430 v.Chr. wirklich Gesagten wiedergibt oder ob sie nicht vielmehr die Meinung des Thukydides aus der Rückschau auf jene Zeit spiegelt und dem Perikles gleichsam, in den Mund legt‘: Perikles nämlich war schon ein Jahr später, im Jahr 429 v.Chr., an der in Athen wütenden Pest gestorben, und 404 v.Chr. war die Niederlage Athens im Peloponnesischen Krieg besiegelt worden. Wollte Thukydides, der im Exil Zeuge der Niederlage geworden war, also im Rückblick zeigen, daß Perikles zu Lebzeiten die einzig erfolgversprechende Sicht der Kriegsplanung gehabt hatte, die dann aber von späteren Politikern sträflich mißachtet wurde – was Athen, die „Schule von Hellas“, in die Katastrophe führen sollte?
Als großer Redner einer großen Stadt zu großer Zeit erscheint Perikles in seiner Rede in der Tat, und in der Tat rührt vor allem von dem Lobpreis, das Athen in der Rede zuteil wird, auch die große Wirkung der Rede auf spätere Generationen: „Für eine solche Stadt, die sie nicht verlieren wollten, sind diese hier in edlem Kampf gefallen, und von den Überlebenden ist wohl keiner, der nicht für sie Mühen ertragen will.“ Und so überrascht es nicht, daß die Rede auch bei späteren Generationen, die ihre eigenen Gefallenen zu beklagen hatten und nach Gründen für den Sinn des, Heldentods‘ suchten, so viele Leserinnen und Leser fand!
Perikles: Rede für die Gefallenen Athens im Winter 431/430 v.Chr.
Die meisten, die vor mir von hier aus gesprochen haben, preisen den, der dem Bestattungsbrauch diese Art der Rede hinzufügte, weil es rühmlich sei, beim Begräbnis der Gefallenen sie zu halten. Mir freilich würde es ausreichend erscheinen, Männern, die durch die Tat ihren Ruhm begründet haben, auch durch die Tat ihre Ehre zu bezeugen, wie ihr es jetzt bei der öffentlichen Totenfeier geschehen seht, und nicht durch eines Mannes gute oder schlechte Rede den Glauben an die Tapferkeit so vieler zu gefährden. Denn schwer ist es, den rechten Ton der Rede zu treffen, wo man kaum für die vom Redner erkannte Wahrheit beim Hörer festen Glauben erwecken kann. Der wohlwollende Hörer, der die Zusammenhänge kennt, wird sicher die Darstellung als mangelhaft empfinden im Vergleich zu dem, was er will und weiß; und der unkundige wird meinen, es sei manches übertrieben – aus Neid, wenn er hört, was über sein Leistungsvermögen geht. Denn nur so weit erträgt man Lob, das anderen zuteil wird, wie jeder Einzelne sich fähig hält, selbst zu tun, was er gehört hat; was darüber hinausgeht, glaubt man aus Neid schon nicht mehr. Da es aber von den Alten so als richtig gebilligt wurde, muß auch ich dem Brauch folgen und versuchen, euer aller Wunsch und Ansicht zu treffen, soweit ich kann.
Ich will zunächst mit den Vorfahren beginnen – recht und geziemend ist es, ihnen bei solchem Anlaß diese Ehre des Gedenkens zu erweisen. Denn unser Land haben sie, immer die gleichen Bewohner in der Aufeinanderfolge der Geschlechter, durch ihre Tüchtigkeit bis auf den heutigen Tag in Freiheit vererbt. So sind sie des Ruhmes wert, noch mehr aber unsere Väter. Sie erwarben zu dem Ererbten unser jetziges Reich – nicht ohne Mühe!– und haben es uns Heutigen hinterlassen. Am meisten jedoch haben es wir hier, die jetzt Lebenden, in unserem reifen Mannesalter gemehrt und die Stadt in allem so gerüstet, daß sie im Krieg und im Frieden völlig auf sich selbst stehen kann.
Über die Kriegstaten, durch die unser Besitz Stück um Stück wuchs, wenn etwa wir selbst oder unsere Väter einen Angriff von Barbaren oder Hellenen entschlossen abwehrten, darüber will ich keine großen Worte machen – ihr kennt sie, und ich lasse das beiseite. Von welcher Grundhaltung aus wir dazu kamen, dank welcher Verfassung und durch welche Sinnesart unsere Macht erstand, das will ich zunächst klar legen, ehe ich zum Preis dieser Toten komme; denn in der gegenwärtigen Stunde, glaube ich, ist es doch sicher nicht unpassend, darüber zu sprechen, und für die ganze Versammlung, Bürger und Fremde, nützlich, davon zu hören.
Die Staatsverfassung, die wir haben, richtet sich nicht nach den Gesetzen anderer, viel eher sind wir selbst für manchen ein Vorbild, als daß wir andere nachahmten. Mit Namen heißt sie, weil die Staatsverwaltung nicht auf wenige, sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist, Demokratie. Es haben nach den Gesetzen in den persönlichen Angelegenheiten alle das gleiche Recht, nach der Würdigkeit aber genießt jeder – wie er eben auf irgendeinem Gebiet in Ansehen steht – in den Angelegenheiten des Staates weniger aufgrund eines regelmäßigen Wechsels in der Bekleidung der Ämter, sondern vielmehr aufgrund seiner Tüchtigkeit den Vorzug. Ebenso wenig wird jemand aus Armut, wenn er trotzdem für die Stadt etwas leisten könnte, durch seine unscheinbare Stellung daran gehindert. Frei leben wir als Bürger im Staat und frei vom gegenseitigen Mißtrauen des Alltags, ohne gleich dem Nachbarn zu zürnen, wenn er sich einmal ein Vergnügen macht, und ohne unseren Unmut zu zeigen, der zwar keine Strafe ist, aber doch durch die Miene kränkt. Wie ungezwungen wir aber auch unsere persönlichen Dinge regeln, so hüten wir uns doch im öffentlichen Leben, allein aus Furcht, vor Rechtsbruch – in Gehorsam gegen Amtsträger und Gesetze, hier vor allem gegen solche, die zum Nutzen der Unterdrückten erlassen sind, und die ungeschriebenen, deren Übertretung nach allgemeinem Urteil Schande bringt.
Außerdem haben wir reichlich für geistige Entspannung nach der Last der Arbeit gesorgt, durch Wettkämpfe und feierliche Opfer, die wir jährlich feiern, durch eine geschmackvolle Ausstattung unserer Häuser, die uns Tag für Tag erfreut und die Sorgen verscheucht. Dank der Größe unserer Stadt strömen aus aller Welt alle Güter bei uns ein – und so haben wir das Glück, ebenso bequem die Erzeugnisse des eigenen Landes zu genießen wie die fremder Völker.
Wir unterscheiden uns auch in der Sorge um das Kriegswesen von unseren Feinden. Wir gewähren jedem Zutritt zu unserer Stadt, und niemals verwehren wir durch Fremdenaustreibungen jemandem etwas Wissens- oder Sehenswertes, dessen unverhüllte Schau etwa dem Feind nützen könnte; denn wir bauen weniger auf Rüstung und Überraschung als auf unseren eigenen zur Tat entschlossenen Mut. In der Erzählung streben jene in rastlosem Mühen schon von klein auf nach Mannesmut, wir aber leben gelöst, doch gehen wir nicht minder entschlossen an die gleichen Gefahren heran. Der Beweis: Die Lakedaimonier ziehen nicht allein, sondern mit all ihren Verbündeten gegen unser Land; wenn wir aber im Nachbarland einfallen, so erringen wir ohne Mühe in der Fremde, kämpfend gegen die Verteidiger ihrer Heimat, meist den Sieg. Mit unserer Gesamtmacht ist noch nie ein Feind zusammengestoßen, weil wir gleichzeitig die Flotte versorgen und unsere Leute bei vielen Unternehmungen zu Lande aussenden. Treffen unsere Feinde dann irgendwo auf einen Trupp und besiegen einige wenige von uns, so brüsten sie sich, sie hätten uns alle zurückgeworfen, unterliegen sie, sie seien von unserer Gesamtmacht geschlagen worden.
Alles in allem: Wenn wir eher mit unbeschwertem Sinn als sorgenvoller Mühe und nicht so sehr in gesetzgebotener als vielmehr wesensentsprungener Tapferkeit bereit zum Wagnis sind, so haben wir davon nur Vorteil: Künftige Not macht uns nicht vorher schon Sorge, und ist sie da, zeigen wir uns nicht weniger wagemutig als solche, die sich immer abmühen. Hierin verdient unsere Stadt Bewunderung und noch in anderem.
Wir lieben die Kunst mit maßvoller Zurückhaltung, wir lieben den Geist ohne schlaffe Trägheit; Reichtum dient uns der rechten Tat, nicht dem prunkenden Wort, und seine Armut einzugestehen ist für niemanden schmählich, ihr nicht zu entrinnen durch eigene Arbeit gilt als schmählicher. Mit derselben Sorgfalt widmen wir uns dem Haus- wie dem Staatswesen, und ist auch jeder von uns seinen eigenen Arbeiten zugewandt, so zeigt er doch im staatlichen Leben ein gesundes Urteil. Einzig und allein bei uns heißt doch jemand, der nicht daran teilnimmt, nicht untätig, sondern unnütz; und nur wir entscheiden in Staatsgeschäften selbst oder denken sie doch richtig durch, denn nicht schaden nach unserer Meinung Worte den Taten, sondern vielmehr, sich nicht durch das Wort vorher belehren zu lassen, ehe man an die nötige Tat herangeht. Aber auch dadurch zeichnen wir uns aus, daß wir kühnen Mut und kluge Überlegung bei allem, was wir anfassen, in uns vereinen, während die anderen Unkenntnis verwegen, Überlegung bedenklich macht. Die größte Seelenstärke sprechen wir mit Recht denen zu, die das Furchtbare und das Angenehme am klarsten erkennen und gerade deshalb keiner Gefahr ausweichen. Auch in den Fragen des edlen Betragens unterscheiden wir uns von den meisten: Nicht indem wir Wohltaten empfangen, sondern leisten, gewinnen wir Freunde; zuverlässiger ist ja der Wohltäter, da er sich den schuldigen Dank des Beschenkten durch Freundschaft erhält, der Schuldner aber ist gleichgültiger, da er weiß, daß er seine Leistung nicht als Dank, sondern als Schuld abstattet. Wir allein sind gewohnt, nicht aus Berechnung des Vorteils, sondern im sicheren Vertrauen auf unsere Freiheit jemandem zu helfen.
Zusammenfassend sage ich, daß unsere Stadt im Ganzen die Schule von Hellas sei und daß jeder einzelne Bürger, wie ich glaube, bei uns in vielseitigster Weise und in spielerischer Anmut seine ihm eigene Art entfalte. Daß dies nicht Prunk mit Worten für den Augenblick ist, sondern Wahrheit der Tatsachen, beweist die Macht der Stadt, die wir dank unserer Eigenschaften errungen haben. Unsere Stadt ist die einzige, die stärker als ihr Ruf in den Entscheidungskampf eintritt, die einzige, die im Feind nicht Unwillen erregt, welche Art von Leuten ihm Leid zufüge, und im Untertan nicht Ärger, er werde von Unwürdigen beherrscht. Mit sichtbaren Zeichen, wahrlich nicht ohne Zeugen, entfalten wir unsere Macht, in Gegenwart und Zukunft uns zum Ruhme: Wir brauchen keinen Homer als Künder unserer Taten noch sonst jemanden, der mit schönen Worten für den Augenblick ergötzt – die Wirklichkeit wird ja doch seiner dichterischen Gestaltung den Glanz nehmen; nein, zu jedem Meer und Land haben wir uns durch unseren Wagemut Zutritt verschafft, überall haben wir mit unseren Siedlungen unvergängliche Denkmäler unseres Glücks oder Unglücks hinterlassen.
Für eine solche Stadt, die sie nicht verlieren wollten, sind diese hier in edlem Kampf gefallen, und von den Überlebenden ist wohl keiner, der nicht für sie Mühen ertragen will. Deshalb habe ich so lange über die Stadt gesprochen, um zu beweisen, daß für uns der Kampf etwas ganz Anderem gilt als für die, die nichts Ähnliches besitzen, und um zugleich den Ruhm der Männer, denen zu Ehren ich jetzt spreche, durch Beweise deutlich darzustellen. Das Wichtigste davon ist schon gesprochen, denn was ich an der Stadt pries, damit haben diese und solche Helden sie durch ihre hervorragenden Taten geschmückt, und nicht bei vielen Hellenen wird man so wie bei ihnen Wort und Tat im Einklang finden. Ich glaube, den Wert eines Mannes offenbart als erster Hinweis oder letzte Bestätigung ein Ende wie ihres. Denn auch bei denen, die sonst weniger tüchtig waren, muß gerechterweise ihr im Krieg dem Vaterland erwiesener Heldenmut höher gewertet werden; durch Gutes tilgten sie Böses und nützen so dem Gemeinwesen mehr, als sie im Privatleben geschadet haben. Von ihnen hat keiner den weiteren Genuß seines Reichtums vor alles andere gestellt und sich etwa feige benommen, keiner hat in der Hoffnung der Armut, er könnte ihr vielleicht doch einmal entrinnen und zu Reichtum kommen, Aufschub des Furchtbaren gesucht. Die Rache an den Feinden war ihnen begehrenswerter als all dies, und weil sie von allen Gefahren diese als die Schönste erachteten, waren sie entschlossen, unter Gefahr sich an ihnen zu rächen, das andere aufzugeben. Der Hoffnung stellten sie das Ungewisse des Erfolges anheim, für die Tat, bei dem, was bereits klar vor ihnen lag, wollten sie auf sich selbst bauen. Da sie in Kampf und Tod ein rühmlicheres Los sahen als in der Rettung durch Flucht, entflohen sie dem schimpflichen Gerede, standen aber mit ihrem Leib den Kampf durch und fielen in einem kurzen Augenblick auf dem Höhepunkt mehr des schicksalsbestimmten Ruhmes als der Furcht.
So wurden sie, wie es sich für diese Stadt gebührt, zu Helden. Die Überlebenden mögen zwar um ein gefahrloseres Geschick beten, müssen aber bereit sein, nicht minder kühnen Sinn gegenüber den Feinden zu beweisen, und dabei nicht nur in Gedanken den Nutzen betrachten – darüber könnte euch, die ihr es ebenso gut wißt, jemand eine wortreiche Rede halten, wieviel Gutes in der Abwehr des Feindes liegt; nein, sie müssen die Macht der Stadt Tag für Tag in der Wirklichkeit betrachten und sie mit heißer Liebe umfassen und, wenn sie euch groß dünkt, daran denken, daß kühne Männer mit Einsicht in das Nötige und voll Ehrgefühl in ihrem Tun das alles errungen haben, Männer, die sooft sie auch bei einem Unternehmen einen Fehlschlag erlitten, es doch für unwürdig hielten, die Stadt ihres Heldenmutes zu berauben, und das schönste Opfer darbrachten. Für das Gemeinwesen gaben sie ihr Leben hin – jeder für sich gewann unsterbliches Lob und ein weithin berühmtes Grab; und nicht nur eine Inschrift auf dem Ehrenmal in der Heimat kündet von ihnen, sondern auch in der Fremde wohnt in jedermann ungeschriebenes Gedenken – mehr ihres Wesens als ihrer Taten. Ihnen eifert jetzt nach, erkennt das wahre Glück in der Freiheit, die Freiheit aber in kühnem Mut und schaut nicht ängstlich auf die Gefahren des Krieges. Nicht wer im Elend lebt und keinen Wandel zum Guten erwarten darf, hat rechten Grund, sein Leben einzusetzen, wohl aber, wem der gegenteilige Umschwung im Leben noch droht und für wen der Unterschied gewaltig ist, falls er einmal stürzt. Denn schmerzlicher ist für einen Mann von Ehrgefühl die Schmach der Feigheit als der im Bewußtsein der Kraft und der gemeinsamen Hoffnung eintretende empfindungslose Tod.
Deshalb will ich auch ihre Eltern, so viele von ihnen anwesend sind, nicht beklagen, sondern trösten. In wechselvollen Zeitläuften aufgewachsen, wissen sie, daß Glück nur bedeutet, des ruhmvollsten Todes, wie diese jetzt, oder Leides, wie ihr, teilhaft zu werden, oder daß des Lebens Dauer so zugemessen wurde, darinnen glücklich zu sein und zu sterben. Schwer ist es, ich weiß, euch davon zu überzeugen; noch oft werdet ihr euch an sie erinnern müssen bei anderer Leute Glück, in dem ihr einst selbst erstrahltet; schmerzlich ist es ja nicht, eines Gutes beraubt zu werden, das man nie gekannt hat, wohl aber, eines zu verlieren, woran man gewöhnt war. Standhaft im Leid muß also sein, in der Hoffnung auf neue Kinder, wer noch jung genug ist, Kinder zu zeugen. In manchen Häusern werden die nachwachsenden die nicht mehr lebenden in Vergessenheit sinken lassen, und der Stadt bringt es zweifachen Vorteil, sie wird nicht entvölkert und bleibt gesichert. Es kann nämlich niemand mit gleichem und gerechtem Sinn im Rat sprechen, wer nicht unter Einsatz seiner Kinder wie alle anderen an der Gefahr mitträgt. Und ihr, die ihr über das Mannesalter hinaus seid, haltet für umso größeren Gewinn das Leben, das ihr im Glück verbrachtet, im Bewußtsein, daß der Rest kurz sein wird, und richtet euch auf am Ruhm eurer Kinder. Denn das Ehrgefühl allein altert nicht, und im nutzlosen Greisenalter erfreut nicht so sehr der Gewinn, wie manche sagen, sondern die Ehre.
Euch Söhnen, die ihr anwesend seid, und Brüdern, sehe ich einen harten Wettkampf voraus – denn die Toten pflegt jedermann zu loben –, und nur schwer, bei übermäßiger Leistung, werdet ihr ihnen nicht etwa gleich, aber doch nur wenig geringer geachtet werden. Neid erwächst den Lebenden im gegenseitigen Wetteifer, nur was uns nicht mehr im Wege steht, wird mit unumstrittener Gunst verehrt.
Wenn ich noch der weiblichen Tugenden all derer, die jetzt als Witwen leben werden, gedenken soll, so will ich mit einem kurzen Zuspruch alles aufzeigen: Hinter der euch angeborenen Natur nicht zurückzubleiben wird euer großer Ruhm sein, und wenn von einer im Guten wie im Schlechten am wenigsten unter Männern geredet wird.
So habe auch ich in einer Rede nach dem Brauch gesagt, was ich für angemessen hielt. Durch die Tat wurden die Bestatteten schon jetzt geehrt, andererseits wird die Stadt ihre Söhne auf öffentliche Kosten bis zum Mannesalter aufziehen und so den Toten und den Hinterbliebenen einen wertvollen Kranz für solche Kämpfe aussetzen; denn wo die edelsten Preise den mannhaften Sinn lohnen, in der Stadt leben auch die besten Bürger.
Nun beklagt eure Angehörigen und dann geht.
Die Rede ist hier mit freundlicher Genehmigung des Verlags Philipp Reclam jun. nach der Neuübersetzung von Helmuth Vretska und Werner Rinner (Reclams Universal-Bibliothek 1808, Stuttgart 2000) wiedergegeben.