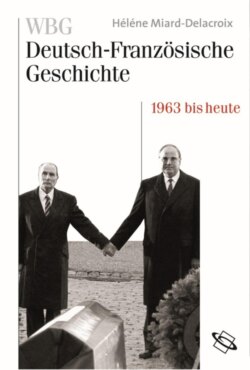Читать книгу WBG Deutsch-Französische Geschichte Bd. XI - Группа авторов - Страница 12
4. Das vorläufige Ende der Gewissheit: Wirtschafts- und Währungskrisen
ОглавлениеWeder die Reformeuphorie zu Beginn der Amtszeit Willy Brandts noch der Modernisierungsschub unter Georges Pompidou vermochten in Deutschland oder Frankreich die Ernüchterung angesichts der Begleiterscheinungen einer Entwicklung aufzuwiegen, die von der Forschung immer häufiger als Wendepunkt der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gesehen wird. Abgesehen von der Frage ihrer Begründung durch ökonomische Indikatoren spiegelte die Qualifizierung der Vorgänge als „wirtschaftlicher Umbruch des Abendlands“ oder schlicht „Krise“ über die makroökonomischen Realitäten hinaus eine gefühlsmäßige Wahrnehmung der Ereignisse118. Letztere bewirkte, dass die Währungsschocks und die Unfähigkeit, ökonomische Turbulenzen wie bisher mit dem keynesianischen Konzept der Globalsteuerung aufzufangen, in einer Krise am Arbeitsmarkt und einer „Zukunftskrise“ konkrete Gestalt annahmen, die das Ende des deutschen „Wirtschaftswunders“ ebenso einläuteten wie der französischen „glorreichen dreißig“ (Trente glorieuses)119. Der Ausdruck Krisenmanagement etablierte sich dabei „als Schlüsselbegriff für die Regierung Helmut Schmidts“120, während Valéry Giscard d’Estaing dasselbe tat, jedoch in seiner Ausdrucksweise am Bild der Dynamik festhielt, das besser zur Moderne passte, als deren Vertreter er sich selbst sah. Die gemeinsamen deutsch-französischen Anstrengungen erfolgten aus einer resolut internationalen Perspektive heraus, denn die Idee eines globalen Ansatzes ergab sich zwangsläufig aus der geänderten Wahrnehmung des transnationalen Charakters der jüngsten Entwicklungen und aus der Notwendigkeit einer Umgestaltung der Weltwirtschaft, insbesondere des internationalen Währungssystems. Die bisherige „Vernunftehe“121 zwischen Frankreich und Westdeutschland durchlief einen Wandel, der in ein neues Gleichgewicht, ein wechselseitiges Geben und Nehmen mündete: die wirtschaftliche Glaubwürdigkeit Deutschlands gegen die internationale Bedeutung Frankreichs122.
Noch vor der Rezession infolge des ersten Ölschocks 1973, der mit drastischen Energiesparmaßnahmen wie eine kalte Dusche wirkte, kündigte sich der Veränderungsprozess schon unter Brandt und Pompidou mit der Währungskrise von 1971 an. Sie stand für den Zusammenbruch des Systems von Bretton Woods, das im Juli 1944 mit einem stabilen Währungssystem auf Basis des Gold-Devisenstandards die Weltwirtschaft hatte stärken sollen. Ein Vorbote der Krise war der seit mehreren Jahren spürbare Druck auf die DM mit erheblichen Konsequenzen für die deutsche Wirtschaft in Form eines massiven Kapitalzuflusses an die Bundesbank in Form von ausländischen Devisen und einer drohenden Aufwertung der DM, die sich, wie man befürchtete, negativ auf den Export deutscher Produkte auswirken würde. Die Folge waren erhebliche Spekulationen mit DM und Yen, ausgelöst durch das anhaltende Haushaltsdefizit der USA und punktuelle politische Krisen wie 1968 in Frankreich nach den Mai-Unruhen, die eine panikartige Flucht aus dem Franc und Gerüchte über seine Abwertung nach sich zogen. „Solange ich dieser Bundesregierung als Kanzler vorstehe, wird es eine Aufwertung der D-Mark nicht geben“, hatte Kiesinger beim Bonner Gipfeltreffen im November 1968 erklärt und diese Position auch im Frühjahr 1969 beibehalten, als die Wirtschaftsexperten, Vertreter der Bundesbank, Bundeswirtschaftsminister Karl Schiller (SPD) und generell die SPD angesichts der erneuten Spekulationslawine im Gefolge von de Gaulles Rücktritt im April eine Aufwertung der DM einstimmig befürworteten123. Sie war eine der ersten Maßnahmen der neuen sozialliberalen Regierung am 27. Oktober, nachdem der im September vorübergehend freigegebene DM-Kurs um 9,3 % gegenüber dem Dollar gestiegen war124. Mit der Festlegung neuer Wechselkursparitäten hoffte man die Krise in den Griff zu bekommen. Pompidou hatte seinerseits bereits am 10. August 1969 als monetäre Konsequenz aus dem „heißen“ Mai 1968 den Franc um gut 11 % abgewertet.
Damit waren die Schwierigkeiten allerdings nicht behoben, denn das internationale Währungssystem litt unter der Sonderstellung des US-Dollars und der expansiven Währungspolitik Washingtons. Auch die Senkung des Diskontsatzes in Westdeutschland konnte nicht den massiven Kapitalfluss in Richtung Europa und das Anschwellen der Dollar-Reserven bei der Bundesbank verhindern. Hintergrund war, dass die Bundesbank, um das feste Umtauschverhältnis zu bewahren, ständig eingreifen musste, um den US-Dollar im Devisenmarkt zu stützen, also seinen Wert durch massive Dollarkäufe künstlich hoch halten musste125. Die festen Wechselkursparitäten gewährten dem US-Dollar einen aus de Gaulles Sicht völlig überzogenen126 Sonderstatus als Ankerwährung, wobei es der US-Notenbank freistand, auf Eingriffe zur Korrektur der Ursachen dieses immer schnelleren Kapitalabflusses zu verzichten. Die Schieflage der US-Außenhandelsbilanz beruhte auf zahlreichen Ursachen, von denen neben der Ansiedlung von US-Firmen im Ausland und der Entwicklungshilfe die Militärausgaben, besonders für den Vietnamkrieg, massiv zu Buche schlugen. Die Reaktion auf all diese Faktoren war dieselbe, nämlich die im Verhältnis zur Goldreserve exzessive Dollar-Emission. In den europäischen Finanzministerien regte sich Unmut, und Helmut Schmidt bezeichnete das Verhalten der US-Behörden sogar als unverantwortlich und unkorrekt: Anstatt geeignete Maßnahmen zum Abbau des Haushaltsdefizits zu ergreifen, das die Ursache für die hausgemachte Inflation bildete, benutzten die Vereinigten Staaten die Stellung des Dollars als Leitwährung, um ihre Inflation zu „exportieren“ und den übrigen Staaten die ökonomischen Konsequenzen des Vietnamkriegs aufzubürden127. Im Mai 1971 beschlossen die westdeutschen Behörden, die DM floaten zu lassen, allerdings gegen den Widerstand der Franzosen und Italiener, die sich gegen eine Freigabe der Wechselkurse europäischer Währungen sträubten128. Die Lage war angespannt, zumal für die USA, die befürchten mussten, dass die europäischen Zentralbanken ebenso wie de Gaulle im Januar 1965 die Einlösung ihrer Dollarreserven in Gold fordern würden. Die US-Regierung, die sich über die wachsende Macht Europas zunehmend sorgte129, hielt diesen unfreundlichen Akt zwar für eher unwahrscheinlich, empfand ihn aber dennoch als „Damoklesschwert“130. Am 15. August 1971 gab Präsident Nixon ohne vorherige Abstimmung und mit einer gewissen Schroffheit die Entscheidung der USA bekannt, die Einlösungspflicht des Dollars in Gold und „in jede andere Form von Reservemitteln“ aufzuheben und Importwaren mit einem 10 %igen Steuerzuschlag zu belegen, um andere Staaten zur Aufwertung zu drängen. Frankreich reagierte auf diesen Gewaltstreich mit der Einrichtung eines doppelten Devisenmarktes, in dem Handelsgeschäfte zu festen Wechselkursen erfolgten, Finanzgeschäfte jedoch zu flexiblen. Alle übrigen Zentralbanken Europas, darunter auch die Bundesbank, entschieden sich für das Floating131.
Paris ebenso wie Bonn, deren Währungen am Devisenmarkt gewiss nicht in der gleichen Situation waren, die jedoch beide die Rückkehr zu einem stabilen System mit offiziellen Paritäten anstrebten, engagierten sich aktiv für eine Reform des internationalen Währungssystems. Pompidou wehrte sich zudem, wie er Nixon anvertraute, vehement dagegen, „den Dollarstandard gegen den DM-Standard einzutauschen, den wir unter keinen Umständen hinnehmen werden“132. Beim Gipfeltreffen zwischen Nixon und Pompidou am 13./14. Dezember 1971 auf den Azoren vertrat der französische Staatspräsident auch den europäischen Standpunkt; das Treffen endete mit der grundsätzlichen Einigung darauf, den Dollar gegen Gold abzuwerten und bestimmte andere Währungen aufzuwerten133. Wenige Tage später kam am 18. Dezember in Washington das nach dem Konferenzgebäude benannte Smithsonian Agreement zustande. Es ermöglichte den zehn wichtigsten westlichen Industrienationen, das Floating zu beenden und neue Währungsparitäten festzulegen. Auf Drängen der europäischen Staaten wurde daraufhin der Dollar erstmals seit 1934 um 8 % gegen Gold abgewertet und darüber hinaus die DM um 13,5 % gegenüber dem Dollar (und um 4,6 % gegen Gold) aufgewertet, die Goldparitäten des Franc und des Pfund Sterling wurden jedoch beibehalten. Trotz der Abschaffung des Steuerzuschlags auf US-Importe änderte sich dadurch nicht viel, denn die Vereinigten Staaten waren nicht verpflichtet, die Goldkonvertibilität des Dollars wieder aufzunehmen134.Im deutsch-französischen Vergleich war Westdeutschland unbestreitbar zum „Wirtschaftsriesen“ geworden, auch wenn Frankreich sich nach dem Azoren-Gipfel mit dem Gedanken tröstete, Bonn habe sich dort im Vergleich zu Paris nach wie vor als „politischer Zwerg“ erwiesen, denn letztlich komme es ja auf den Wortführer an (wobei es den engen technischen Austausch zwischen Deutschland und den USA geflissentlich außer Acht ließ). Eine weitere Entscheidung des Gipfels im Smithsonian Institute war die Bandbreitenerweiterung von bisher 0,75 auf 2,25 % ober- und unterhalb des Dollarkurses, mit der ein breiter „Tunnel“ entstand, in dem die Währungen frei fluktuieren konnten, ohne dass die Zentralbanken zum Eingreifen verpflichtet waren. Die nach wie vor am Aufbau einer Wirtschafts- und Währungsunion gemäß Werner-Plan interessierten EWG-Mitgliedsstaaten einigten sich daraufhin auf ein kollektives System, das ihre Währungen im Verhältnis zueinander stabilisieren sollte, denn aufgrund ihrer Handelsöffnung reagierten sie empfindlicher auf Wechselkursschwankungen, die sie noch immer mit der Hyperinflation der Zeit zwischen den Weltkriegen assoziierten135.Am 21. März 1972 beschlossen sie, die Bandbreiten ihrer Währungen untereinander um die Hälfte zu kürzen, und schufen so die „Währungsschlange im Tunnel“. Am 12. März 1973 entschieden die EWG-Staaten nach der zweiten Abwertung des US-Dollars und der Schließung der Devisenmärkte durch die europäischen Zentralbanken, den Dollar künftig nicht mehr zu stützen, und bekräftigten, die Schlange habe „den Tunnel verlassen“, ohne ihren Zusammenhalt als Gruppenfloating aufzugeben. Dies war der eigentliche Todesstoß für den Gold Exchange Standard136 und der Auftakt zu einer hartnäckigen Krise mit endgültiger Freigabe der Wechselkurse im Jamaika-Abkommen, das am 6. Januar 1976 in Kingston die Aufgabe des Goldstandards vollzog. Genau zu diesem Zeitpunkt bekam die Bundesbank allerdings das monetäre Geschehen in den Griff und schlug einen extrem restriktiven Kurs ein, der unmittelbar in die Vorgehensweisen von Banken und Investoren eingriff137.
In dieser neuen Konstellation war der Wert der Währungen nur noch von Angebot und Nachfrage an den Devisenmärkten abhängig, was in der Bundesrepublik die Sorge vor einem Abdriften in die Inflation schürte. Immerhin schuf die Währungsschlange eine relativ stabile Zone in Europa, doch wurden trotz der Bemühungen, die Realignments zu beschränken, die Phasen mit stabilen innereuropäischen Wechselkursen immer kürzer. Aufgrund der drückenden Belastungen konnten sich einige schwache Währungen wie die italienische Lira und das Pfund Sterling nicht lange im schmalen „Tunnel“ halten. Auch der französische Franc musste im Januar 1974 aus der Schlange ausscheiden; er kehrte im Juli 1975 zurück, allerdings nur für rund zehn Monate138. Obwohl ihre Ursachen weiter zurücklagen, war die zunehmende Instabilität des Währungsgefüges auch eine direkte Folge der Ölkrise von 1973.
Das Jahr 1973 sollte in der Bundesrepublik eigentlich im Zeichen der Feiern zum 25. Geburtstag der DM und des sagenhaften Wohlstands der Nachkriegszeit stehen, war jedoch für die Gesamtheit der Industrienationen zweifellos ein „annus horribilis“139, ein „Schicksalsjahr“, „ein Jahr der Umwälzungen und Extreme“140. In der Geschichte Frankreichs und der Bundesrepublik hinterließ es einen tiefen Einschnitt, als man sich der „Grenzen des Wachstums“141 bewusst wurde und mit dem Ende eines „goldenen Zeitalters“ „nach dem Traum immerwährender Prosperität“ eine „Ära der langfristigen Schwierigkeiten“142 einsetzte. Nach dem Ausbruch des Jom-Kippur-Kriegs am 6. Oktober 1973 setzten die Mitgliedsstaaten der OPEC (Organisation erdölexportierender Länder) in diesem vierten arabisch-israelischen Nahost-Konflikt auch Erdöl als Waffe ein: Wegen der israelfreundlichen Politik der westlichen Industriestaaten verhängten sie einen Lieferboykott gegenüber den USA und den Niederlanden und drosselten die Liefermengen für die übrigen Abnehmerländer. Die Folge war ein massiver Preisanstieg (Vervierfachung des Ölpreises je Barrel aus Saudi-Arabien zwischen Oktober 1973 und April 1974)143. Obwohl erst die schwierige Versorgungslage den hochentwickelten Ländern abrupt ihre Abhängigkeit von fossiler Energie klarmachte, hatten sich die Probleme bereits im Vorfeld abgezeichnet144. Darüber hinaus löste die Ölkrise von 1973 beträchtliche inflationäre Effekte aus und erschütterte die Ökonomien durch das Zusammentreffen von Inflation, Rezession und einer Störung der internationalen Devisenflüsse. Hinzu kam eine Abschwächung der Wachstumsrate in der industriellen Produktion aufgrund geringerer Investitionen. Die Preiserhöhung war eine direkte Folge der steigenden Kosten importierter Rohstoffe (wegen der starken sowjetischen Nachfrage infolge mehrerer Missernten auch im Nahrungsmittelsektor). Die Rezessionsspirale resultierte aus der Beschneidung der Einkommen und demzufolge sinkenden Ausgaben privater Haushalte und Unternehmen. In den Einfuhrländern rutschten die Zahlungsbilanzen stark ins Minus und die Petrodollars mussten durch einen vom IWF erfundenen neuen Mechanismus recycelt werden145. Für Deutschland und Frankreich, aber auch für andere europäische Staaten, kam es dadurch während der ganzen 1970er-Jahre tendenziell zur Stagflation, d.h. einer Kombination aus Inflation, niedrigen Wachstumsraten und hoher Arbeitslosigkeit. In der Bundesrepublik stieg die Inflationsrate von 1969 bis 1973 von 2,1 % auf 7 %, in Frankreich von 6,5 % (1969) auf 13,7 % (1974). Die Zahl der Arbeitslosen stieg in der Bundesrepublik von 179.000 (1969) auf 582.000 im Jahr 1974 und schnellte dann bis 1975 nochmals hoch, auf 1.074.000. In Frankreich wuchs die Arbeitslosenzahl von 1970 bis 1974 von 110.000 auf 689.000 und überstieg 1975 die Millionengrenze. Die Wachstumsrate, die 1973 in der Bundesrepublik noch + 5 % betragen hatte, stürzte bis 1975 auf – 1,3 %.
Auch die psychologische Wirkung der Ölkrise und der damit verbundenen Verknappung war deutlich spürbar, besonders als die Bundesregierung an vier „autofreien“ Sonntagen im November und Dezember 1973 ein bundesweites Fahrverbot verhängte146. Der spektakuläre Anblick leerer Autobahnen machte den Menschen unvermittelt bewusst, wie abhängig und angreifbar die europäischen Staaten waren: Die Euphorie der „68er“ wich Skepsis und Angst. Insofern gab die Ölkrise in zweierlei Hinsicht den Anstoß zur Erforschung alternativer Energiequellen, die den letzten Abschnitt des Jahrhunderts prägte. Die Krise führte einerseits zu einer Ernüchterung angesichts der Erkenntnis, dass die absolute Dominanz des Erdöls die Volkswirtschaften in Wahrheit gefährdete, und stellte andererseits eine Trendwende dar, weil die neue Lage den Glauben an ein grenzenloses Wachstum zutiefst erschütterte. An seine Stelle trat eine neue Sorge um die Umwelt, in der Bundesrepublik vor allem in Gestalt von Angst vor der Atomenergie. Diese „sozial-kulturelle Zäsur“147 betraf zwar Frankreich und Westdeutschland gleichermaßen, doch schätzte man die ökologischen Risiken in beiden Ländern sehr unterschiedlich ein. Dahinter standen diverse Ursachen, darunter staatliche Strategien wie die Förderung von Atomkraftwerken in Frankreich, Unterschiede im bürgerschaftlichen Engagement, aber auch, sicherlich in Bezug auf die Bundesrepublik, die von einer großen Zuversicht begleiteten, bereits erfolgten ökonomischen und politischen Investitionen in eine erfolgversprechende Gestaltungsfähigkeit der Zukunft. Der Glauben an die Steuerbarkeit des ökonomischen und politischen Systems wurde mit einer Brutalität erschüttert, deren Ausmaß mit der zuvor herrschenden Sakralisierung der Machbarkeit und Verlässlichkeit des Wachstums durchaus vergleichbar war.
Umso auffallender ist, dass in dieser Umbruchphase dem brillanten, aber von Zweifeln geplagten Willy Brandt der „Macher“ Helmut Schmidt ins Kanzleramt folgte. Brandts Mandat endete vorzeitig mit seinem Rücktritt am 6. Mai 1974, zumindest vordergründig ausgelöst am 24. April durch die Verhaftung seines persönlichen Referenten im Kanzleramt, Günter Guillaume, der zugleich hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR war148. Helmut Schmidt, zuvor Verteidigungs-, Finanz- und „Superminister“ für Wirtschaft und Finanzen, stellte seine künftige Vorgehensweise von Anfang an unter das Motto „Kontinuität und Konzentration“ und kündigte an, die Regierung werde zwar soweit möglich die sozialliberalen Koalitionsprinzipien beibehalten, sich jedoch auf das konzentrieren, „was jetzt notwendig ist“, und „anderes beiseite [lassen]“ 149. Das Wort „Reform“ legte innerhalb weniger Monate den Beigeschmack des Wagemuts ab und wurde zum Inbegriff für Umsicht und unpopuläre Sparsamkeit150.
Diesem Umschwung im Kanzleramt entsprach praktisch auf den Tag genau ein Wechsel im Élysée-Palast, als nach Georges Pompidous Tod am 2. April der 40-jährige Liberale Valéry Giscard d’Estaing zu dessen Nachfolger gewählt wurde151. Gemeinsam war den beiden neuen Amtsinhabern, dass sie aufgrund ihrer Erfahrung in Wirtschaft und Finanzen die wirtschaftlichen Herausforderungen sehr präzise einschätzen konnten, insbesondere das Dilemma, das den Staatsund Regierungschefs der EWG zu schaffen machte: Sollte man „die Nachfrage begrenzen, um die Inflation zu bremsen, und dabei eine höhere Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen, oder den Arbeitsmarkt mit einer Produktionserhöhung stärken, dabei aber womöglich eine erneute Inflation riskieren?“152 Die Antwort lautete in Westdeutschland und Frankreich ähnlich, zumal Schmidt und Giscard in engem Kontakt standen und sich bei Bedarf telefonisch abstimmten. 1974 beschloss man zunächst eine Belebung des Arbeitsmarkts durch die Förderung bestimmter Sektoren wie der Bauwirtschaft. In der Bundesrepublik geschah dies ab September mit dem Konjunktur-Sonderprogramm auf Basis einer expansiven Geldpolitik der Bundesbank, die mit der Senkung des Diskontsatzes das Geld „billiger“ machte, und in Frankreich mit Fördermaßnahmen, mit denen man die unangenehmen Nebeneffekte der von Finanzminister Jean-Pierre Fourcade geplanten „Abkühlung der Inflation“ zu mildern hoffte. Beide Länder beobachteten mit Sorge den Anstieg einer von konjunkturellen Schwankungen unabhängigen Arbeitslosigkeit, die ab 1974 als neues Phänomen die Wirtschaftslage verschärfte. Benachteiligt war Frankreich bei der Inflationsrate, die doppelt so hoch war wie beim deutschen Nachbarn und zeitweilig über 13 % gegenüber 7 % (in der BRD) lag. Giscard d’Estaing entschied schließlich, es sei genug um den heißen Brei herumgeredet worden, und holte am 25. August 1976 mit Professor Raymond Barre einen der „fähigsten Wirtschaftswissenschaftler Frankreichs“153 ins Boot, dessen Name bis heute im kollektiven Gedächtnis mit einem rigorosen Sparprogramm verknüpft ist. Dieser Schritt kam auch Schmidt entgegen, der sich über die Inflationsspirale im Nachbarland sorgte. Die Bundesbank erkannte die Grenzen der üblichen Instrumente und räumte 1976 in einer Publikation ein, dass „seit einiger Zeit Zweifel an Boden gewinnen“, obwohl „der Anspruch weiterhin besteht, die Wirtschaft in die Nähe eines Wachstumsgleichgewichts bei Vollbeschäftigung und Geldwertstabilität zu dirigieren“154. Der Barre-Plan sah drei sukzessive Phasen vor: Einfrieren der Preise mit Anhebung der Sozialbeiträge, Senkung der Mehrwertsteuer und gezielte Förderung bestimmter Sektoren. Priorität hatte dabei die Stützung des Franc und des außenpolitischen Gleichgewichts, während die Inflation als Folge einer übermäßigen Nachfrage und damit eines allzu schnellen Anstiegs der Löhne und Gehälter angesehen wurde155. Die Bundesregierung hielt in dieser Phase an der „Konsolidierung der Staatsfinanzen“ fest und erhöhte dazu die Sozialabgaben, während die Bundesbank zu einer restriktiven Geldpolitik zurückkehrte. Trotz der unterschiedlichen Ergebnisse und der auffälligen kurzfristigen Zeitverschiebungen verfolgten beide Staaten in diesen Jahren offenbar den gleichen Mittelweg zwischen einer angebots- und einer nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik, schwankten dabei jedoch wiederholt zwischen diversen Schwerpunkten. Beiden Regierungen trug dies den Vorwurf des Wankelmuts und der Unberechenbarkeit ein und trieb vor allem in Frankreich die Gewerkschaften auf die Barrikaden156. Die Zugehörigkeit zu verschiedenen politischen Lagern gab dabei nicht den Ausschlag, zumal Helmut Schmidt eine Kurskorrektur der sozialliberalen Wirtschaftspolitik vornahm; durch sein Pochen auf die wichtige Rolle von Unternehmensgewinnen verstieß er sogar gegen ein Tabu der Linken, insbesondere in Frankreich. Schon bei seinem Amtsantritt hatte er gemahnt: „Angemessene Erträge sind Voraussetzung für die notwendigen Investitionen der Wirtschaft“, mit anderen Worten: „Ohne Investitionen kein Wachstum; ohne Investitionen keine Arbeitsplatzsicherheit, keine höheren Löhne und auch kein sozialer Fortschritt“157. Bis heute lernen Wirtschaftsstudenten an französischen Hochschulen das „précepte de Schmidt“: „Die Gewinne von heute sind die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von übermorgen“. Jacques Delors bezeichnete diese Formel später als Schlüssel zum Erfolg dieser deutschen Wirtschaftspolitik, den jede französische Regierung der 1970er-Jahre „einzuholen“ versprach. In Frankreich galt Schmidt zwar als eiskalter Technokrat, doch war er in erster Linie Pragmatiker, der den Stellenwert gewisser Sachzwänge erkannte und allergisch reagierte auf „das Abstrakte, das Akademische, das auf der Stirne zur Schau getragene Grundsätzliche, in vielen Fällen nichts anderes als ein Brett vor dem Kopf“158.
Dabei vertraten Schmidt und Giscard, die aus unterschiedlichen Milieus stammten, bei weitem nicht dieselbe Weltsicht. Ihre enge Zusammenarbeit bildete jedoch in der außenpolitischen Praxis ein Novum, wobei der Akzent ebenso auf der Mobilität der Spitzenpolitiker lag wie auf ihren direkten persönlichen Beziehungen und auf Begegnungen in unterschiedlichen Konstellationen von Zweiergesprächen bis zu multilateralen Treffen159. Das enge Verhältnis zwischen den Männern an der Spitze Deutschlands und Frankreichs beruhte in dieser Phase ebenso sehr auf Zufällen wie auf persönlicher Sympathie160 und der Erkenntnis, dass eine Instrumentalisierung dieses Einvernehmens sich auszahlen würde. Die Folge waren vermehrte inoffizielle Treffen vorwiegend in den Privatwohnungen von Schmidt und Giscard; die persönliche Freundschaft wurde bei gemeinsamen Pressekonferenzen und Interviews lautstark betont, beispielsweise 1975 beim Start eines deutsch-französischen Satelliten. Schmidt und Giscard duzten sich, sprachen über gemeinsame Schachpartien und suggerierten eine Vertrautheit, die sich vom feierlichen Auftritt Adenauers und de Gaulles in der Kathedrale von Reims klar abhob. Sie präsentierten der Öffentlichkeit eine schlichte Freundschaft zwischen Staatsmännern, ein Bild der Selbstverständlichkeit und des technischen Fortschritts161. Dass man beiden ein gewisses Maß an Arroganz und Selbstüberschätzung unterstellte, verstärkte noch den Eindruck eines subtilen Gleichgewichts zwischen zwei elitär denkenden Männern unterschiedlicher Herkunft: auf der einen Seite der französische Technokrat, Spross einer großbürgerlich-liberalen Familie und Vertreter eines bestimmten Leistungssystems, und auf der anderen Seite der deutsche Sozialdemokrat, Lehrersohn aus kleinbürgerlichem Hause und studierter Volkswirtschaftler, der sich in der Partei hochgearbeitet hatte.
Diese Zeit gehörte zu den Phasen in den politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern, in denen man die Zwänge des Élysée-Vertrags gar nicht benötigte. Im Rahmen der kontinuierlichen Abstimmung auf höchster Ebene und der bilateralen Konsultationen diverser Ministerien einschließlich der halbjährlichen Gipfeltreffen zeigte sich allmählich die wahre Herausforderung für die später als deutsch-französisches „Tandem“ bezeichnete Allianz: die Kenntnis der Wahrnehmungen und Schwierigkeiten des Partners und ihre Berücksichtigung bei den eigenen politischen Ansätzen. Dieses Unterfangen war nicht immer erfolgreich, zumal die schwere Weltwirtschaftskrise dazu beitrug, dass jedes Land in erster Linie seine eigene Haut zu retten versuchte. Die von beiden Staaten gemeinsam angestrebte Schaffung problemorientierter Konsensräume führte jedoch – überwiegend auf Betreiben von Schmidt und Giscard – zur Gründung des Europäischen Rats und legte den Grundstein für die später als G7 bezeichneten jährlichen Gipfeltreffen der wichtigsten Industrienationen, erstmals im November 1975 in Rambouillet. Der Europäische Rat sollte in erster Linie die Entscheidungsfähigkeit der neun EWG-Mitgliedsstaaten verbessern und die wirtschafts- und währungspolitische Annäherung zwischen ihnen fördern. Er bildete zudem eine wichtige Etappe im Aufbau der gemeinschaftlichen Institutionen162. Die G7-Treffen trugen den globalen wirtschaftlichen Verflechtungen, die sich bei der Krise 1971–1973 in aller Härte gezeigt hatten, ebenso Rechnung wie der unverzichtbaren Abstimmung mit den US-Behörden, und zwar jenseits der Notenbanken auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Im Nachhinein kritisierte Schmidt diese Gipfeltreffen als formeller und weniger effizient als geplant, was seiner Meinung nach an der Haltung der aufeinanderfolgenden US-Präsidenten beruhte, allen voran Jimmy Carters, der 1977/1978 Druck auf die Bundesrepublik ausübte, sie solle zusammen mit Japan die Rolle der „Lokomotive“ der Weltwirtschaft übernehmen, und zwar mit einem – inflationsfördernden – staatlichen Konjunkturprogramm163.
Im Kontext dieses Streits zwischen Westdeutschland beziehungsweise Europa und den USA, und nicht nur im Hinblick auf die Realisierung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, ist die Gründung des Europäischen Währungssystems (EWS) zu sehen. Das EWS bleibt in der Erinnerung als das „große Werk“ von Helmut Schmidt, dessen Regierung aus den Bundestagswahlen 1976 erneut als Sieger hervorging, und Giscard d’Estaing, dessen Parteienbündnis 1978 überraschend die Parlamentswahlen gewann. Innerhalb einer Gesamtstrategie für eine größere Selbstbestimmung Europas liefen zwei nationale Bestrebungen zusammen: auf deutscher Seite der Schutz der zu einem Fünftel vom Export abhängigen Arbeitsplätze vor der bei allen Schwankungen steigenden Tendenz der DM164, und auf französischer Seite die Rückkehr zu festen Wechselkursen, jedoch mit einer komplexeren Struktur als der von Deutschland angeführten Währungsschlange, die den Ländern mit schwacher Währung nicht ausreichend Spielraum für ihre Währungspolitik einräumte165. Die Gründung des EWS zeichnete sich durch zwei Besonderheiten aus: wechselseitige Zugeständnisse und eine spezielle Art der Entscheidungsfindung. Das Zugeständnis der Bundesrepublik war die Abkehr von dem „Ökonomisten“-Ansatz, der die Beseitigung der Divergenzen zwischen den Nationalwirtschaften als Vorbedingung für ein gemeinsames Währungssystem ansah, durch die Annäherung an die Haltung Frankreichs, welche der Vorstellung der „Monetaristen“ entsprach und eine rasche Währungsunion anstrebte, weil sie als „Motor“ für eine wirtschaftspolitische Angleichung der Staaten dienen sollte. Schmidts gelegentlich etwas schematisch dargestellter „Kurswechsel“166 beruhte überwiegend auf seiner Enttäuschung über fehlende Währungssignale aus den USA, aber auch auf seinem zunehmend europäischen Denken167. Das Zugeständnis von französischer Seite war die Aufgabe von Giscards ursprünglicher Idee, die Länder mit starker Währung gleichermaßen zur Intervention zu verpflichten, indem man den ECU als Währungskorb ins Zentrum des Mechanismus stellte. Da die Bundesbank sich jedoch sträubte, die Zukunft der DM vom Mittelwert der teilnehmenden nationalen Währungen abhängig zu machen, willigte Frankreich schließlich ein, ein Paritätengitter ähnlich der Schlange beizubehalten, dem ECU eine untergeordnete Funktion zu geben und einen Indikator einzusetzen, der bei einer bestimmten Divergenz entweder nationale Maßnahmen auslöste oder Konsultationen über Anpassungen in Gang setzte168. Die zweite Besonderheit bei der Einführung des EWS war der stark abgegrenzte bilaterale Rahmen, in dem abseits der etablierten Entscheidungswege und mit höchster Diskretion – nach Ansicht mancher mit „staatsstreichähnlichen Zügen“169 – im Laufe der Jahre 1977/1978 ein Plan ausgearbeitet und den Partnern der Gemeinschaft dann beim Europäischen Gipfel in Kopenhagen am 7./8. April 1978 fix und fertig präsentiert wurde. Dahinter steckte die Absicht, jedem Widerstand seitens der Bürokraten nicht nur in Großbritannien, sondern auch im deutschen Wirtschaftsministerium zuvorzukommen170. Doch kaum hatte Europa dieses neue Instrument eingeführt, stürzte 1979 die zweite Ölkrise die sich gerade erholende Wirtschaft erneut in eine Rezession.
Wirtschaftlich und währungspolitisch waren die 1970er-Jahre in mehrfacher Hinsicht durch Annäherung und Transfers zwischen Deutschland und Frankreich geprägt. Herausragend war sicherlich die liberale Wende in Frankreich ab 1978 unter Raymond Barre, die langfristig als „Umkehrung“ der französischen Wirtschaftspolitik seit der Libération gewertet werden kann. Selbst die Sozialisten knüpften 1983, d.h. zwei Jahre nach der Wahl Mitterrands, an die Grundsätze der liberalen Ökonomie an171. Die drei Komponenten dieses Umschwungs – Preisfreigabe, ehrliche Preispolitik der Staatsbetriebe und Wiederbelebung des privaten Sparens – bewirkten eine Annäherung an den in Westdeutschland praktizierten Wettbewerb. Innerhalb der Linksparteien färbte die Kultur der SPD auch auf die französischen Sozialisten ab, und zwar auf dem Umweg über die Konfrontation zwischen dem eher im rechten Flügel angesiedelten Sozialdemokraten Schmidt und den französischen Sozialisten, die noch Mitte der 1970er-Jahre allein den Begriff „Sozialdemokrat“ als Beleidigung aufgefasst hatten.
Trotz der zunehmend ähnlichen Wirtschaftskultur blieben unterschiedliche Ergebnisse und gewisse Unstimmigkeiten über die ökonomische Praxis bestehen, speziell im Hinblick auf das monetäre Instrument: Paris setzte nach italienischem Vorbild zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit weiterhin auf Abwertung, die dévaluation compétitive mit dem kurzfristigen Ziel von Exportgewinnen. In der Bundesrepublik hingegen sah man die mehrfachen Aufwertungen (1961, 1969, 1971 und 1973) als Nachteil, zumal die europäischen Partner auf keine davon mit Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen reagiert hatten. Später verlegte sich Frankreich auf die désinflation compétitive172, die Bekämpfung der Inflationsrate zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit. Bezeichnend ist der Kontext, in den die sukzessive Einführung eines europaweiten währungspolitischen Instruments eingebettet war: in der Bundesrepublik die innenpolitische Krise und Bedrohung des Rechtsstaats durch den Terrorismus der „bleiernen Jahre“, aber auch die allen Gegenstimmen173 zum Trotz gemachten Fortschritte im europäischen Aufbauprozess; die Erweiterung um die ehemaligen Diktaturen in Südeuropa und die ewige Frage nach der Finanzierung der Gemeinschaft, durch die Margaret Thatcher Deutschland und Frankreich unabsichtlich zum Schulterschluss veranlasste. Ein weiterer Aspekt war der transatlantische Kontext, denn Frankreich und Westdeutschland gaben sich alle Mühe, ihre spezifischen Interessen und politischen Entscheidungen gegenüber den USA durchzusetzen. Aus dieser von Schmidt und Giscard d’Estaing geprägten Zeit geblieben ist auch das Bild der Kooperation zweier Technokraten, die mit gegenseitiger Unterstützung die Glaubwürdigkeit der ihnen anvertrauten Staaten zu verbessern suchen. Die Frage, ob diese Kooperation auch eine Seele besaß, stellte sich im Mai 1981 nach der Wahl François Mitterrands als Präsident der Republik.
Nachdem Schmidt seinen Freund Giscard im Wahlkampf bei der Präsidentschaftswahl 1981 massiv unterstützt hatte, wäre es naiv gewesen zu glauben, die deutsch-französische Entente würde von der Zugehörigkeit zum selben aus der Arbeiterbewegung hervorgegangenen politischen Lager noch mehr profitieren, weil das Verhältnis zwischen dem sozialdemokratischen Bundeskanzler und dem Chef der sozialistischen Partei Frankreichs, der am 10. Mai in den Élysée-Palast einzog, automatisch noch inniger sein müsse. Mitterrand stand jedoch eher Brandt nahe, und mehrere seiner Standpunkte schon als Oppositionsführer in den 1970er-Jahren hatten Schmidts Unwillen erregt, besonders das Bündnis mit den Kommunisten, das als Union de la gauche Stimmen einbringen sollte. Vor allem aber das Wirtschaftsprogramm des neuen Staatschefs, dessen Wahlversprechen der „Wandel“174 gewesen war, beurteilte Schmidt als äußerst gewagt. Die Mitterrands Regierung unter Führung von Pierre Mauroy im ersten Amtsjahr gewährte Schonfrist, der état de grâce (wörtlich: Stand der Gnade), war von zahlreichen Reformen geprägt, die ihre Idealvorstellung von der Demokratisierung spiegelten175. Im Rahmen umfassender Verstaatlichungen zur engmaschigeren Investitionskontrolle und Umstrukturierung der Industrie bemühte sich die Regierung, durch Konsum gekoppelt mit Sozialförderung die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Der Versuch, durch steigende Löhne und Gehälter und mehr Sozialleistungen die Kaufkraft zu erhöhen, verschlang jedoch Unsummen in Form von Subventionen für notleidende Sektoren und hatte zudem nicht einmal den gewünschten Effekt, da die rapide steigenden Lohnkosten den französischen Export schwächten und das Handelsbilanzdefizit weiter verschärften. Die Inflation blieb 1981 auf dem hohen Stand von 14 % und wog die Lohnerhöhungen auf. Die sehr bald einsetzende Ernüchterung hatten die beunruhigten deutschen Partner erwartet, jedoch den Standpunkt vertreten, ihnen stehe es nicht zu, den französischen Partnern die Leviten zu lesen. Schon am Tag nach der Wahl Mitterrands stützte die Bundesbank den Franc durch massive DM-Abverkäufe, und Schmidt „sagte unaufgefordert unsere weitere Hilfe zu“176. Im Oktober 1981 und im Juni 1982 war die französische Regierung zur Abwertung des Franc gezwungen, von der nicht einmal der französische Export profitierte. Jacques Delors sprach bereits im November 1981 von der Notwendigkeit, eine „Reformpause“ einzulegen. Unmittelbar nach der zweiten Abwertung 1982 beschloss man einen Preis- und Lohnstopp.
Nachdem die Niederlage bei den Kommunalwahlen und eine dritte Abwertung die Linke vom „Stand der Gnade“ in den der Ungnade177 gestürzt hatten, befand sich Mitterrand im März 1983 vor der heiklen Alternative, aus dem EWS auszutreten oder vom linken Kurs abzuweichen. Er entschied sich für eine strikte Sparpolitik als einziges Mittel, Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, und setzte dabei zugleich auf die Modernisierung und Umstrukturierung des französischen Produktionsapparats. Er entschied sich für europäische Disziplin und konvertierte damit de facto zum Liberalismus178. Interessant aus der Perspektive der deutsch-französischen Beziehungen ist, dass Helmut Kohl entgegen den Empfehlungen aller Berater Mitte März die Aufwertung der DM innerhalb des EWS beschloss, um Frankreich in der Not beizustehen. Obwohl diese von Jacques Delors als Prüfstein für die deutsch-französische Partnerschaft gewertete Geste später in den bilateralen Beziehungen nie wieder erwähnt wurde, meint Kohl, Mitterrand sei sehr beeindruckt gewesen, „dass dieser Deutsche für ihn seine eigenen Konten verschlechterte“179.
In Bezug auf Privatisierungen zeigte sich in diesen zwei Jahren eine deutliche Diskrepanz. Während Frankreich auch in wirtschaftlicher Hinsicht eine Sonderstellung einnahm180, hatte sich die sozialliberale Koalition in der Bundesrepublik bereits für einen deflationären Sparkurs entschieden, der Schmidt in der SPD zum Außenseiter machte. Im Dezember 1981 leitete sie die Sanierung des Staatshaushalts ein, nachdem der Sachverständigenrat das Missverhältnis zwischen den steigenden öffentlichen Ausgaben und der weit geringeren Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials gnadenlos aufgedeckt hatte. Mit einem Mal beurteilte man die Lage insgesamt in einem schlechten Licht. Während man sie im Inland in Bausch und Bogen der Wirtschaftspolitik des Kanzlers anlastete, war dieser in den Augen seiner ausländischen Partner im Laufe der Jahre zum leuchtenden Vorbild in Sachen Krisenbekämpfung geworden. Vom Ausland bewundert, stand Schmidt im eigenen Land unversehens mit dem Rücken an der Wand181. Die Bundesrepublik war seit dem zweiten Ölpreisschock 1979 fest im Griff einer Rezession, gekoppelt mit galoppierender Arbeitslosigkeit. Nach der Expansion des Sozialstaats bis 1974 kam es nun in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre zur Verlangsamung des Wachstums; die Zahl der Sozialleistungsempfänger stieg konstant. Die Bundesrepublik machte eine so rasant zunehmende Finanzkrise des Sozialetats durch, dass sie 1982 bereits als „Sanierungsfall“ galt. Von 1980 bis 1982 verdoppelte sich die Zahl der Arbeitslosen auf mehr als zwei Millionen; nicht saisonbereinigt erreichten die Zahlen etwa zeitgleich mit Frankreich eine psychologische Schmerzgrenze, wobei die Situation westlich des Rheins prozentual viel gravierender war. In einigen Bereichen standen beide Länder vor ähnlichen Schwierigkeiten: Besonders in Industriesparten wie Kohle und Stahl, Textil oder Werften waren kostspielige Sozialpläne nicht nur ein Zeichen der Krise, sondern auch des Phänomens, das heute Globalisierung heißt. In der Rückschau ist allerdings ersichtlich, dass die in dieser Zeit vor allem bezüglich Inflation und Geldwert markanten Unterschiede zwischen Frankreich und Westdeutschland tiefer liegende Übereinstimmungen beim Wandel der ökonomischen Strukturen kaschieren. Die französische Inflationsrate war nach wie vor doppelt so hoch wie die westdeutsche, doch verliefen die beiden Kurven weitgehend parallel: Erst 1984 begann sie in Frankreich zu sinken und fiel von 1984 bis 1986 von 7,4 % auf 2,7 %, während die Rate in der Bundesrepublik von 5,2 % (1982) schon ab 1983 wieder auf 3,3 % gesunken war182. In Bonn war das Bündnis von SPD und FDP inzwischen zerbrochen, nachdem der liberale Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff selbst eine katastrophale Bilanz gezogen hatte und Schmidt nach dem Scheitern der Haushaltsdebatten für 1983 am 1. Oktober 1982 und dem konstruktiven Misstrauensvotum im Bundestag mit einer Minderheit dastand. Seine Nachfolge übernahm der Christdemokrat Helmut Kohl, der zunächst im Bundestag mit einer Mehrheit von CDU/CSU und FDP gewählt und dann nach den Bundestagswahlen vom 6. März 1983 im Amt bestätigt wurde. Seine Regierung startete unverzüglich ein erstes Sparprogramm mit dem Abbau von Sozialleistungen und bestimmten Subventionen und der Aussetzung der Rentenanpassungen, gewährte investitionswilligen Firmen zugleich Erleichterungen und versprach eine unternehmensfreundliche Steuerreform. Um die gröbsten Löcher im Etat zu stopfen, wurde zudem am 1. Juli 1983 die Mehrwertsteuer um einen Prozentpunkt angehoben. Gemäß der neuen Sozialpolitik mussten erstmals auch Rentner Krankenkassenbeiträge von 1 %, später 3 % der Rente leisten. Innerhalb weniger Monate schaltete die Bundesrepublik von einer nachfrageorientierten zu einer angebotsorientierten Wirtschaftspolitik um und übernahm dabei die neoliberale Richtung, die wenige Jahre zuvor die Vereinigten Staaten und Großbritannien eingeschlagen hatten. Obwohl das verfügbare Einkommen der Arbeitnehmer zwischen 1983 und 1985 sank, stieg der Konsum dank des wiederhergestellten Vertrauens an183.
Die deutsche und die französische Wirtschaft befanden sich nun in der für die 1980er-Jahre charakteristischen Phase der Disinflation auf Basis der restriktiven US-Geldpolitik mit Erhöhung der Zinssätze, fallender Rohstoffpreise und sinkender Löhne und Gehälter, die in Frankreich vor allem mit der Aufhebung der Lohnindexierung zusammenhingen. Trotz des Abschieds von einigen Gewissheiten, der Veränderung grundlegender wirtschaftspolitischer Parameter und der Notwendigkeit tiefgreifender struktureller Anpassungen zeigte sich nach der Umbruchphase der 1970er-Jahre, dass die Bundesrepublik ihren Modellcharakter im Großen und Ganzen hatte erhalten können, vor allem aus der Sicht ihrer französischen Partner. Unter Helmut Schmidt war diese Tatsache auch im Wahlkampf als innenpolitischer Pluspunkt eingesetzt worden. Die DM blieb auch in den 1980er-Jahren Leitwährung des europäischen Wirtschaftsraums184: Für die Partnerstaaten war diese Lage in den Spekulationsphasen wirtschaftlich unhaltbar, sodass etwa Frankreich verstärkt auf die Schaffung einer gemeinsamen Währung drängte185. Frankreich gelang es nicht, an das frühere Wachstum anzuknüpfen, weil es die Folgen der Politik von 1981/1982 durch einen strikten Sparkurs wettmachen musste. Am allgemeinen Aufschwung im Gefolge wieder sinkender Ölpreise hatte es keinen Anteil186.
Die Konjunkturerholung in der Weltwirtschaft war vor allem in der Bundesrepublik spürbar. Dort zeigte sie sich ab 1984 mit einem Wachstum von 2,6 %, begünstigt durch die für deutsche Exporte förderliche Dollar-Hausse und durch das Abklingen der „Angstpsychose“187 angesichts der Erholung der notleidenden öffentlichen Haushalte, deren Bankrott man ernsthaft befürchtet hatte. Mit viel Glück, aber auch viel Geschick konnte Helmut Kohl verblüffende wirtschaftliche Erfolge für sich verbuchen, die im Ausland viel Anerkennung fanden. Getrübt wurden sie lediglich 1984 durch einen siebenwöchigen Streik der IG Metall, die für die 35-Stunden-Woche kämpfte, sich jedoch letztlich mit 38,5 Wochenstunden zufriedengeben musste. Die westdeutsche Außenhandelsbilanz wies steil ansteigende Überschüsse aus (von + 65,8 Mrd. DM 1984 auf + 146,4 Mrd. DM 1989). Frankreich erlebte in dieser Phase zunächst den liberalen Schwenk der Sozialisten, die in den staatlichen Industriebetrieben weitreichende Umstrukturierungen vornahmen und durch Stellenabbau und mehr Zurückhaltung bei staatlichen Eingriffen den Marktmechanismen mehr Spielraum gewährten. Nach dem Sieg der Konservativen bei den Parlamentswahlen von 1986 kam es schließlich zur ersten Kohabitation, wobei die Regierung mit Privatisierungen und einer Lockerung des Kündigungsschutzes einen ausgeprägt liberalen Kurs einschlug. Die Folgen waren zahlreiche Arbeitskämpfe. In der Bundesrepublik trübten lediglich Währungsturbulenzen und die Besorgnis angesichts des Börsenkrachs im Oktober 1987 das ansonsten heitere Klima der „goldenen“ 1980er-Jahre. Auch von diesen Zwischentiefs erholte man sich schnell und machte im Jahr 1988 sogar ein „kleines Wirtschaftswunder“ aus, begünstigt dadurch, dass die Liberalisierung der Weltmärkte und Steuererleichterungen für Unternehmen zusammen stimulierend auf Produktion und Export wirkten. Das Wirtschaftswachstum Frankreichs war 1988 mit 3,2 % erstmals seit langem ebenso hoch wie die 3,4 % Westdeutschlands. Auch die Inflationsrate war mit 2,7 % sagenhaft niedrig, wenn auch immer noch doppelt so hoch wie in der Bundesrepublik (1,3 %). Nach der Wiederwahl Mitterrands als Staatspräsident konzentrierte sich die Regierung Rocard ohne größere Reibungen auf die Beibehaltung des Wirtschaftswachstums und die Behebung ihrer „großen Baustellen“ bei der Modernisierung des öffentlichen Dienstes und der Hochschulen sowie bei der Finanzierung des Defizits der Sozialversicherung.
Bis zu den Umwälzungen durch den deutschen Vereinigungsprozess zeigte die Qualität von Beziehung und Abstimmung zwischen den westdeutschen und französischen Spitzenpolitikern erneut, dass die Parteizugehörigkeit der jeweiligen Staats- und Regierungschefs eine untergeordnete Rolle spielte. Auch Helmut Kohl und François Mitterrand setzten die engmaschige und umfassende Abstimmung bei ihren häufigen Treffen fort, die ohne lautstarke Freundschaftsbezeugungen im Zeichen gegenseitiger Achtung abliefen. 1984 brachten sie mit ihrem Schulterschluss Margaret Thatcher in der Frage des europäischen Haushalts zum Einknicken und starteten gemeinsame Initiativen mit dem Ziel, die Karre Europa „aus dem Schlamm zu ziehen“, insbesondere durch die beiderseitige Unterstützung Jacques Delors’ bei der Kandidatur für die Präsidentschaft der Europäischen Kommission188.
118 Zur Art der Zäsur vgl. LINDLAR 1997 [425]; RÖDDER 2004 [179], S. 176–178.
119 FRANK 2004 [411]; FOURASTIÉ 1979 [409].
120 RÖDDER 2004 [179], S. 125. Zur Globalsteuerung u.a. ABELSHAUSER 1983 [388], S. 106–116; ABELSHAUSER 2004 [391], S. 175f.
121 POIDEVIN/BARIETY 1982 [265], S. 421.
122 MIARD-DELACROIX 1993 [254].
123 WEIMER 1998 [440], S. 198f.; JAMES 1996 [416], S. 193–197. De Gaulle schrieb seinerseits in seinen Mémoires d’espoir: „Ich werde Frankreich einen vorbildlichen Franc geben, dessen Parität sich nicht ändern wird, solange ich da bin“, DE GAULLE 1970 [54], S. 143. VAÏSSE 1998 [227], S. 407.
124 Zu den verschiedenen DM-Krisen von 1968 bis 1971 EMMINGER 1976 [403], S. 514–526.
125 „Von Ende 1969 bis Ende 1972 erhöhten sich die Währungsreserven der Bundesbank von 26,4 auf 74,4 Milliarden DM, also das Dreifache; die in dieser Reserve enthaltenen Dollarbestände stiegen sogar von 5,9 auf 52,7 Milliarden DM, also auf rund das Neunfache“, WEIMER 1998 [440], S. 235. ABELSHAUSER 1983 [388], S. 158; ABELSHAUSER2004 [391], S. 266–270.
126 Zu seinem Kampf gegen den Dollar 1964–1965 vgl. VAÏSSE 1998 [227], S. 401.
127 SCHMIDT 1987 [97], S. 191–199. Details über die Folgen der Flucht aus dem Dollar in WEIMER 1998 [440], S. 205–209; EICHENGREEN 1997 [401], S. 169 liefert eine für die USA günstigere Analyse; JAMES 1996 [416], S. 205–213 geht im Detail auf die verschiedenen Faktoren ein. Die von der Bundesbank geteilte Analyse Helmut Schmidts über die „Abwehr der importierten Inflation als Daueraufgabe“ bei EMMINGER 1976 [403], S. 537–543. SYLLA 2002 [439], S. 83f. erzählt „the standard story of the breakdown“ des Systems und bemängelt den üblichen Akzent auf der geopolitischen Dimension und dem Verhalten der Nationen, vernachlässigt jedoch die wirtschaftlichen Aspekte des Prozesses. Zur inflationären Wirkung von Handelsbilanz- und Devisenüberschüssen und zur „importierten Inflation“ vgl. ABELSHAUSER 1983 [388], S. 162.
128 Zu den erbitterten internen Verhandlungen, die den neuen isolierten Vorstoß Westdeutschlands Anfang 1971 begleiteten, vgl. JAMES 1996 [416], S. 214–216 („German Unilateralism“). EMMINGER 1976 [403], S. 521 nennt die internationalen Diskrepanzen als Hauptursache des außenwirtschaftlichen Ungleichgewichts 1970/71.
129 SEGRETO in BUSSIÈRE 2003 [398], S. 11–45. Die Haltung der Bundesbank suggerierte den Amerikanern möglicherweise, der „Blessing letter“ sei hinfällig. In dem Schreiben hatte Bundesbankpräsident Karl Blessing sich im März 1967 verpflichtet, keine Einlösung von Dollarreserven in Gold zu fordern, da er hierin den Preis für den Militärschutz der USA sah.
130 SIROËN 1991 [437], S. 144. Zur Währungskrise, einfach und verständlich: S. 144–147. Detaillierte Darstellung in JAMES 1996 [416], S. 205–259.
131 EMMINGER 1976 [403], S. 523–526. Zur Reaktion in Europa vgl. SEGRETO in BUSSIÈRE 2003 [398], S. 31–38.
132 FRANK 1995 [409], S. 359.
133 BUSSIÈRE in BUSSIÈRE 2003 [398], S. 89.
134 EICHENGREEN 1997 [401], S. 170; JAMES 1996 [416], S. 238.
135 EICHENGREEN 1997 [401], S. 196; JAMES 1996 [416], S. 249 urteilt im Übrigen: „The aversion of France for floating came partly from an intellectual tradition of attachment to fixed values […]. It also reflected the conviction that the international monetary order should not be used as a field for the exercise of power politics […], the debate about the reform of the monetary system appeared to be a struggle for world power and influence in a new world order.“
136 „A Final Collapse“, JAMES 1996 [416], S. 241f.
137 KLOTEN 1976 [420], S. 658.
138 Chronologie der Währungsschlange in EICHENGREEN 1997 [401], S. 201. GISCARD D’ESTAING 1988 [69], S. 139–142.
139 RÖDDER 2004 [179], S. 48.
140 WEIMER 1998 [440], S. 244.
141 So ist seit 1972 der jährliche Bericht des Club of Rome betitelt (The Limits of Growth). MEADOWS 1972 [428]; GAURON 1988 [412], S. 10.
142 HOBSBAWM 1995 [153], S. 20–24; LUTZ 1989 [1100].
143 HOHENSEE 1996 [415].
144 BELTRAN in BUSSIÈRE 2003 [398], S. 191–223, hier S. 191.
145 FAUGÈRE/VOISIN 2005 [405], S. 33–41. LELART 2003 [423].
146 Die Maßnahme und ihre Wahrnehmung schildert WOLFRUM 2006 [198], S. 335.
147 RÖDDER 2004 [179], S. 49.
148 BARING 1982 [109], S. 509–511 u. 739–745; WOLFRUM 2006 [198], S. 330–335. Zur Rolle Wehners und den verschiedenen Gründen MERSEBURGER 2002 [169], S. 657–738; Leugers-Scherzberg 2002 [164]; GÖRTEMAKER 1999 [144], insb. S. 574.
149 STÜWE 2002 [36], S. 201.
150 „Reformen sind nur machbar, wenn man sie finanzieren kann“, soll 1974 der Pragmatiker Schmidt den Parteifreunden gesagt haben, WEIMER 1998 [440], S. 259; zum Begriff „Reform“ auch THRÄNHARDT 1996 [192], S. 215; STÖTZEL/WENGELER 1995 [690], S. 186f. Zu den sozialpolitischen Folgen des „Umschwungs des politisch-ideellen Großklimas“ HOCKERTS/SÜSS in HOCKERTS 2006 [1055], S. 958.
151 BERSTEIN/RIOUX 1995 [121], S. 124–126; BECKER 2002 [111], S. 11–33.
152 GAURON 1988 [412], S. 16. Zum „Plan Fourcade“ vgl. auch BECKER 2002 [111], S. 66–74.
153 GISCARD D’ESTAING 1991 [70], S. 133.
154 KLOTEN 1976 [420], S.652. Übersicht der stabilisierungspolitischen Maßnahmen 1968–1975: S. 654–657.
155 Einzelheiten zu Theorie und Praxis des Barre-Plans: GAURON 1988 [412], S. 33–37.
156 JÄGER/LINK 1987 [155], S. 19; GAURON 1988 [412], S. 17; BECKER 2002 [111], S. 76.
157 STÜWE 2002 [36], S. 210; JÄGER/LINK 1987 [155], S. 20.
158 Vor dem DGB-Bundeskongress 1978, SCHMIDT 1982 [96], S. 281; MIARD-DELACROIX 1993 [254],S. 28f.
159 BECKER 2002 [111], S. 188f.
160 Was von den Akteuren selbst hervorgehoben wird, SCHMIDT 1990 [98], S. 164–190; SCHMIDT 1996 [99], S. 255–271; GISCARD D’ESTAING 1988 [69], S. 124–161.
161 MIARD-DELACROIX 1993 [254], S. 89; MIARD-DELACROIX 2004 [255]. Porträt in ZIEBURA 1997 [275], S. 260f.
162 Siehe Kap. II. 8. Deutschland und Frankreich als gemeinsamer Motor Europas, S. 307.
163 SCHMIDT 1987 [97], S. 320. In Deutschland war man sich weitgehend einig über den Unsinn der „Lokomotivtheorie“, WEIMER 1998 [440], S. 284. Zum Bonner Gipfel WIEGREFE 2005 [228], S. 243f.
164 Der exportabhängige Anteil der Arbeitsplätze stieg von 1960 bis 1977 von 14,8 % auf 20,5 %, ABELSHAUSER 1983 [388], S. 164. Die Geschichte der Bundesrepublik ist zwar geprägt durch die unbestreitbaren Vorzüge der enger werdenden Verflechtung mit dem Weltmarkt und des Zahlungsbilanzüberschusses, doch die Kehrseite der Medaille sind Abhängigkeit und eine gesamtwirtschaftliche Wohlstandsminderung mit dem „Transfer von realen Gütern an das Ausland, während der Bundesrepublik lediglich Forderungen und Devisen blieben“, ebd., S. 162f. Auch EMMINGER 1986 [61], S. 364; LUDLOW 1982 [426], S. 117–122.
165 EICHENGREEN 1997 [401], S. 208.
166 LUDLOW 1982 [426], S. 63.
167 EMMINGER 1986 [61], S. 364; MIARD-DELACROIX 1993 [254], S. 180; JAMES 1996 [416], S. 298–300.
168 JAMES 1996 [416], S. 302.
169 ZIEBURA 1997 [275], S. 271. Siehe Kap. II. 8. Deutschland und Frankreich als gemeinsamer Motor Europas, S. 307.
170 SCHMIDT 1990 [98], S. 221f.
171 BECKER 2002 [111], S. 78–80.
172 ABELSHAUSER 1983 [388], S. 162. Zur désinflation compétitive FITOUSSI 1992 [408];BRETON/SCHOR 1988 [397]. Siehe Kap. II. 8. Deutschland und Frankreich als gemeinsamer Motor Europas, S. 307.
173 Eine der bemerkenswertesten war der Appel de Cochin, in dem der frühere französische Premierminister Chirac vor der Europawahl 1979 sein dreifaches Nein zu Europa bekräftigte: „zur Politik der Supranationalität, zur wirtschaftlichen Knechtung und zur internationalen Auslöschung Frankreichs“, BERSTEIN 2002 [117], S. 432.
174 BERSTEIN/MILZA/BIANCO 2001 [120]; MIARD-DELACROIX in MOLLER/VAÏSSE 2005 [256].
175 BERNARD 2005 [115], S. 28. Details über die Maßnahmen bei BECKER 2002 [111], S. 262–281. Zu nennen sind z.B. Abschaffung der Todesstrafe am 18. September, Liberalisierung von Personenkontrollen und Legalisierung von 300.000 illegalen Einwanderern im August, Abschaffung des 1970 erlassenen Gesetzes gegen gewalttätige Demonstranten im Dezember, Streichung des „Straftatbestands Homosexualität“ aus dem Strafgesetzbuch im Juli 1982. Zur Liberalisierung der Medien siehe Kap. II. 6. Milieus, Werte und Lebensweisen, S. 259.
176 SCHMIDT 1990 [98], S. 250; MIARD-DELACROIX 1993 [254], S. 97.
177 BECKER 2002 [111], S. 282. Zur Entwicklung des Wechselkurses DM/Franc siehe Dokumente/Documents 2000 [11], S. 79.
178 BERNARD 2005 [115], S. 36; BERSTEIN/MILZA 2005 [119], S. 244.
179 KOHL 2005 [81], S. 111.
180 COLOMBANI/PORTELLI 1995 [127], S. 179.
181 In der Katastrophenstimmung kam die Kritik von allen Seiten, von Wirtschaftsexperten und selbst von Medien, die wie „Der Spiegel“ der sozialliberalen Regierung wohlgesinnt waren, WEIMER 1998 [440], S. 306.
182 Als Frankreich 1986 bei 2,7 % angelangt war, betrug die Inflation in der Bundesrepublik null.
183 SCHMIDT M. G. 2005 [1064]; WEIMER 1998 [440], S. 319f.; BERSTEIN/MILZA 2005 [119], S. 60.
184 Die DM-Forderungen der Banken am Euromarkt und die DM-Verbindlichkeiten verdoppelten sich zwischen 1980 und 1888, WEIMER 1998 [440], S. 337. Zu den Irritationen DYSON/FEATHERSTONE 1999 [285], S. 25.
185 Siehe Kap. II. 8. Deutschland und Frankreich als gemeinsamer Motor Europas, S. 307.
186 BECKER 2002 [111], S. 325.
187 WEIMER 1998 [440], S. 322. Das Defizit der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) sank gleichmäßig von 56,4 Mrd. DM 1983 auf 36 Mrd. DM 1986. Der Abbau erfolgte mehr infolge von Ausgabenkürzungen als durch Erhöhungen von Steuern und Sozialabgaben.
188 KOHL 2005 [81], S. 285; LAPPENKÜPER 2011 [250]. Siehe Kap. II. 8. Deutschland und Frankreich als gemeinsamer Motor Europas, S. 307.