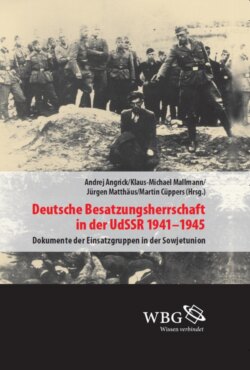Читать книгу Deutsche Besatzungsherrschaft in der UdSSR 1941–45 - Группа авторов - Страница 7
Facetten des Schreckens
Editorische Vorbemerkungen
ОглавлениеIn Band I dieser Editionsreihe „Dokumente der Einsatzgruppen in der Sowjetunion“ standen die „Ereignismeldungen UdSSR“ (EM) des Jahres 1941 im Mittelpunkt. Der vorliegende Folgeband umfaßt die eigentlichen Dienstpapiere der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, ihrer Untereinheiten – Einsatz- und Sonderkommandos (EK/SK) sowie deren Teiltrupps – als auch ihrer stationären Varianten – Befehlshaber und Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD (BdS/KdS) sowie deren Außenstellen. Dabei erstreckt sich der Zeitrahmen der aufgenommenen Dokumente über die gesamte Dauer des Ostkrieges, von der Phase der Vorbereitung auf den Einsatz in der Sowjetunion im Frühjahr 1941 bis zur Kriegsendphase und dem Rückzug der SS-Kommandos in den Jahren 1944 und 1945. Die hier abgedruckte Auswahl bietet – jenseits der in der Reichshauptstadt redigierten Berichtsserien wie den EM und den „Meldungen aus den besetzten Ostgebieten“ – eine Mischung von einschlägigen Schlüsseldokumenten und neuem, bislang weitgehend unbekanntem Quellenmaterial.
Dabei geht es den Herausgebern darum, über die EM hinaus mittels Kompilation verstreuter Archivalien der Forschung eine solidere Basis für die umfassende Analyse der Einsatzgruppen-Geschichte an die Hand zu geben. Denn auch gut 70 Jahre nach Beginn des „Unternehmens Barbarossa“ ist die Tätigkeit der von Himmler und Heydrich im Krieg gegen die Sowjetunion ins Feld geführten Truppe in ihrer ganzen Spannbreite und Wirkung für die Betroffenen noch immer nicht hinreichend aufgearbeitet. Die in Berlin zusammengestellten EM erscheinen vor dem Hintergrund jener nur bruchstückhaft überlieferten, oft jedoch höchst aufschlussreichen Alltagsberichterstattung in anderem Licht. Gerade der mit diesem Band vorgelegte Quellenkorpus hilft ergänzend zu den zentral im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) entstandenen EM verstehen, wie sich die Realität deutscher Okkupationspolitik konkret gestaltete und welche Rolle die Einsatzgruppen dabei spielten. Die Edition soll über die Rekonstruktion der Geschichte einer zentralen Funktionseinheit hinaus dazu beitragen, im komplexen Geflecht deutscher Besatzungsinstanzen, widersprüchlicher Partikularinteressen und ideologisierter Herrschaftsstrukturen Zusammenhänge aufzuzeigen, Verantwortlichkeiten zu verorten und Intentionen freizulegen, die für Millionen von Menschen im Besatzungsgebiet über rund vier Jahre Leben oder Tod bedeuten konnten.
Als Komplementärband zu den EM des Jahres 1941 knüpft die vorliegende Publikation in vielfacher Form an das an, was in Band I ausführlicher behandelt wurde. Das gilt vor allem für die dort in der Einleitung umrissene Genese der Einsatzgruppen, ihre Organisationsgeschichte und Aufgabenfelder – von der bedingungslosen Durchführung der Shoah über die Sicherung der „Lebensgebiete“, die Kultur-, Gesundheits-, Religions- oder „Volkstumspolitik“ – und ihr konkurrierendes Wechselspiel mit den anderen Staats- und Parteiinstanzen einschließlich der Wehrmacht. Wer hierzu Genaueres wissen will, sollte die Einleitung zu Band I und die dort nachgewiesene Sekundärliteratur konsultieren.
In dem Bestreben, den Anmerkungsapparat überschaubar zu gestalten, und um die Gefahr institutionshermetischer Engführung zu vermeiden, haben die Herausgeber darauf verzichtet, direkte Querbezüge zwischen den edierten EM und den hier vorgestellten Dokumenten herzustellen. Wechselwirkungen sind allerdings insofern nachweisbar, als einzelne Schriftstücke die Vorlage boten für Sequenzen der im RSHA-Referat IV A 1 (Kommunismus) bzw. seit dem Frühjahr 1942 in dessen Kommandostab redigierten EM.1 Die folgenden Ausführungen behandeln Editionskriterien, die mit den Spezifika der in diesem Band versammelten Quellen in Verbindung stehen.
Nach allem, was über das Auffinden der EM als geschlossenes Quellenkonvolut bekannt ist, handelt es sich dabei um einen ausgesprochenen Glücksfall.2 Kaum weniger erstaunlich ist es, daß mit dem vorliegenden Band zumindest eine Auswahl der von den Sachbearbeitern der Einsatzgruppen selbstproduzierten Quellen vorgelegt werden kann. Denn bedenkt man die Sorgfalt der Mitarbeiter des RSHA in dem Bestreben, verfängliche Schriftstücke möglichst vollständig zu vernichten oder wenigstens dem Zugriff des Feindes zu entziehen, dürfte es dieses Material eigentlich gar nicht mehr geben. Jedoch sollte aus seinem Vorhandensein nicht geschlossen werden, daß die Bemühungen der Berliner Zentrale um ein Verwischen der Spuren gescheitert wären. Vielmehr müssen gerade die Kernaktenbestände der Einsatzgruppen als unwiederbringlich verloren angesehen werden, auch wenn weitere Quellenfunde in bislang nicht voll zugänglichen Archiven durchaus noch möglich sind.
Wie erfolgreich Himmlers Funktionäre beim Vernichten des umfangreichen und über den gesamten Sicherheitspolizei- und SD-Apparat verstreuten Schriftgutes wirklich waren, zeigt die Tatsache, daß die alliierten Ermittler in Vorbereitung des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses zwar Tonnen von Material zusammentrugen, die dann nach Relevanz durchgearbeitet wurden und den Anklagepunkten entsprechend klassifiziert werden konnten. Trotzdem blieb die Tätigkeit der Einsatzgruppen bis in die Hauptverhandlung hinein sehr schemenhaft. Was die Ankläger darüber zunächst wußten, basierte im wesentlichen auf den Vernehmungen früherer Funktionsträger vor Beginn des Gerichtsverfahrens. Und selbst die sowjetische Seite stützte sich (auch aus prozeßtaktischen Gründen und in Weiterführung der in den frühen Kriegsverbrecherprozessen von Krasnodar und Charkow geübten Praxis) mehr auf Opferbefragungen durch NKWD-Mitarbeiter3 der Außerordentlichen Staatskommission4, Einlassungen der Beschuldigten oder ihrer Kollegen als auf deutsche Beutedokumente5 – und dies, obwohl die UdSSR über aussagekräftige Trophäenbestände verfügte6. Deren Existenz blieb angesichts der Unzugänglichkeit sowjetischer Archive für westliche, aber auch die meisten osteuropäischen Forscher lange Zeit umstritten. Erst in den 1960er Jahren tauchten einzelne Aktensplitter auf, etwa die medienwirksam an westdeutsche Ermittlungsbehörden übergebenen „Heuser-Dokumente“ des KdS/BdS Minsk7 oder die gewöhnlich als „Jäger-Bericht“ betitelte Bilanz der Morde des EK 3 bzw. des KdS Litauen vom 1. Dezember 1941.8 Daß es sich dabei lediglich um die Spitze eines gewaltigen Aktenberges handelte, ließen von der UdSSR als Propagandawaffen im Kalten Krieg intendierte Dokumenteneditionen deutscher Beutequellen vermuten, wobei im westlichen Ausland lebende ehemalige Kollaborateure und Massenmörder in den Reihen der indigenen Hilfspolizeien und Schutzmannschaften eine besonders exponierte Zielgruppe boten.9 Ansonsten verschwieg die UdSSR beharrlich, über welche Archivalien zum RSHA, zu den Einsatzgruppen oder zu anderen Sipo- und SD-Instanzen sie tatsächlich verfügte.10 Was wirklich noch für die historische Forschung unzugänglich in der Lubjanka bzw. beim Komitee für Staatssicherheit liegen mag, ist bis heute unbekannt.
Für das sowjetische Verhalten spielte sicher auch Skepsis gegenüber den deutschen Ermittlungsbehörden und ihren Repräsentanten eine Rolle, was angesichts der Biographie einiger Chefermittler (wie des ersten Leiters der Zentralen Stelle Ludwigsburg, Erwin Schüle) und Staatsanwälte, vor allem aber von Richtern und Strafverteidigern nicht überrascht.11 Zudem bestand auch auf der westlichen Seite ein deutliches Mißverhältnis zwischen dem, was nachrichtendienstlich bekannt war – im Falle Großbritanniens aufgrund abgefangener deutscher Funkmeldungen sogar zeitnah mit dem Beginn der Massenmorde – und den spärlichen Erkenntnissen, über die die alliierten Justizermittler verfügten.12 Während sich Telford Taylor und seine Mitankläger in Nürnberg nach Kräften um eine möglichst tragfähige Beweisdecke bemühten, versagten ihnen amerikanische und britische Geheimdienste Material, das einen weitaus grösseren Kreis deutscher Funktionsträger als die in Nürnberg letztlich angeklagten aufs Schwerste belastete.13 An Dokumenten, die partiellen Einblick boten in die Mordpraxis der mobilen Einsatzgruppen und ihrer stationären Pendants in der besetzten Sowjetunion, fanden lediglich der „Stahlecker-Bericht“14 und weitere Aktensplitter aus amerikanischen Beuteakten15 Eingang in das Nürnberger Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher. Diese Ausgangssituation hilft erklären, warum die ungeschminkten, aber nicht von Exkulpationsabsichten freien Einlassungen Otto Ohlendorfs eine derartige Wirkung vor Gericht erzeugten. Erst danach, mit dem Auffinden der EM, wurde das Gesamtausmaß der von den Einsatzgruppen begangenen Verbrechen deutlich.16
Kalter Krieg und die Geheimarchivierung relevanter Beuteakten vor allem im Ostblock bedingten, daß die Forschung zu den Einsatzgruppen bis zum Ende der 1980er Jahre keinen wesentlich größeren Quellenfundus aus der NS-Zeit benutzen konnte als den bereits seit den Nürnberger Verfahren bekannten. Daß die Archivverwaltungen der kleineren Mitgliedsstaaten des Warschauer Pakts in ihrer Blockadehaltung dem Beispiel des großen Bruders weitgehend folgten, kann kaum überraschen. Erst nach 1989 wurde mit der Öffnung osteuropäischer Archive erkennbar, wie umfangreich und ergiebig das dort vorhandene Material, etwa in Moskau, Warschau17 oder Prag18, auch und gerade zur Geschichte von Sipo und SD ist. Allerdings sind wir nach wie vor weit von einem vollständigen Bild der überlieferten Akten entfernt: Veröffentlichte archivalische Inventare und Findhilfen aus Osteuropa sind selten. Recherche- und Mikroverfilmungs-Projekte des USHMM oder von Yad Vashem erschlossen einige, aber längst nicht alle Bestände. Und das nach dem Fallen des „Eisernen Vorhangs“ spürbare Bemühen um forschungsgerechte Archivbestimmungen hat in einigen Ländern wieder restriktiven, um Schutz „nationaler Kulturgüter“ bemühten Praktiken Platz gemacht, was in Bezug auf deutsche Beuteakten einigermaßen befremden muß. So sind Historiker in der Gegenwart mit dem Umstand konfrontiert, daß sich wichtige Archive Ost- und Ostmitteleuropas heute weit weniger benutzerfreundlich und insgesamt verschlossener zeigen als noch in der für die Geschichtswissenschaft hoffnungsvollen Umbruchsphase der 1990er Jahre.
Dieser Rückschritt resultiert zweifellos aus den anhaltenden Verwerfungen, die der Prozeß des Nation-Building nicht nur in den sowjetischen Nachfolgestaaten noch immer mit sich bringt. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Ergebnisse des „Final Reports“ der rumänischen Präsidentenkommission vom 2. November 2004 zur Aufklärung des rumänischen Tatbeitrages im Rahmen der europäischen „Endlösung“19 oder die grundlegenden Ermittlungsberichte der estnischen und litauischen Expertengruppen zur Rekonstruktion der Besatzungszeit20. Es sollte aber nicht vergessen werden, daß auch im Westen erhebliche Defizite bestanden – siehe das Verhalten des britischen Nachrichtendienstes noch lange nach 1945 und die Tatsache, daß es in den USA eines „Freedom of Information Request“ bedurfte, um bei verschiedenen Regierungsbehörden vorhandene, bis dahin klassifizierte Akten zum Holocaust der Forschung zugänglich zu machen21 – und teilweise noch weiterbestehen. Was in britischen, französischen oder deutschen Verwahrorten bewußt weggeschlossen wurde oder vergessen vor sich hinstaubt, wissen wir nicht. Schließlich sind die Beweismittel der französischen Militärgerichte immer noch nicht voll zugänglich, und was westdeutsche Geheimdienste an Quellen zur NS-Zeit verwahren, kommt erst ganz allmählich ans Licht. Es ist also nicht ausgeschlossen, sondern eher wahrscheinlich, daß im Westen wie im Osten vernichtet geglaubte Akten des RSHA noch auftauchen – wie etwa die Kopienbestände des BStU zum „Unternehmen Zeppelin“22 oder des Auslands-SD Italien23 nahelegen. Zudem bieten das Zusammenfügen isolierter Aktensplitter24, die Hoffnung auf das Auffinden weiterer geschlossener Vorgänge25, die Suche an ‚entlegenen‘ Verwahrungsorten – wie die Nachforschungen von Oula Silvennoinen in den finnischen Archiven26 zeigen – und nicht zuletzt der maßgeblich vom USHMM unternommene Versuch, über zahlreiche Archive verstreute Aktenprovenienzen zum Holocaust in kopierter Form zusammenzufügen, Aussichten, neues Licht auf die Geschichte der Einsatzgruppen zu werfen.
Archivöffnungen, Aktenfunde und Forschungsfortschritte können dennoch nicht den deprimierenden Befund ausgleichen, daß die Aktenverluste gerade der mit dem Stempel „Geheime Reichssache“ versehenen Vorgänge immens sind. Kriegstreffer vor allem, jedoch ebenso die kontinuierliche Beseitigung im normalen Umgang mit Geheimsachen sowie besonders die generellen Zerstörungsaktionen vor Rückzug und Kapitulation führten zu massiven Überlieferungslücken. In welcher Größenordnung sich diese Verluste bewegen, wird erst deutlich, wenn man den Umfang der schriftlichen Korrespondenz der Einsatzgruppen und -kommandos anhand der Tagebuchnummern genauer betrachtet. Für die Einsatzgruppe D ergibt sich beispielhaft und durchaus repräsentativ folgender Befund: Die Schreiben des Stabes der EG D an den Ic-Offizier des AOK 11 vom 9. Oktober 1941 tragen die Tgb.-Nr. 910/41, 912/41 bzw. 920/4127, ein weiteres vom 3. November 1941 die Nr. 1303/4128. Innerhalb von knapp vier Wochen durchliefen also mehr als 380 Schriftstücke die Registratur – und dies sind nur die Papiere des Stabes. Wir können aus dem Schriftverkehr schließen, daß die Zählung mit jedem Jahreswechsel neu begann. Am 12. Februar 1942 wurde im Stab der EG D das Schriftstück mit der Tgb.-Nr. 381/42 aufgesetzt29; im April 1942 lag man dort bereits deutlich über tausendeinhundert bearbeiteten Vorgängen (Tgb.-Nr. 1118)30. Ein in Prag aufgefundenes Schreiben der EG D von Ende Oktober 1942 trägt die Tgb.-Nr. 7602/4231 – wiederum nur die Korrespondenz des Stabes. Die Kommandos hatten ihre eigene Zählung (so verfaßte das EK 11a am 23. September 1941 ein Schreiben unter der Tgb.-Nr. 341/41); hinzu kommen noch mögliche Akten der Teilgruppen, d.h. der Polizeibataillone 9 und 3 sowie des Bataillons der Waffen-SS z.b.V. Selbst wenn man unterstellt, daß gewisse sicherheitspolizeiliche Vorgänge Einzelpersonen betrafen, muß man anhand der Überlieferung der EG D konstatieren, daß die Erhaltung des Aktenmaterials dieser Einheit gegen Null tendiert. Ähnlich desolat stellt sich die Lage für die Einsatzgruppen A und B dar. Und noch extremer fällt das Urteil über Stab und die Kommandos der Einsatzgruppe C aus, für die fast keine Akten verfügbar sind. Insgesamt dürfte in den bislang bekannten Archivbeständen bestenfalls ein Promille der Einsatzgruppenunterlagen Kriegszerstörungen und Dokumentenvernichtungen überdauert haben. Umso bedeutsamer scheint es den Herausgebern, die in ihrer archivalischen Zersplitterung selbst für Fachhistoriker schwer zugänglichen Aktenrelikte im Rahmen dieser Editionsserie einer breiteren Öffentlichkeit zu erschließen, um so den mörderischen Dienstalltag der Gestalter von Hitlers Neuem Europa auf der Basis der von ihnen selbst erzeugten Quellen umfassend zu dokumentieren.
Die hier edierten Dokumente umfassen – wie angedeutet – den Zeitraum von April 1941 bis Februar 1945, decken somit in ihrer Chronologie die Vorbereitungen des RSHA im Rahmen der „Barbarossa“-Planungen, die Phase des Vormarsches der mobilen Einheiten, die Etablierung stationärer Dienststellen im Zeichen einer erstarrten Front und zuletzt die Aktivitäten der Truppe am Vorabend der Niederlage ab. Daß knapp die Hälfte der vorgestellten Quellen aus dem Jahr 1941 stammt, kann angesichts der für den Beginn des Feldzuges relativ guten Überlieferungssituation mit Komplementärakten der Wehrmacht, Zivilbehörden oder SS nicht verwundern. Auch liegt der Schwerpunkt der relevanten Akten in den Berliner wie Moskauer RSHA-Überlieferungen eher auf den Jahren 1941/42;diesem Umstand mußte Tribut gezollt werden. Bereits 1943, spätestens aber mit dem Jahr 1944 dünnt die Aktendecke dann infolge der raschen Fronteinbrüche, vermehrter Überlieferungsverluste und systematischer Vernichtungen stark aus. Auch dies schlug sich in der hier erfolgten Auswahl natürlich nieder.
In diesem Zeitrahmen war die Tätigkeit von Sicherheitspolizei und SD in der UdSSR umfangreichen strukturellen Veränderungen unterworfen. Teilweise entstanden aus den vormals mobilen EK und SK bereits ab Herbst 1941 mit der Einrichtung der Zivilverwaltung durch Alfred Rosenbergs Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete stationäre Dienststellen, die in ihrem jeweiligen Einflußbereich dauerhaft exekutive Polizeiaufgaben übernahmen und dabei gleichzeitig regional und lokal die nationalsozialistische Vernichtungspolitik intensivierten. Im Armeegebiet operierten die Einsatzgruppen als solche weiter. In den zivil verwalteten Regionen wurden Sipo und SD als BdS- und KdS-Dienststellen mit nachgeordneten lokalen Aussenstellen in Rosenbergs Apparat integriert, ohne dass damit eine Aufgabe des Selbständigkeitsanspruchs von Himmlers Vertretern vor Ort verbunden gewesen wäre. Damit wiederholte sich rein formal eine Entwicklung, die sich für Polen schon seit dem Spätherbst 1939 und später auch in anderen Besatzungsgebieten vollzogen hatte. Während aber die Einsatzgruppen in Polen Kompetenzbereiche der deutschen Besatzungspolitik erst nach der vollständigen Besetzung des Landes übernommen hatten32, spiegelt die partielle Umwandlung der Einsatzgruppen in der deutschbesetzten Sowjetunion in stationäre Dienststellen die militärische Stagnation und die Rückschläge an der Ostfront wider und ist damit beredter Beleg für das faktische Scheitern der ursprünglichen „Barbarossa“-Planungen bei gleichzeitigem Fortwirken der Idée fixe nachhaltiger sicherheitspolizeilicher „Durchdringung“ und „Befriedung“ des besetzten Gebiets.
Erste ortsfeste Dienststellen des RSHA entstanden analog zum Stillstand an der Front vor Leningrad und als Folge der Einrichtung der deutschen Zivilverwaltung im Baltikum. SS-Brigadeführer Dr. Franz Walter Stahlecker, der Kommandeur der Einsatzgruppe A, firmierte schon seit Ende September 1941 auch als Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD in Riga, dem Verwaltungszentrum des Reichskommissariats Ostland. Gleichzeitig entstanden aus dessen bisherigen SK und EK diverse KdS-Dienststellen. Weitere stationäre Dependancen von Sicherheitspolizei und SD entstanden im weissrussischen Gebiet des Reichskommissariats Ostland sowie weiter südlich in der Ukraine seit Februar 1942. Spätestens seit April existierte für den Chef der Einsatzgruppe C, Brigadeführer Dr. Max Thomas, auch die Bezeichnung Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Ukraine. Seinen Dienstsitz bezog er in Kiew. Neben diversen KdS-Dienststellen existierte dort aber die Mehrzahl der SK und EK in den frontnahen Gebieten weiter. Im Fall der Einsatzgruppe D entstand mit dem Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Generalbezirk Taurien mit Sitz in Simferopol überhaupt nur eine stationäre Dienststelle, die aus Teilen des EK 11b gebildet wurde und dem BdS Ukraine unterstand. Trotz regionaler Unterschiede entwickelten sich die BdS- und KdS-Dienststellen zu Synonymen für die Vernichtung der sowjetischen Juden und den nationalsozialistischen Terror gegen die nichtjüdische Zivilbevölkerung. Beispielhaft wird das mit Dokumenten dieses Bandes immer wieder belegt.33
Das Bemühen um angemessene Kontextualisierung ließ es den Herausgebern unverzichtbar erscheinen, bereits an anderer Stelle ganz oder auszugsweise veröffentlichte Schlüsseldokumente in diese Edition aufzunehmen.34 Dazu zählen vor allem die zentralen Abmachungen zwischen Himmlers Apparat und der Wehrmacht sowie Heydrichs Einsatzbefehle an die Chefs der Einsatzgruppen und nicht zuletzt seine an die Höheren SS- und Polizeiführer am 2. Juli 1941 übermittelten grundlegenden Weisungen, in denen die im RSHA entwickelten Richtlinien der künftigen Besatzungspolitik kurz, prägnant und ungeschönt zusammengefaßt wurden. Neben für das Verständnis der Organisation und Einsatzführung der Einheiten notwendigen Schriftstücken wurden bei der Auswahl insbesondere jene Dokumente berücksichtigt, die unmißverständlich Aufschluß geben über den Massenmord an Juden, Zigeunern, Kranken, Kriegsgefangenen, Polizei- bzw. KL-Häftlingen sowie allen übrigen Opfern, die das Regime als Gegner definierte. Dazu gehören auch Quellen zu Gruppen einheimischer Nationalisten, insbesondere zur ukrainischen Bandera-Bewegung, oder zur Kollaboration, da sie zum Verständnis der Spannbreite des deutschen Herrschaftssystems und der Gewichtung teilweise rivalisierender, ja widersprüchlicher Prioritäten beitragen.
Der Blick auf den breiteren Zusammenhang hochgradig destruktiven Besatzungshandelns scheint schon deshalb geboten, weil einige der aussagekräftigsten, kompromittierendsten Dokumente nur noch partiell, als aus einem größeren Gesamtkontext entrissene Fragmente erhalten geblieben sind. Sie bezeugen in ihrer Verstümmelung, daß sie – gerade wenn es um die Vernichtung der Juden ging – nicht für die Nachwelt bestimmt waren. Als Relikte einer ansonsten zerstörten Aktenlandschaft verdeutlichen sie den mörderischen Dienstbetrieb von Sipo und SD. Nüchterne Statistiken und knappe Befehle, auf rudimentäre Handlungsanleitungen reduziert, stehen neben ausufernden Darstellungen und wortreichen Analysen. Beide weisen die Einsatzgruppen nicht nur als aktionistische „Truppe des Weltanschauungskrieges“ aus, sondern auch als intellektuell-exekutive Avantgarde, als „Vor-Denker“ des NS-Milleniums jenseits starrer Kompetenzabgrenzungen von Staat und Partei. Über Interaktion, Konkurrenz und Kooperation der Einsatzgruppen mit Wehrmacht, Parteiführung und -gefolge, Propagandaministerium, Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete oder Auswärtigem Amt geben die Quellen beredt, wenngleich keineswegs erschöpfend Auskunft. Noch in den pedantischsten Berichten und den banalsten Schriftwechseln bleibt der Primat des Politischen erkennbar, aus dem die Angehörigen von Sipo und SD ihren exekutiven Monopolanspruch abzuleiten, durchzusetzen und über weite Strecken zu verteidigen vermochten. Einzelne Dokumente artikulieren das Bemühen um das Ausloten der ‚richtigen‘ Besatzungsstrategie – auch in Abgrenzung zur Wehrmacht oder Zivilverwaltung – in für die NS-Bürokratie seltener Offenheit, wie bspw. die Überlegungen Heydrichs vom April 1942 zur ‚beobachtenden‘ Partisanenbekämpfung. Denn die Berichte von ‚unten‘ verstanden sich nicht nur als Selbstrechtfertigung, sondern auch als Beweis von Kompetenz, als Politikberatung durch die Dependancen des RSHA. In der Rolle des Berichterstatters wollte hier ein Partikel des Herrschaftssystems andere, noch mächtigere NS-Apparate ‚lenken‘, gefiel es sich als intellektueller Vordenker brauner Herrschaftstechnik. Gleichzeitig eröffnet die Lektüre der hier versammelten Dokumente aber auch einen Blick hinter die Kulissen der Einsatzgruppen-Selbstdarstellung auf die Grenzen ihrer Wirkungsmacht. Die Partisanenbewegung etwa nahm in den Berichten der Stäbe und Kommandos seit Beginn des Jahres 1942 einen immer breiteren Raum ein. Über das für die Durchführung „härtester Maßnahmen“ gegen Juden und andere Teile der Zivilbevölkerung zweckdienliche und entsprechend aufgebauschte Propagandagespenst des „Bandenhelfers“ hinaus artikulierte sich hier eine reale Gefahr, der man durch noch so brachiale, ausufernde Gewalt einschließlich Flächenbombardements faktisch nur sehr bedingt und mit Fortschreiten des Krieges immer weniger Herr wurde.
Ein Auswahlkriterium für die edierten Schriftstücke war es, möglichst umfassend die von den Einsatzgruppen ganz oder teilweise usurpierten Politikfelder zu dokumentieren. In einzelnen Fällen schien es unumgänglich, umfangreiche Berichte – insbesondere ausschweifende SD-Elaborate zu Wirtschaftsfragen – zu kürzen, da ein vollständiger Abdruck den Seitenumfang des Bandes gesprengt hätte. Wer den gesamten Wortlaut dieser Dokumente lesen will, wird auf die Originalquelle selbst zurückgreifen müssen; doch versteht sich die Edition auch darüber hinaus durchaus als Anreiz, die vielfach bislang kaum von der historischen Forschung genutzten Akten einzeln ebenso wie im Kontext ihrer Archivbestände zu analysieren. Eine Edition wie die vorliegende enthebt den interessierten Benutzer nur bedingt der Notwendigkeit, selbst die Quellen aufzusuchen; sie bereitet aber den Weg für vertiefende Recherche und wirkt dem Fehlurteil entgegen, im Zusammenhang mit dem Holocaust sei schon alles „abgeforscht“.
Die archivalische Basis der hier abgedruckten 200 Quellentexte ist denkbar breit. Sie stammen aus dem Bundesarchiv in Berlin, dessen Militärarchiv in Freiburg/B., dessen Außenstelle Ludwigsburg und dessen Zwischenarchiv Dahlwitz-Hoppegarten, aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amtes in Berlin, dem Institut für Zeitgeschichte in München und aus dem Archiv des Beauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehem. DDR in Berlin. Jenseits der Landesgrenzen kamen das ehem. Sonderarchiv in Moskau, die Staatsarchive in Riga, Minsk, Kiew und Tallinn, die Militärarchive in Prag und Pitesti, das Oblastarchiv in Shitomir sowie das United States Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. hinzu. Damit sind alle nach bisherigem Wissen einschlägigen Bestände hier vertreten.
Auch zur Schreibweise und zum Umgang mit offensichtlichen Fehlern sind einige Bemerkungen nötig. Die uneinheitliche Orthographie wurde belassen, allerdings mit einer Ausnahme: Ging es um die Unterscheidung zwischen „Maß“ und „Masse“, wurde dies durch entsprechende Korrekturen kenntlich gemacht. Auch sinnentstellende Schreibfehler, die zweifelsfrei erkennbar waren, fielen einer stillschweigenden Verbesserung zum Opfer. Daneben allerdings gibt es auch klar erkennbare Schreibfehler, die sich nicht erhellen lassen. In derartigen Fällen wurde dies durch ein „Sic“ in eckigen Klammern verdeutlicht. Dasselbe Verfahren wurde auch bei unvollständigen oder verbauten Sätzen im Text angewandt. Worte, die sich partout nicht entziffern ließen, wurden nicht als Torso in den Text aufgenommen, sondern komplett durch den Hinweis „Unleserlich“ in eckiger Klammer ersetzt. Bei den häufig variierenden Ortsnamen galt stets die Version im Kartenmaterial des deutschen Heeres. All diese Eingriffe in den Text erschienen uns im Sinne einer besseren Verständlichkeit als zu verantworten und unabwendbar.
Abschließend gilt es Dank zu sagen all denjenigen, die ihr Teil zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben: In erster Linie sind wir alle Heidrun Baur, der verdienten Mitarbeiterin der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, tief verbunden, die in unermüdlicher Arbeit die Texte eingescannt und korrigiert sowie die Kommentare und das Orts- und Personenregister erfaßt hat. Auch Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma, Prof. Dr. Bernd Greiner und Matthias Kamm vom Hamburger Institut für Sozialforschung fühlen wir uns verbunden, da sie von vornherein von der Bedeutung des Projekts überzeugt waren und es vorbehaltlos unterstützten. Und dies nicht allein durch die großzügige Übernahme von Personalkosten sowie Sachmitteln, ohne die ein solches Vorhaben nur schwer zu realisieren ist, sondern in gleicher Weise ideell, indem sie es zu ihrem eigenen machten. Dasselbe gilt für Paul Shapiro vom Center For Advanced Holocaust Studies am United States Holocaust Memorial Museum Washington D.C. Ihnen allen verdankt der Band großzügige Zuschüsse durch die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur sowie durch den Curt C. und Else Silberman Fund des Museums, die die Veröffentlichung erst möglich machten. Hierfür sei ihnen allen herzlich gedankt.
1 Vgl. Vermerk Gstaw Berlin v. 8.6.1967, BAL, B 162/5419.
2 Die EM wurden erst im Sept. 1945 im 4. Stock des Gestapo-Hauptquartiers als (nicht extra gesichteter) Teil eines Großkonvoluts an Akten sichergestellt; vgl. Ronald Headland: Messages of Murder: A Study of the Reports of the Einsatzgruppen of the Security Police and the Security Service, 1941–1943, Toronto 1992, S. 13f.
3 Vgl. Marina Yu Sorokina: On the Way to Nuremberg: The Soviet Commission for the Investigations of Nazi War Crimes, in: Beth A. Griech-Polelle (Hrsg.): The Nuremberg War. Crimes Trial and its Policy. Consequences Today, Baden-Baden 2009, S. 21–32.
4 Der volle Titel lautete: Außerordentliche Kommission zur Feststellung u. Untersuchung von Verbrechen u. Schäden, die vom deutsch-faschistischen Okkupator u. seinen Mittätern den Bürgern, Kolchosen, öffentlichen Organisationen, Staatsunternehmen u. Einrichtungen der UdSSR zugefügt wurden.
5 Zu deren Arbeit vgl. Alexander Egorowitsch Epifanow: Die Außerordentliche Staatliche Kommission, Wien 1997; Stefan Karner: Zum Umgang mit der historischen Wahrheit in der Sowjetunion. Die „Außerordentliche Staatliche Kommission“ 1942 bis 1951, in: Wilhelm Wadl (Hrsg.): Kärntner Landesgeschichte und Archivwissenschaft, Klagenfurt 2001, S. 509–523; allgemein zu sowjetischen Kriegsverbrecherprozessen: Arieh J. Kochavi: Prelude to Nuremberg: Allied war crimes policy and the question of punishment, Chapel Hill-London 1998, S. 64–73.
6 Hermann Schreyer: Die zentralen Archive Russlands und der Sowjetunion von 1917 bis zur Gegenwart, Düsseldorf 2003, S. 148f., 159ff.
7 Vgl. BAL, B 162/252, Findmittelslg. UdSSR, Heft 1. Der Einführung des Hefts zufolge wurden die Originaldok. vom Attaché des sowjetischen Außenministeriums Jouri Kouzminykh u. von Professor Nikolaj Alexsejew mitgebracht u. dann von der ZSL, der Staw Koblenz u. dem Bundesarchiv eingehend auf Echtheit geprüft. Zur Bedeutung der Dok. im Rahmen des Heuser-Prozesses vgl. Jürgen Matthäus: Georg Heuser – Routinier des Osteinsatzes, in: Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hrsg.): Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt 2004, S. 115–125, hier S. 119–122.
8 Dieser kam 1963 im Zuge der Auswertung der „Heuser-Dokumente“ zur Kenntnis der Ludwigsburger Ermittler; vgl. BAL, B 162/253, Findmittelslg. UdSSR, Heft 2; als Faksimile abgedruckt in: Wolfram Wette: Karl Jäger. Mörder der litauischen Juden, Frankfurt/M. 2011, S. 237–245.
9 Dazu etwa E. Avotiš/J. Dzirkalis/V. Petersons/Daugavas Vanagi: Wer sind sie?, Riga 1963; B. Arklans/J. Dzirkalis/J. Silabriedis: Vii bez Maskas, Riga 1966; B. Baranauskas/K. Ruksenas/E. Rozauskas: Documents Accuse, Wilna 1970.
10 So wurde den Ludwigsburger Ermittlern 1968 erklärt, sie hätten „alle deutschen Dokumente aus dem Moskauer Zentralarchiv“ zu sehen bekommen. In Wirklichkeit handelte es sich aber nur um einen (vorausgewählten) Bruchteil. Zu den Moskauer Beständen: Kai von Jena/Wilhelm Lenz: Die deutschen Bestände im Sonderarchiv Moskau, in: Der Archivar 45(1992), Sp. 457–468; Götz Aly/Susanne Heim: Das Zentrale Staatsarchiv in Moskau („Sonderarchiv“). Rekonstruktion und Bestandsverzeichnis verschollen geglaubten Schriftguts aus der NS-Zeit, Düsseldorf 1992.
11 Vgl. Annette Weinke: Eine Gesellschaft ermittelt gegen sich selbst. Die Geschichte der Zentralen Stelle Ludwigsburg 1958–2008, Darmstadt 2008, S. 86–99, 121–125; nach wie vor aufschlußreich: Ingo Müller: Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München 1987.
12 Vgl. Richard Breitman: Staatsgeheimnisse. Die Verbrechen der Nazis – von den Alliierten toleriert, München 1999; Astrid M. Eckert: Kampf um die Akten. Die Westalliierten und die Rückgabe von deutschem Archivgut nach dem Zweiten Weltkrieg, Stuttgart 2004, S. 34, 64, 69.
13 Vgl. Steven Tyas: Allied Intelligence Agencies and the Holocaust: Information Acquired from German Prisoners of War, in: HGS 22(2008), S. 1–24; Robert J. Hanyok: Eavedropping on Hell: Historical Guide to Western Communications and the Holocaust, 1939–1945, (2. Aufl.) o. O. [Fort George G. Meade/MD] 2005.
14 Nbg. Dok. L-180: EG A, Gesamtbericht bis zum 15.10.1941. Ohne alle Anlagen abgedruckt in: IMG, Bd. 37, S. 670–717. Der Bericht einschl. Anlagen befindet sich im Original im NARA.
15 Nbg. Dok. PS-2273: Aktensplitter/Undat. [nach Dez. 1941] Geheimbericht der EG Aüber die Massenmorde im Baltikum u. Weißrußland, abgedruckt in: IMG, Bd. 30, S. 71–80. Nbg. Dok. PS-3012: Wirtschaftsinspektion Süd, Abschrift des Schreibens des KdS Tschernigow v. 22.3.1943 mit Befehl des SK 4a v. 19.3.1943, abgedruckt in: IMG, Bd. 31, S. 492–495.
16 Zum Auffinden der EM, ihrer Auswertung sowie der Nutzung als Anklage-Dok. für den Fall 9 den EG-Prozeß, ausführlich: Hilary Earl: The Nuremberg SS-Einsatzgruppen Trial 1945–1958. Atrocity, Law, and History, Cambridge u.a. 2009, S. 75–82.
17 Auch in polnischen Archiven fand sich diesbezüglich relevantes Material vor. Diese Dok. – so z.B. über die Häftlingsstärken in den Gefängnissen Lettlands, Tätigkeitsberichte des KdS Lettland oder der EG B – liegen verfilmt im USHMM, RG 15.007, reel 8 reel 11, reel 15, reel 73 vor, sind also Streuakten. Der USHMM-Bestand umfaßt insgesamt 78 Mikrofilme, die ursprünglich im polnischen Ministerium der Staatssicherheit bzw. im Innenministerium für die Forschung unzugänglich verwahrt u. später dem IPN-Archiv übergeben wurden. Das Material wurde, anders als die im ehem. „Sonderarchiv“ Moskau verwahrten RSHA-Akten, inzwischen vom Bundesarchiv in den Bestand R 58 integriert.
18 In Unkenntnis des organisatorischen Zusammenhangs u. mehr aus propagandistischen Motiven (im Rahmen der deutschen Verjährungsdebatte als „neu“ aufgefundene Dokumente) als Photoabdruck veröffentlicht in: Unsere Ehre heißt Treue. Kriegstagebuch des Kommandostabes Reichsführer SS, Tätigkeitsberichte der 1. und 2. SS-Inf.-Brigade und von Sonderkommandos der SS, Prag-Wien 1965, S. 231–249; zum Überlieferungskontext der veröffentlichten Dok. u. zum Gesamtbestand: Zuzana Pivcova: Das Militärhistorische Archiv in Prag und seine deutschen Bestände, in: MGM 52(1993), S. 429–435. Zum Einsatz der Kommandos z.b.V. im Rahmen der EG u. bezugnehmend auf die Prager Bestände: Martin Cüppers: Wegbereiter der Shoah. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer-SS und die Judenvernichtung 1939–1945, Darmstadt 2005, S. 271–275.
19 Im Netz auf der Homepage des USHMM nach Kapiteln abrufbar: Siehe (letzter Besuch am 7.8.2011): http://www.ushmm.org/research/center/presentations/features/details/2005–03–10.
20 Estonia 1940–1945. Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity, Tallinn 2006.
21 Zur „Interagency Working Group“: http://www.archives.gov/iwg/index.html (letzter Besuch am 22.8.2011).
22 Die Zeppelin-Akten sind als Kopien zu den Untersuchungen der Staatssicherheit aus der Sowjetunion in die DDR gelangt, um operativ ausgewertet zu werden, vgl. BStU, FV 6/74; grundsätzlich dazu: Klaus-Michael Mallmann: Der Krieg im Dunkeln. Das Unternehmen „Zeppelin“ 1942–1945, in: Michael Wildt (Hrsg.): Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit. Der Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, Hamburg 2003, S. 324–346; Andrej Angrick: „Unternehmen Zeppelin“, in: Johannes Ibel (Hrsg.): Einvernehmliche Zusammenarbeit? Wehrmacht, Gestapo, SS und sowjetische Kriegsgefangene, Berlin 2008, S. 59–69.
23 Diese Akten aus dem BA-ZA, Bestand ZR 920 verwendet Katrin Paehler: Ein Spiegel seiner selbst. Der SD-Ausland in Italien, in: Wildt: Nachrichtendienst, politische Elite und Mordeinheit, a.a.O., S. 241–266.
24 Im Oblastarchiv Taganrog befinden sich einige Aktensplitter zur Korrespondenz der Feldkommandantur Donez mit dem EK 6, dem SK 4b bzw. dem SK 10a, insbesondere in den Vorgängen 513–1–3, 513–1–83, 600–1–68, 600–2–60. Für den Hinweis danken wir Dr. Ralph Ogorreck.
25 So zu den angeblich verlorengegangenen Dienstpapieren des SK 10a in Rostow vgl. Andrej Angrick: Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941–1943, Hamburg 2003, S. 23f.
26 Oula Silvennoinen: Geheime Waffenbrüderschaft. Die sicherheitspolizeiliche Zusammenarbeit zwischen Finnland und Deutschland 1933–1944, Darmstadt 2010, S. 151–227.
27 BA-MA, RH 20–11/488.
28 Ebd., Bl. 41.
29 Ebd., Bl. 116.
30 Ebd., Bl. 123.
31 Staatsarchiv Prag, Bestand Reichsprotektor Böhmen u. Mähren, URP II.D, Karton 91: Der Beauftragte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD beim Befehlshaber des rückwärtigen Heeresgebietes – Heeresgruppe A – Einsatzgruppe D, III B – Dr./Bt, Tgb.Nr. 7602/42 v. 22.10.1942, an das RSHA, Betr.: Emigranten-Schrifttum.
32 Klaus-Michael Mallmann/Jochen Böhler/Jürgen Matthäus: Einsatzgruppen in Polen. Darstellung und Dokumentation, Darmstadt 2008, S. 99ff., 193f.
33 Zur Bildung der stationären Dienststellen vgl. Wolfgang Scheffler: Die Einsatzgruppe A 1941/42, in: Peter Klein (Hrsg.): Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Die Tätigkeits- und Lageberichte des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin 1997, S. 29–51, hier S. 30; Dieter Pohl: Die Einsatzgruppe C 1941/42, ebd., S. 71–87, hier S. 81f.; Andrej Angrick: Die Einsatzgruppe D, ebd., S. 88–110, hier S. 102; Helmut Krausnick: Hitlers Einsatzgruppen. Die Truppe des Weltanschauungskrieges 1938–1942, Frankfurt/M. 1985, S. 154ff., 162, 168f.
34 So bietet die von Peter Klein herausgegebene Edition neben den zusammengefaßten Monatsberichten der EG eine weitgefächerte Slg. relevanter Dok., vgl. ders. Einsatzgruppen.