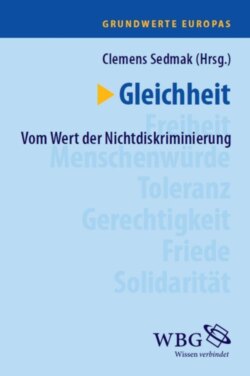Читать книгу Gleichheit - Группа авторов - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Gegenwärtige Debatten
ОглавлениеDa in zeitgenössischen Theorien ‚Behandlung als Gleiche‘ der moralisch geteilte Standard ist, gehen die heutigen Debatten darum, welche Art von Behandlung normativ gefordert ist, wenn wir uns wechselseitig als Personen mit gleicher Würde achten. Die Debatten drehen sich dabei um zweierlei, erstens ob überhaupt Gleichheit und zweitens, wenn ja, welche Art von Gleichheit gefordert ist.
(i) Nach non-egalitärer Meinung impliziert gleiche Würde gar keine Gleichheit, weil sich aus der Achtung der Würde überhaupt keine komparativen (also vergleichenden) Prinzipien der Gleichheit ergeben. Vielmehr kann man nach non-egalitärer Auffassung ohne Vergleich wissen, was moralisch zu tun ist.30 „The fundamental error of egalitarianism lies in supposing that it is morally important whether one person has less than another regardless of how much either of them has.“31 Egalitäre Auffassungen hingegen bestreiten, dass sich die moralische Begründung und Bestimmung des Gesollten ohne vergleichende Berücksichtigung dessen, was anderen in gleicher Lage zusteht, beurteilen lassen. Dabei wird Gleichheit nicht um ihrer selbst willen angestrebt, sondern weil erst sie soziale Gerechtigkeit realisiert bzw. konstituiert.
(ii) Eine Minimalpositionen vertritt der Libertarismus (Libertarianism) und Wirtschaftsliberalismus, vertreten durch Robert Nozick oder Friedrich Hayek, der, auf Locke zurückgehend, gleiche ursprüngliche Freiheits- und Besitzrechte postuliert und damit gegen Umverteilungen und soziale Rechte und für den freien Markt argumentiert.32 Es wird ein Gegensatz von Gleichheit und Freiheit behauptet. Dagegen wird eingewandt, dass gerade wenn das eigene freie Verdienst zählen soll, der eigene Erfolg nicht so sehr von Glück, natürlicher Ausstattung, ererbtem Besitz und Status abhängen darf. Es bedarf mindestens noch der Chancengleichheit, die dafür sorgt, dass das Schicksal der Menschen von ihren Entscheidungen und nicht von ihren sozialen Lebensumständen bestimmt wird, die sie nicht zu verantworten haben. Der Egalitarismus will jedoch mehr. Für ihn ist eine Welt moralisch besser, wenn in ihr Gleichheit der Lebensbedingungen herrschen. Dies ist ein amorphes Ideal, das Klärung verlangt. Warum ist Gleichheit der Lebensbedingungen ein Ideal, und Gleichheit von was genau?33
(iii) Eine Maximalposition stellt strikte Gleichheit dar, die allen einen gleichen materiellen Level an Gütern und Leistungen gewähren will. Sie wird allgemein als unplausibel verworfen. Sie scheitert an Problemen, die allgemein gegen Gleichheit eingewandt werden, und die jede plausible Gleichheitsauffassung lösen muss. Erstens müssen angemessene Indices für die Messung der Gleichheit der zu verteilenden Güter angegeben werden. In Begriffen von was soll Gleichheit bzw. Ungleichheit hier verstanden werden? So kann Gleichheit materieller Güter zu ungleicher Zufriedenheit führen. Als üblicher, wenn auch bekanntermaßen unzulänglicher Index wird das Geld benutzt, wobei offensichtlich mindestens Gleichheit der Chancen anders erfasst werden muss. Zweitens muss angeben werden, in welchem Zeitraum das angestrebte gleiche Verteilungsmuster realisiert sein muss. Strikte Gleichheit fordert Gleichheit innerhalb kürzerer Zeitabstände. Dies scheint jedoch die Verfügungsgewalt von Personen über ihren Anteil unzulässig einzuschränken. Drittens verzerrt Gleichheit ökonomische Leistungsanreize und führt zu einem Mangel an Effizienz, weil bei der Umverteilung Schwund an Gütern durch administrative Kosten auftritt.34 Gleichheit und Effizienz müssen in ein ausgewogenes Verhältnis gesetzt werden. Oft wird, hauptsächlich von Ökonomen, diesbezüglich Pareto-Optimalität verlangt. Ein Zustand ist pareto-optimal oder pareto-effizient, wenn es nicht möglich ist, in einen anderen sozialen Zustand überzugehen, der mindestens von einer Person als besser oder von keiner als schlechter beurteilt wird. Diese Beurteilung ist jedoch immer relativ zu einem gegebenen Ausgangszustand, der ungleich und ungerecht sein kann. Deshalb mag es zur Herstellung von Gerechtigkeit nötig sein, Pareto-Optimalität zu verletzen. Zumindest darf Gleichheit in den Augen der Kritikerinnen und Kritiker nicht dazu führen, dass manche auf Güter verzichten müssen, obwohl dadurch kein Schlechtergestellter besser gestellt würde. Viertens gibt es moralische Einwände: Strikte und mechanische Gleichbehandlung aller Beteiligten nimmt die Unterschiede zwischen den Individuen und ihren Situationen nicht ernst. Eine Kranke hat intuitiv andere Ansprüche als ein Gesunder; ihr das Gleiche zuzuteilen wäre falsch. Bei einfacher Gleichheit werden die Freiheit der Individuen unzulässig beschränkt und die je individuelle Besonderheit der Person nicht hinreichend berücksichtigt; insofern wird sie eben nicht gleich berücksichtigt. Moralisch besteht nicht nur ein Recht auf die Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse, sondern auch ein Recht auf die Früchte der eigenen Arbeit, darauf, dass die eigene Leistung, das Verdienst auch zählt. Zu guter Letzt besteht die Gefahr, dass Gleichheit zu Gleichmacherei, Uniformität und Einebnung führt, statt Differenz und Pluralität zu respektieren.35
Als Desideratum kann man insofern festhalten: Statt einfacher Gleichheit bedarf es deshalb einer Konzeption komplexerer Gleichheit, der es durch Unterscheidung von verschiedenen Güterklassen, getrennten Sphären (Michael Walzer36) und differenzierteren Kriterien gelingt, auf diese Problemlagen zu antworten.
(iv) Gleichheit der Wohlfahrt motiviert sich durch die Intuition, dass es das Wohlergehen der Individuen ist, um das es in der politischen Moral geht. Das Wohlfahrtsniveau auszugleichen müsse daher das relevante Gerechtigkeitskriterium sein. Auch diese Auffassung ist jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert.37 Es scheint unplausibel, alle Präferenzen der Personen (gleichermaßen) zu zählen; einige Präferenzen sind aus Gerechtigkeitsgründen unzulässig. Zufriedenheit bei der Erfüllung der Wünsche kann kein Maßstab sein, weil Personen mehr wollen als Glücksgefühle. Als Maßstab für Wohlfahrtsvergleiche kann also nur die Beurteilung des Erfolgs bei der Erfüllung der Präferenzen fungieren. Sie darf jedoch nicht nur auf einem subjektiven Urteil basieren. Für eine gerechtfertigte Beurteilung bedarf es eines Standards, der angibt, was hätte erreicht werden sollen oder können. Dieser setzt wiederum schon eine Annahme über eine gerechte Verteilung voraus, ist also kein unabhängiges Gerechtigkeitskriterium. Ein weiteres beträchtliches Problem jeder an Wohlfahrt ausgerichteten Konzeption von Gleichheit ist, dass Personen mit teurem Geschmack nach dieser Konzeption mehr Ressourcen beanspruchen dürfen; dies verletzt eindeutig moralische Intuitionen, weil der teure Geschmack kultiviert ist. Zudem kann Gleichheit der Wohlfahrt für den Aspekt des Verdienstes38 nicht aufkommen.
(v) Solche Probleme vermeidet die vor allem von John Rawls und Ronald Dworkin vertretene Gleichheit der Ressourcen?39 Sie hält Individuen für ihre Entscheidungen und Handlungen verantwortlich, nicht jedoch für die Umstände ihrer Situation (Verantwortung). Das, was man nicht zu verantworten hat, darf kein Verteilungskriterium sein. Rasse, Geschlecht, Hautfarbe, Intelligenz, soziale Stellung sind als irrelevante Ausnahmegründe ausgeschlossen. Statt dessen sind ungleiche Anteile an sozialen Gütern dann fair, wenn sie sich aus den Entscheidungen und absichtlichen Handlungen der Betreffenden ergeben. Chancengleichheit ist nicht ausreichend, weil für ungleiche natürliche Ausstattung nicht kompensiert wird. Was für soziale Umstände gilt, soll auch für natürliche Gaben gelten. Natürliche Begabungen und soziale Umstände sind beides reine Glücksache und müssen ausgeglichen werden. Damit wird das gängige Verdienstkriterium berücksichtigt, aber deutlich relativiert. Die Menschen sollen eine anfängliche gleiche Ausstattung an Grundgütern als allgemein dienliche Mittel (Rawls) oder Ressourcen (Dworkin) bekommen und können später aufgrund ihres eigenen ökonomischen Handelns durchaus unterschiedliche Mengen an Gütern besitzen. Soziale und ökonomische Ungleichheiten sind nach Rawls bei vorrangiger Sicherung gleicher Grundfreiheiten und -rechte gerecht, wenn sie zwei Bedingungen erfüllen: „erstens müssen sie mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen, und zweitens – das ‚Differenzprinzip‘ – müssen sie sich zum größtmöglichen Vorteil für die am wenigsten begünstigten Gesellschaftsmitglieder auswirken.“40 Ansonsten muss umverteilt werden. Hinter dem für die ursprüngliche Situation der Entscheidung über Prinzipien einer gerechten Gesellschaft unterstellten ‚Schleier des Nichtwissens‘ würde man nach Rawls des Differenzprinzip wählen, weil es sicherstellt, dass man nicht im freien Markt durch die Maschen fällt, und dass es allen besser geht als in einer Situation totaler Gleichverteilung, deren Level mangels Effizienz unter dem des im Differenzprinzip Schlechtestgestellten liegt.
Dworkin beansprucht mit seiner Theorie, noch ‚absichts-sensitiver‘ (‚ambition-sensitive‘) und ‚ausstattungs-insensitiver‘ (‚endowement-insensitive‘) als die Rawlsche Theorie zu sein.41 Er schlägt eine hypothetische Auktion vor, auf der sich jeder bei gleichen Zahlungsmitteln Güterbündel so zusammenstellen kann, dass er am Ende niemandes Güterbündel beneidet. „Equality of resources supposes that the resources devoted to each person’s life should be equal. That goal needs a metric. The auction proposes what the envy test in fact assumes, that the true measure of the social resources devoted to the life of one person is fixed by asking how important, in fact, that resource is for others. It insists that the cost, measured in that way, figures each person’s sense of what is rightly his and in each person’s judgement of what life he should lead, given that command of justice.“42 Auf dem freien Markt hängt es dann von den Ambitionen der Individuen ab, wie sich die Verteilung entwickelt. Die ungerechtfertigten Ungleichheiten aufgrund von unterschiedlicher natürlicher Ausstattung, Begabung und von Glück sollen durch ein differenziertes fiktives Versicherungssystem kompensiert werden, dessen Prämien hinter einem ‚Schleier des Nichtwissens‘ ermittelt werden, um dann im echten Leben auf alle umgelegt und per Steuer eingetrieben zu werden. So soll ein fairer Ausgleich für die natürliche Lotterie erfolgen, der eine ‚Versklavung‘ der talentierten Erfolgreichen durch zu hohe Abgaben verhindert.
(vi) Theorien wie die eben genannten, die sich darauf beschränken, grundlegende Mittel gleich zu verteilen, in der Hoffnung, sie könnten den verschiedenen Zwecken aller Menschen gerecht werden, werden von Amartya Sen kritisiert.43 Wie wertvoll die Güter für jemanden sind, hängt von den Möglichkeiten, der natürlichen Umgebung und den individuellen Fähigkeiten ab. Sen schlägt statt dessen vor, sich an grundlegenden menschlichen Möglichkeiten (capabilities) zur Ausübung bestimmter relevanter Seinsweisen und Tätigkeiten (functionings) bei der Verteilung zu orientieren. „According to the capability approach, the ends of well-being, justice and development should be conceptualized in terms of people’s capabilities to function; that is, their effective opportunities to undertake the actions and activities that they want to engage in, and be whom they want to be. […] What is ultimately important is that people have the freedoms or valuable opportunities (capabilities) to lead the kind of lives they want to lead, to do what they want to do and be the person they want to be. Once they effectively have these substantive opportunities, they can choose those options that they value most. For example, every person should have the opportunity to be part of a community and to practice a religion; but if someone prefers to be a hermit or an atheist, they should also have this option.“44 Die Bewertung des individuellen Wohlergehens muss sich an basalen Funktionsweisen wie Ernährung, Gesundheit, Abwesenheit von Gefahren für das Leben usw. festmachen. Wichtig ist aber auch der Freiheitsaspekt, der in der Möglichkeit, die Art und Weise der Verwirklichung der Funktionsweisen selbst zu wählen, enthalten ist. Capabilities sind daher nach Sen das Maß für die angestrebte Gleichheit der Möglichkeiten des Menschen, sein Leben zu führen.
(vii) Eine andere Konzeption der Gleichheit, die beansprucht, das Desideratum komplexerer Gleichheit zu erfüllen, arbeitet prozedural mittels einer Präsumtion der Gleichheit, d.h. eines prima facie-Gleichverteilungsprinzips für alle politisch zur Verteilung anstehenden Güter:45 Alle Betroffenen sind ungeachtet ihrer empirischen Unterschiede gleich zu behandeln, es sei denn, bestimmte (Typen von) Unterschiede(n) sind in der anstehenden Hinsicht relevant und rechtfertigen durch allgemein annehmbare Gründe eine ungleiche Behandlung oder ungleiche Verteilung. Wenn alle ein Interesse an den zu verteilenden Gütern haben, so zählen die Befriedigung der Präferenzen aller prima facie (in Abwesenheit besonderer Rechtfertigungsgründe) gleich viel, weil die Personen gleich viel zählen. Wer mehr will, schuldet den anderen eine angemessene allgemeine und reziproke Rechtfertigung. Wenn es keinen Grund für eine Ungleichverteilung, den alle im Prinzip anerkennen können, gibt, dann ist Gleichverteilung die einzige legitime Verteilung. Gleichverteilung ist damit nicht eine unter vielen Alternativen, sondern die unvermeidliche Ausgangsposition, sofern man die Rechtfertigungsansprüche aller als gleichberechtigt ernst nimmt. Diese Präsumtion der Gleichheit gibt ein elegantes Verfahren für die Konstruktion einer Theorie der Verteilungsgerechtigkeit ab.
Folgende Fragen müssten allerdings beantwortet werden, um zu einem inhaltlich gefüllten Gerechtigkeitsprinzip zu kommen: Welche Güter und Lasten stehen zur Verteilung (bzw. sollten zur Verteilung stehen)? Was sind die sozialen Güter, die den Gegenstand gerechter Gleichverteilung abgeben? An wen soll verteilt werden? Wer hat prima facie einen Anspruch auf einen fairen Anteil? Was sind die gerechtfertigten Ungleichheiten je nach Sphäre oder Güterklasse? Dabei werden viele Aspekte der genannten Theorien egalitärer distributiver Gerechtigkeit eine wesentliche Rolle spielen.
(viii) Ist Gleichheit ein Wert an sich?46 Viele Egalitaristen sind heute bereit zuzugestehen, dass Gleichheit im Sinne von Gleichheit der Lebensumstände keinen starken Wert an sich hat, sondern ihre Bedeutung im Rahmen liberaler Gerechtigkeitskonzeptionen im Zuge der Verfolgung anderer Ideale erhält – wie Freiheit für alle, volle Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten und der Persönlichkeit, die Beseitigung von Leid, Dominanz und Stigmatisierung, stabiler Zusammenhalt moderner freiheitlich verfasster Gesellschaften etc. Dies öffnet die Tür für die kritische Anfrage, ob nicht ein anderer Gesichtspunkt als Gleichheit der Lebensumstände (auch für Egalitaristen) das Kriterium der Verteilungsgerechtigkeit ist. Alternativen sind zum einen die Sicherung eines hinreichend guten Auskommens für jeden (Suffizienz)47 und zum anderen die vorrangige Verbesserung der Situation der Schlechtergestellten (priority view).48 Beides ist in der Tat dringlich, der Egalitarismus will aber mehr, weil er Gleichheit als einen wichtigen Wert an sich betrachtet.
1 Der folgende Text geht auf einen bereits publizierten Artikel zurück und ist eine überarbeitete Fassung meines Artikels „Gleichheit/Ungleichheit“ (erschienen in: Enzyklopädie der Philosophie, hrsg. von Hans Jörg Sandkühler, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Hamburg 2010, Band 1, 919–924).
2 Vgl. Westen, Peter, 1990, Speaking Equality, Princeton: Princeton University Press.
3 Dann, Otto, 1975, „Gleichheit“, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Hrsg. V. O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Stuttgart: Klett-Cotta 1975, 995–1046, hier: 997; vgl. auch Menne, Alfred, 1962, „Identität, Gleichheit, Ähnlichkeit“, Ratio, 4: 44 ff.
4 Tugendhat, Ernst; Ursula Wolf, 1983, Logisch-Semantische Propädeutik, Stuttgart: Reclam, 169.
5 Westen, Peter, 1990, Speaking Equality, Princeton: Princeton University Press, 10.
6 Rawls, John, 1975 (1971), Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 21.
7 Rae, Douglas, et al., 1981, Equalities, Cambridge: Harvard University Press, 127f., 132f.
8 Rae, Douglas, et al., 1981, Equalities, Cambridge: Harvard University Press, 170.
9 Westen, Peter, 1990, Speaking Equality, Princeton: Princeton University Press, Kap. 3.
10 Berger, Peter A. & Schmidt, Volker H. (Hrsg.), 2004, Welche Gleichheit, welche Ungleichheit? Grundlagen der Ungleichheitsforschung, Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
11 Benn, Stanley, 1967, „Equality, Moral and Social“, in: Encyclopedia of Philosophy, Hrsg. Paul Edwards, New York: Macmillan, 1967, Band 3. 38–42; Albernethy, Georg L. (Hrsg.), 1959, The Idea of Equality, Richmond: John Knox; Lakoff, Sandford A., 1964, Equality in Political Philosophy, Cambridge: Harvard University Press; Thomson, David, 1949, Equality, Cambridge: Cambridge University Press.
12 Aristoteles, 1967, Nikomachische Ethik, Zürich–München, V.3. 1131al0–bl5; Aristoteles, 1971, Politik, Zürich–München, III.9.1280 a8–15, III. 12. 182bl8–23.
13 Berlin, Isaiah, 1955–56, „Equality“, Proceedings of the Aristotelian Society LVI, 301–326.
14 Aristoteles, 1971, Politik, Zürich–München, 1282b 22.
15 Nagel, Thomas, 1994 (1991), Eine Abhandlung über Gleichheit und Parteilichkeit und andere Schriften zur politischen Philosophie, Paderborn: Ferdinand Schöningh; Rae, Douglas, et al., 1981, Equalities, Cambridge: Harvard University Press; Sen, Amartya, 1992, Inequality Reexamined, Oxford: Clarendon Press, Cambridge: Harvard University Press, 13.
16 Platon, 1958, Nomos, in: Platon, Sämtliche Werke, Band 6, Hamburg: Rowohlt, 757b–c; Aristoteles, 1967, Nikomachische Ethik, Zürich–München, 1130b–1132b.
17 Plarton, 1958, Politeia, in: Platon, Sämtliche Werke, Band 3, Hamburg: Rowohlt, 331e, 332b–c; Ulpianus, Domitius, 1854, Fragementa, Bonn, 1,1,10.
18 Vgl. Gosepath, Stefan & Lohmann, Georg (Hrsg.), 1998, Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
19 Hobbes, Thomas, 1651, Leviathan, With Selected Variants from the Latin Edition of 1668, Hrsg. Edwin Curley, Indianapolis: Hackett 1994.
20 Locke, John, 1690, The Second Treatise of Government, Hrsg. C. B. MacPerson, Indianapolis: Hackett 1980.
21 Rousseau, Jean-Jacques, 1755, A Discourse on Inequality, London: Penguin 1984, partly reprinted in L. Pojman & R. Westmoreland (Hrsg.), Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1997, 36–45; Rousseau, Jean-Jacques, 1762, The Social Contract, Engl. trans. Maurice Cranston. Harmondsworth: Penguin 1987.
22 Kant, Imanuel, 1785, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Kants Gesammelte Schriften, Hrsg. Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902ff., Band IV.
23 Kant, Imanuel, 1797, Metaphysik der Sitten, In: Kants Gesammelte Schriften, Hrsg. Preußische Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902ff., Band VI, AA 231.
24 Barbeuf, G., 1796, „Manifeste de Égaux“, in: Histoire de G. Barbeuf et du Babouvisme, Paris 1884, engl. trans. in L. Pojman & R. Westmoreland (Hrsg.), Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1997, 49–52.
25 Vlastos, Gregory, 1962, „Justice and Equality“, in: R. Brandt (Hrsg.), Social Justice, Englewood Cliffs: Prentice-Hall; reprinted in: J. Waldron (Hrsg.), Theories of Rights, Oxford: Oxford University Press 1984, 41–76; reprinted in L. Pojman & R. Westmoreland (Hrsg.), Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1997, 120–133.
26 Kymlicka, Will, 1996 (1990), Politische Philosophie heute, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
27 Dworkin, Ronald, 1995 (1977), Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 370.
28 Marshall, Thomas Humphrey, 1950, „Citizenship and Social Class“, in: T. Marshall, Citizenship and Social Class and Other Essays, Cambridge: Cambridge University Press 1950, reprinted London (Pluto) 1981, 1992.
29 Marx, Karl, 1978 (1875), Kritik des Gothaer Programms, in: Marx-Engels-Werke(MEW) Bd. 19, Berlin, 13–32, hier: 20f. Vgl. Kymlicka, Will, 1996 (1990), Politische Philosophie heute, Frankfurt am Main: Suhrkamp, Kap. 5.
30 Krebs, Angelika (Hrsg.), 2008, Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
31 Frankfurt, Harry, 1987, „Equality as a Moral Idea“, Ethics, 98: 21–42, hier: 34.
32 Nozick, Robert, 1974, Anarchy, State, and Utopia, New York: Basic Books; Hayek, Friedrich A., 1960, The Constitution of Liberty, London: Routledge.
33 Cohen, Gerald A., 1989, „On the Currency of Egalitarian Justice“, Ethics, 99: 906–944; Arneson, Richard, 1993, „Equality“, in: R. Goodin & P. Pettit (Hrsg.), A Companion to Contemporary Political Philosophy, Oxford: Blackwell, 489–507.
34 Okun, Arthur M., 1975, Equality and efficiency: The Big Tradeoff, Washington: The Brookings Institution.
35 Walzer, Michael, 1992 (1983), Sphären der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp; Young, Iris Marion, 1990, Justice and the Politics of Difference, Princeton: Princeton University Press.
36 Walzer, Michael, 1992 (1983), Sphären der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
37 Vgl. Dworkin, Ronald, 1981, „What is Equality? Part 1: Equality of Welfare“, Philosophy and Public Affairs 10, 185–246, reprinted in: R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge: Harvard University Press 2000, 11–64.
38 Vgl. Feinberg, Joel, 1970, „Justice and Personal Desert“, in: J. Feinberg, Doing and Deserving, Princeton, reprinted in: Louis P. Pojman & Owen McLeod (Hrsg.), What Do We Deserve? A Reader on Justice and Desert, Oxford (Oxford University Press) 1998. 70–83.
39 Vgl. Rawls, John, 1975 (1971), Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp; Dworkin, Ronald, 1981, „What is Equality? Part 2: Equality of Resources“, Philosophy and Public Affairs 10, 283–345, reprinted in: R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge: Harvard University Press 2000, 65–119.
40 Rawls, John, 1998, Politischer Liberalismus, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 69; Rawls, John, 1975 (1971), Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 336.
41 Dworkin, Ronald, 1981, „What is Equality? Part 2: Equality of Resources“, Philosophy and Public Affairs 10, 283–345, reprinted in: R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge: Harvard University Press 2000, 65–119.
42 Dworkin, Ronald, 1981, „What is Equality? Part 2: Equality of Resources“, Philosophy and Public Affairs 10, 283–345, hier: 284; reprinted in: R. Dworkin, Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality, Cambridge: Harvard University Press 2000, 65–119.
43 Sen, Amartya, 1992, Inequality Reexamined, Oxford: Clarendon Press, Cambridge: Harvard University Press.
44 Robeyns, Ingrid, 2005, „The Capability Approach: a theoretical survey“, Journal of Human Development, 6, 93–114, hier: 95.
45 Gosepath, Stefan, 2004, Gleiche Gerechtigkeit. Grundlagen eines liberalen Egalitarismus, Frankfurt: Suhrkamp, Kap. II.8; Hinsch, Wilfried, 2002, Gerechtfertigte Ungleichheiten, Berlin–New York: de Gruyter; Tugendhat, Ernst, 1997, Dialog in Letitia, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, Kap. III; Williams, Bernard, 1973, „The Idea of Equality“, in: B. Williams, Problems of the Self, Cambridge: Cambridge University Press, 230–249, reprinted in L. Pojman & R. Westmoreland (Hrsg.), Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1997, 91–102; Bedau, Hugo Adam, 1967, „Egalitarianism and the Idea of Equality“, in: J. R. Pennock, J. Chapman (Hrsg.), Equality, New York: Atherton, 3–27, hier: 19.
46 Raz, Joseph, 1986, The Morality of Freedom, Oxford; Frankfurt, Harry, 1987, „Equality as a Moral Ideal“, Ethics, 98: 21–42; reprinted in: H. Frankfurt, The Importance of What We Care About, Cambridge University Press 1988; reprinted in: L. Pojman & R. Westmoreland (Hrsg.), Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1997, 261–273; Scanlon, Thomas, 1996, „The Diversity of Objections to Inequality“, in: The Lindley Lecture, Lawrence, KA: The University of Kansas; reprinted in T. Scanlon, The Difficulty of Tolerance: Essays in Political Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
47 „What is important from the moral point of view is not that everyone should have the same but that each should have enough. If everyone had enough, it would be of no moral consequence whether some had more than others.“ Frankfurt, Harry, 1987, „Equality as a Moral Ideal“, Ethics, 98: 21–42, hier: 21; reprinted in: H. Frankfurt, The Importance of What We Care About, Cambridge University Press 1988; reprinted in: L. Pojman & R. Westmoreland (Hrsg.), Equality. Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1997, 261–273.
48 Parfit, Derek, 1997, „Equality and Priority“, Ratio, 10: 202–221.