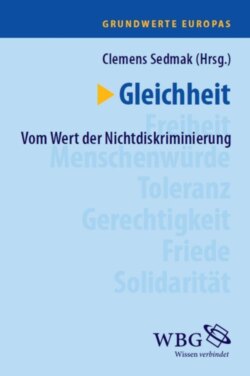Читать книгу Gleichheit - Группа авторов - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Gleichheit und soziale Gerechtigkeit: Arbeit und Wohlfahrtsstaat
ОглавлениеGleichheit wurde bislang nur implizit thematisiert und es herrscht auch keine Einigkeit darüber, welche Stelle und Funktion sie in einer Theorie der Anerkennung inne hat oder inne haben sollte. Zunächst ist sie vor allem in der Anerkennungsform der Achtung, die sich idealtypisch als Recht realisiert, zu verorten. Achtung basiert auf der Einsicht, dass alle Menschen Personen mit gleicher Würde und ihrem Gattungswesen nach vernünftig und autonom sind. Alle Menschen sind gleich in Bezug auf ihre Würde, daher stehen ihnen auch alle gleiche Rechte und Pflichten zu. Doch auch hier ist wiederum nur die Form bzw. das allgemeine Prinzip der Anerkennung vorgezeichnet, dessen Inhalt erst konkretisiert werden muss und auch auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sein kann. Dies bezieht sich dann in einem universalen Maßstab auf Menschenrechte, in einem nationalen Maßstab auf jeweils spezifische Staatsbürgerrechte und kann sich in einem organisatorischen Maßstab auf Mitgliederrechte beziehen. Immer ist es das Prinzip der Verallgemeinerung und des Absehens von bestimmten Eigenschaften, welches der Achtung zu Grunde liegt. Geachtet wird jemand unabhängig davon, was er oder sie leistet, oder was er oder sie für spezifische Eigenschaften und Vorlieben hat, sondern nur gemäß der unverfügbaren Eigenschaft als autonomes Wesen bzw. als Mitglied eines bestimmten Kontextes. Das heisst gerade nicht, dass hier keine Exklusionsmechanismen wirken können, ja, diese sind gerade die idealtypische Form der Missachtung, wenn es um Anerkennung in der Form der Achtung geht. Dann finden Prozesse der Entmenschlichung und Entrechtung statt, wie sie in Diktaturen, rassistischen Gesetzen oder Diskriminierungen anzutreffen sind. Diese Erfahrungen der Missachtung ruhen darauf, dass hier eine ungleiche Behandlung bis hin zu offener Feindseligkeit und Angriffen vorliegt, wo doch Gleichheit angestrebt werden sollte. In solchen Kontexten, die von Achtung geprägt sein sollten, ist die gleiche Verteilung von Gütern, Vor- und Nachteilen das Ziel und die gerechte Form der Verteilung. Alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben die gleichen Rechte und Pflichten, die gleichen Freiheiten und sind gleich vor dem Gesetz, um nur einige mögliche Beispiele zu nennen.
Aber auch in den anderen beiden Formen von Anerkennung ist Gleichheit von Bedeutung und ist implizit angesprochen. Gleichheit ist hier jedoch zumeist kein Wert für sich, sondern nur eine Bedingung, um andere Ziele zu erreichen. Personale Zuwendung zielt aber ebenso wie soziale Wertschätzung vor allem die Differenzierung zwischen Menschen entlang unterschiedlicher Merkmale, von denen das Prinzip der Achtung gerade absieht. Der Bereich der Liebe, Freundschaft und der emotionalen Fürsorge ist auf den Einzelnen als gerade nicht austauschbare und einzigartige Person ausgerichtet, in dem Gleichheit keine oder nur eine stark untergeordnete bzw. abgeleitete Rolle spielt. Partnerinnen und Partner, Freunde und Familie werden eben gerade nicht gleich behandelt, Zuwendungen, Gefühle und Sympathie sind keine Güter, die nach Bedarf hergestellt und verteilt werden könnten.13 Dies macht gerade ihre Besonderheit aus. Damit ist nicht gesagt, dass hier gerechtigkeitstheoretische Überlegungen keine Rolle spielen können und sollen, sie treffen jedoch auf spezifische Schwierigkeiten, weshalb dieser Bereich auch in vielen Theorien der sozialen Gerechtigkeit ausgespart bleibt. Ebenso wirft der Anspruch auf soziale Wertschätzung Schwierigkeiten auf, die mit der Spezifität dieser Anerkennungsform zu tun haben. Wird soziale Wertschätzung gleich verteilt, so verliert sie ihre Funktion und ihren Wert, sie kann nicht mehr besondere Leistungen, Eigenschaften und Tätigkeiten auszeichnen. Anerkennung wird dann leer, ja sie kann sogar als Missachtung erfahren werden.14 Wenn zwei Personen Unterschiedliches leisten, sei es im Beruf oder im Privatleben, dafür jedoch die selbe Wertschätzung erhalten, so kann dies als Nichtbeachtung oder als Geringschätzung erfahren werden. Jeder Mensch bedarf, und dies ist ja der Hintergrund einer Theorie der Anerkennung, eben jener Anerkennung seiner Besonderheit. Besonders ist aber jeweils nur, was eine Differenz ausdrückt und nicht von allen gleichermaßen geteilt oder erhalten wird. Gleichheit ist dann jedoch wiederum gefordert, wenn es um illegitime Differenzen geht. Wenn zwei die selbe Arbeitsleistung erbringen, dafür jedoch nur auf Grund der Hautfarbe unterschiedlich entlohnt werden, so ist dies keine legitime Differenzierung gemäß Besonderheit. Offensichtlich kommen hier, wie in fast allen Fällen und Kontexten, zwei Anerkennungsformen, nämlich Achtung und soziale Wertschätzung, zusammen und können sich ergänzen aber auch zu Konflikten führen. Gleichheit ist immer nur insoweit gefordert als keine guten Gründe für eine Ungleichverteilung bestehen und es ist prinzipiell nicht ausreichend, dass alle das Gleiche erhalten, wenn sie unterschiedliche Anerkennungsansprüche, sei es auf Grund von bedarf oder Verdienst, besitzen.
Damit will ich auf die beiden Kontexte von Wohlfahrtsstaat und Erwerbsarbeit zu sprechen kommen und an ihnen eine Spannung, die ich als jene zwischen Gleichheit und Differenz bezeichnen möchte, aufzeigen. Idealtypisch ist der Wohlfahrtsstaat eine die Gesellschaft übergreifende Institutionalisierung von Anerkennungsansprüchen, die sich vornehmlich auf den Bereich des Schutzes und der Anerkennung von legitimen physischen, psychischen und sozialen Bedürfnissen beziehen, die über den Bereich der Anerkennung von Freiheitsrechten hinausgehen.15 Hier werden Ansprüche des Bedarfs in rechtliche Ansprüche transformiert und damit in ein Anerkennungsverhältnis der Achtung überführt. Dabei sind immer auch Elemente der sozialen Wertschätzung und des Verdiensts enthalten, die sich in der Differenzierung von Ansprüchen und der Finanzierung ausdrücken. Jene, die mehr einzahlen, erhalten in einigen Bereichen mehr (etwa Arbeitslosenversicherung und Pensionsansprüche), während in anderen Bereichen alle das gleiche bekommen (etwa die Familienbeihilfe in Österreich), während in anderen Bereichen nach Bedarf Leistungen gestellt werden, die dann aber für alle, die ihrer bedürfen, gleich sind (etwa in der Gesundheitsversorgung). All diese Leistungen des Wohlfahrtsstaates können als Formen der Anerkennung rekonstruiert werden, die auf unterschiedliche Bedürfnisse und Dimensionen der Verletzbarkeit reagieren und diese schützen, andererseits aber auch Systeme der zeitlich verschobenen Anerkennung für vergangene Leistungen und Verdienste darstellen. Idealtypisch sind hierfür Pensionsansprüche, in denen diachrone und synchrone Elemente der Anerkennung vereint werden. Einerseits ist die Absicherung im Alter eine Grundleistung für alle jene, die eben gerade alt sind und eine Pension benötigen, andererseits sind diese als Ansprüche nicht nur als Absicherung zum Lebenserhalt begründet, sondern auch wesentlich in der vorher erbrachten Leistung und des Einzahlens in die sozialen Sicherungssysteme. Hier kommen also Anerkennungsansprüche in den Formen der Achtung, des Bedarfs und des Verdienstes zusammen und stützen sich gegenseitig, können aber auch konfligieren. Die Umverteilungsfunktion des Wohlfahrtsstaates ist selbst Bestandteil dieses Anerkennungsverhältnisses, indem es spezifische soziale, symbolische und materielle Anerkennungsformen für alle Bürgerinnen und Bürger sicher stellt und hierfür die Mittel derer einsetzt, die höhere Einkommen erzielen.
Die Ausweitung der wohlfahrtsstaatlichen Funktionen und Ansprüche kann dabei als ein historischer Fortschritt angesehen werden, der einerseits den Einzelnen entlastet und absichert, andererseits dadurch neue Freiheitsspielräume eröffnet, aber auch zu Restriktionen führt. Sicherheit wird über den Preis der Institutionalisierung von Lebensläufen und Biographien entlang mehr oder weniger starr vorgegebener Muster erkauft.16 Der Wohlfahrtsstaat wirkt inkludierend, indem er Bildung, Gesundheit, Wohlstand, soziale und politische Teilhabe für eine größere Bevölkerungsmehrheit sicher stellt und egalisiert. Viele dieser Leistung sind dann auch das Resultat jahrzehntelanger Anerkennungskämpfe, insbesondere der erwerbstätigen Bevölkerung, die soziale Sicherung von der Arbeitsleistung unabhängig zu machen und sind dahingehend auch unmittelbar mit dem Kontext der Erwerbsarbeit verknüpft. Der Wohlfahrtsstaat ist zumindest teilweise ein Produkt der Auslagerung von Anerkennungsansprüchen aus dem privaten, betrieblichen Bereich in den öffentlichen, staatlichen, um diese auf eine breitere Basis zu stellen, also den Kreis der Betroffenen auszuweiten, als auch abzusichern gegenüber der Willkür der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Diese Absicherung ist dann demokratisch legitimiert und politisch institutionalisiert worden.
Der Bereich der Erwerbsarbeit wiederum ist idealtypisch durch die Anerkennungsform der sozialen Wertschätzung und somit von Differenzierung geprägt. Das maßgebliche Verteilungsprinzip ist nicht Gleichheit und auch nicht Bedarf, sondern Verdienst und Leistung. Zwei Kategorien, die auch außerhalb der Erwerbsarbeit normatives Gewicht beanspruchen und zur Legitimation von Ansprüchen und Praktiken genutzt werden.17 Der Arbeitsmarkt vergibt Positionen, Einkommen und sozialen Status – wiederum idealtypisch – an jene, die sich hierfür durch Leistungserfüllung qualifiziert haben. Dabei sind mehrere Konzepte prekär und bislang auch im Bereich der normativen Philosophie weitgehend ungeklärt. Was als Leistung, welche Art der Anerkennung verdient ist, unterschiedet sich zwischen Berufen und Sektoren erheblich. Die Einkommensschere ist nur ein Ausdruck davon. Leistung wird demgemäß unterschiedlich gedeutet und zur Anwendung gebracht: es können rein ökonomische Kriterien angelegt werden, Kriterien des Aufwands und des Erfolgs, aber auch soziale Kriterien, Seniorität und der Nutzen für das Gemeinwohl oder solche, die noch schwerer zu messen sind, wie Innovation und Mitarbeiterführung. Die Kehrseite der Medaille ist die Produktion von Missachtung und sozialem Leid durch und im Arbeitsmarkt. Dies kann dabei vornehmlich zwei Formen annehmen: Einerseits ist hier der unfreiwillige Ausschluss aus dem Arbeitsmarkt durch Arbeitslosigkeit zu nennen. Hier wird der Zugang zu einer wichtigen Anerkennungsressource, Erwerbsarbeit, unterbunden und gleichzeitig ist die Situation der Arbeitslosigkeit, insbesondere, wenn sie längere Zeit anhält, selbst mit vielfältigen Formen der Missachtung verbunden und wird von Betroffenen mitunter als leidvoll erfahren.18 Andererseits ist die Erwerbsarbeitswelt selbst gebrochen und mit Belastungen verbunden. Verstärkt auch durch den Matthäuseffekt19, also die Kumulation von Vorteilen, stehen einer gut abgesicherten, einkommensstarken und vernetzten Gruppe zunehmend Menschen in perkarisierten und flexibilisierten Beschäftigungs- und Arbeitsverhältnissen gegenüber.20 Prekarität kann ebenso wie die in manchen Bereichen, sicherlich nicht allen, anzutreffende Subjektivierung und Entgrenzung von Arbeit21 als strukturelle Verunsicherung beschrieben werden, die von vielen, wiederum nicht allen, Betroffenen als leidvoll erfahren werden, eben weil ihre Anerkennungsansprüche nicht eingelöst werden.22 Aber auch die Zunahme von psychischen Belastungen und Störungen durch und in der Erwerbsarbeit können dahingehend interpretiert werden.23
Der Leistungsmodus in der Erwerbsarbeit steht nun in einem Spannungsverhältnis zum Bedarfsmodus und der Gleichheitsidee des Wohlfahrtsstaates. Diese wurde explizit von Hans-Christoph Schmidt am Busch aufgezeigt, dass der Marktmechanismus zur Verteilung von Einkommen mit der Umverteilungsfunktion des Wohlfahrtsstaat in Konkurrenz tritt und bei den Betroffenen, sowohl bei jenen, die vom Marktmechanismus als auch bei jenen, die vom Wohlfahrtsstaat profitieren, unterschiedliche Motivationen und Anerkennungsansprüche erzeugt. Es gibt, aus Perspektive einer Theorie der Anerkennung, gute Gründe in Konkurrenz zum Wohlfahrtsstaat seine eigenen Anerkennungsansprüche aus der Erwerbsarbeit, also vor allem auch sein Einkommen, zu maximieren wie es auch gute Gründe gibt, sich gegen die Marktverteilung zu positionieren und vom Wohlfahrtstaat maximale Umverteilung, und damit Bedarfssicherung und Gleichheit, zu beanspruchen.
„Ein Unternehmer, der nach Maßgabe sozialer Wertschätzung besser gestellt wäre, wenn er sich finanziell nicht an der Aufrechterhaltung eines öffentlichen Rentensystems beteiligen würde, wird einen Grund haben, seine Befürwortung dieser Institution (sowie der entsprechenden Ansprüche und Rechte) in Frage stellen; und ein Angestellter, der durch einen individuell ausgehandelten Arbeitsvertrag ein höheres Einkommen erzielen kann als durch einen tarifvertraglich vereinbarten, wird einen Grund haben, an der Berechtigung tariflicher Vereinbarungen zu zweifeln. Wie diese Beispiele zeigen, ist es fraglich, ob eine auf marktwirtschaftlich ermittelten gesellschaftlichen Nutzen von Arbeitsleistungen abstellende Praxis sozialer Wertschätzung tatsächlich keine negativen Auswirkungen auf die gesellschaftliche Anerkennung von sozialen Rechten hat.“24
Der Kern des Problems liegt also in der normativen Wertigkeit von sozialer Wertschätzung, die in einer Theorie der Anerkennung nicht nur eine motivationale Funktion hat, sondern als integraler Bestandteil von sozialer Gerechtigkeit konzipiert wird. Leistungsgerechtigkeit tritt in Konkurrenz zu einer auf Bedarf und Gleichheit ruhenden Verteilung, weil diejenigen, die nach dem gängigen Marktverständnis mehr leisten, die beiden anderen Anerkennungsansprüche für ihr Mitbürgerinnen und Mitbürger (mit)finanzieren und erhalten. Die diskursiven aber auch politischen und, in manchen Ländern auch gewaltsamen, öffentlichen Auseinandersetzungen, um die Umgestaltung des Wohlfahrtsstaates, um soziale Gerechtigkeit, Einkommen, Armut und Pensionen sind zu einem guten Teil von diesen, sich widersprechenden Motiven und Anerkennungsansprüchen getragen, wobei die Tendenz zur Zeit dem marktförmigen Leistungsdenken immer größere Bedeutung zumisst. Auch die Bedarfsabsicherung, insbesondere bei Arbeitslosigkeit, wird zusehends an Leistungen der Empfängerinnen und Empfänger geknüpft, die auch durch Strafen und Kontrollen abgesichert werden.25 Hierbei wird auch der Maßstab der Leistung selbst, nämlich Erfolg am Markt, selbst nicht problematisiert, sondern als die beste, ja einzig mögliche Bestimmung und Verteilung von sozialer Wertschätzung, also auch Einkommen, gesetzt. Alternativen sind selbst bei Honneth, der seine Theorie der Anerkennung immerhin als kritisch bezeichnet, nicht auszumachen.26 Die Ideen der Gleichheit und der Bedarfssicherung, jenseits des Marktes und unabhängig von Leistung, geraten unter Druck und werden zusehends ausgehebelt. Neben den der Erwerbsarbeit in ihrer heutigen Form und Organisation inhärenten sozialen Pathologien beeinflusst der Marktmechanismus auch außerhalb der Erwerbsarbeit Zonen der sozialen Welt und der Gesellschaft, die eigentlich Refugien der Entlastung von Arbeit sein sollten. Weitere Beispiel für diese Spannung zwischen sozialer Wertschätzung und Gleichheit sind in den Bereichen der Bildung, der sozialen Teilhabe oder der Gesundheit auszumachen. Überall, wo die Kumulation von Vorteilen in der Erwerbsarbeit sich auf die Verteilung von Gütern, Vor- und Nachteilen und Fähigkeiten überträgt, die eigentlich nach dem Prinzip der Gleichheit auf Grund der gleichen Achtung der Würde aller Menschen zugänglich und gesichert werden sollten, treten ähnlich gelagerte Konflikte auf. Die marktgestützte Einkommensverteilung als soziale Wertschätzung ist damit wesentlich einflussreicher und nicht auf den Markt und die Erwerbsarbeit beschränkt.
Eine einfache Lösung für diese Spannung zwischen Leistungsmechanismus und der Idee der Gleichheit ist im Rahmen einer Theorie der Anerkennung nicht zu finden, eben weil sie nicht die Option ziehen will, Verdienst und Leistung als normative Quelle von Ansprüchen und als gerechtes Verteilungsprinzip aufzugeben. Diese, sowohl aus Perspektive des Egalitarismus wie aus jener der Suffizienz oft vertretene Option, würde zumindest alle wichtigen Güter, darunter auch Einkommen und Vermögen, nach gänzlich anderen Prinzipien verteilen als Verdienst. Eine andere, vielversprechendere Option, die sich aus Perspektive einer Theorie der Anerkennung nahe legt, wäre die Umdeutung von Leistung und sozialer Wertschätzung selbst, um sie der bloßen Willkür des Marktes zu entziehen und verstärkt andere Kriterien einzufordern. Soziale Wertschätzung könnte dann nicht nur Resultat von Markterfolg sein – auch wenn dies weiter eine wichtige Quelle von Anerkennung bleiben wird – sondern vor allem auch die gerechte Anerkennung für sozial wertvolle Tätigkeiten, insbesondere auch abseits des formellen Marktes oder in solchen Bereichen, die tendenziell zu wenig Anerkennung finden (etwa Pflege und Reproduktionsarbeit).27 Eine andere Option wäre dem Markt und der Erwerbsarbeit prinzipiell seine Anerkennungsfunktion zu entziehen oder diese zu schwächen und in andere Bereiche, etwa die Politik, die Freizeit oder Gemeinwohltätigkeiten zu übertragen. So lange moderne Gesellschaften jedoch Arbeitsgesellschaften sind, in denen Arbeit der wichtigste Anerkennungsmodus ist, ist es sehr schwer, adäquate Räume außerhalb der Erwerbsarbeit zu sichern, die nicht selbst wiederum mit einem Stigma behaftet sind.
Als Forderung bestehen bleibt dann die Sicherung der Gleichheitsidee und die Versorgung bei Bedarf, die nicht zu einem Tauschgeschäft für Erfolg oder Mühen am Arbeitsmarkt verkommen darf, um damit die Unterwerfung unter Marktmechanismen, die notwendigerweise Gewinner und Verlierer produziert, zu erreichen. Vielmehr ist auch gegen solche Ansprüche, die auf marktlich eingeforderter sozialer Wertschätzung beruhen, die Inklusion aller Gesellschaftsmitglieder in gesicherte Anerkennungsverhältnisse zu fordern, in denen überhaupt erst Liebe und personale Zuwendung, Rechte und Pflichten, politische und soziale Teilhabe möglich sind. Wenn die drei Anerkennungsformen (Liebe, Achtung und soziale Wertschätzung) die intersubjektiven Bedingungen eines gelungen und autonomen Lebens abbilden, dann sind auch die Spannungen zwischen diesen dreien so auszuhalten, dass nicht eine von ihnen und nur zum Nutzen weniger Bevölkerungsgruppen die Oberhand gewinnt. Eine stringente Argumentationslinie hierfür müsste dann die Priorität von Bedarf und Gleichheit vor sozialer Wertschätzung auch immanent und in Bezug auf empirische Erkenntnisse untermauern. Ein Desiderat der Forschung, welches ich hier nicht einholen kann. Honneth hat hierfür die Richtung angedeutet.
„Vielmehr bedarf es stets auch einer reflexiven Überprüfung der Grenzen, die sich zwischen den Hoheitsgebieten der unterschiedlichen Anerkennungsprinzipien jeweils etabliert haben, weil nie der Verdacht auszuschließen ist, daß die gegebene Arbeitsteilung zwischen den moralischen Sphären die Chancen der individuellen Identitätsbildung beeinträchtigt; und nicht selten wird eine derartige Infragestellung zu dem Ergebnis gelangen, daß eine Ausweitung von individuellen Rechten vonnöten ist, da unter dem Regime der normativen Prinzipien von ‚Liebe‘ oder ‚Leistung‘ die Bedingungen von Respekt und Autonomie nicht hinreichend gewährleistet sind.“28