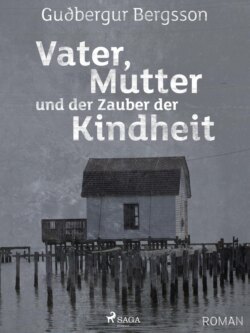Читать книгу Vater, Mutter und der Zauber der Kindheit - Gudbergur Bergsson - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Hausbau
ОглавлениеMeine Eltern, Jóhanna Guđleif Vilhjálmsdóttir und Bergur Bjarnason, nahmen uns Jungen mit, meinen älteren Bruder und mich, als sie zum zweiten Mal, diesmal vom Hochland herab, mit ihrem ganzen Hausstand ins Ungewisse umsiedelten, wo sie keinerlei Bleibe hatten und nirgends unterkamen, außer in der Dorfschule. Dort wurden wir vorübergehend einquartiert, unser gesamtes Hab und Gut neben uns auf einer Matratze auf dem Boden ausgebreitet. Mama kochte auf einem kleinen Petroleumofen, der »Gasmaschine«, und Wasser bekamen wir entweder von den Nachbarn oder holten es, brackig und von weit her, in einer Milchkanne. In der Fangsaison des folgenden Winters hatte Papa das Glück, auf einem der Boote des örtlichen Reeders anmustern zu dürfen, und Mutter ging bei ihm und seiner Frau in Stellung. Dort war sie das, was man damals eine Saison- oder Teilfrau nannte, und durfte uns Jungen mit zur Arbeit bringen. Das Haus trug einen Namen, Höfn, und das Reederpaar hatte zwei Söhne ungefähr in unserem Alter, die Hafenjungs, wie sie gerufen wurden, obwohl es zwischen ihnen auch noch eine Schwester gab; die aber blieb bei der Namensvergabe unbeachtet. Die Sprache sah so etwas nicht vor, und außerdem war das Mädchen in der Minderheit, obwohl es in Wahrheit in allem den Ton angab. Das Hafenhaus lag draußen auf der Landzunge Nes und somit in einiger Entfernung von den anderen Häusern des Ortes, sechzehn Stück, die sich im sogenannten Þorkatlastađir-Viertel zusammendrängten. Höfn war nicht allzu weit von der Schiffslände entfernt erbaut worden. Und außer ihm standen noch zwei weitere Häuser auf Nes.
Im Frühjahr, als die Fangzeit zu Ende ging, durften wir weiter in Höfn wohnen bleiben. Wahrscheinlich weil die Hausbesitzer so nette Menschen waren, brauchten wir Matratze und Deckbett, den einen Topf zum Kartoffelkochen, die Waschschüssel, Milchkannen, Besteck und zwei Nachttöpfe nicht wieder vorübergehend in die Schule zu tragen, obwohl das nahegelegen hätte, denn von dort war es nicht weit zu der Stelle, an der mein Vater begonnen hatte, das dritte Heim seiner Ehe zu bauen. Wir blieben auch den nächsten Winter noch in Höfn. Bis dahin hatte mein Vater unser Haus sturmsicher unter Dach und abgedichtet und auf diese Weise der Ortschaft ein weiteres Gebäude hinzugefügt, die doch ziemlich weit vom Strand und den Fischerbooten entfernt stand, die am Ende der Saison fein säuberlich auf dem Flutkamm aufgereiht lagen und mit dem Bug zum Sonnenuntergang im Westen, mit dem Heck zum Sonnenaufgang im Osten zeigten.
Jeden Mittag brachte Mutter meinem Vater das Essen. Wir Brüder begleiteten sie in der Regel, um zu sehen, wie sich aus den Bretterstapeln allmählich unser zukünftiges Zuhause erhob und wie aus dem Formlosen eine sinnreiche Form erwuchs. Wir verfolgten jeden von Papas Handgriffen in der Hoffnung, auch einmal für einen kurzen Moment eines seiner Werkzeuge halten zu dürfen, vor allem die Sägen und Hobel, die einem mit ihren Zähnen und Zungen gefährlich werden konnten. Die Versuchung war groß, denn es hieß, man könne sich selbst und andere damit tödlich verletzen, und also waren es ganz besonders faszinierende Instrumente für unschuldige Kinder, die sich Waffen und Mordinstrumente ersehnten. Nicht zu einem besonderen Zweck, sondern einfach nur, um das Böse umzubringen: die anderen Kinder. In der Vorstellung von Kindern sind immer die anderen die Bösen. Liebe Kinder kennen keine berauschendere Vision als den bösen mit Hobeln, Sägen, Hämmern und Stecheisen zwischen Kopf und Schultern zu fahren.
Papa aber war eifersüchtig auf seine Mordwerkzeuge bedacht. Er lachte nur über die natürlichen Instinkte seiner Söhne und meinte, wir sollten mit dem Umbringen warten, bis wir groß genug dazu seien.
Wir wurden ungehalten und mochten nicht glauben, daß Größe und Alter beim siegreichen Einsatz und Töten auf dem Schlachtfeld der Gerechtigkeit eine Rolle spielen sollten.
– Erst müßt ihr mal arbeiten lernen, sagte er und meinte besonders das Arbeiten mit Holz.
Dazu hatte ich keine Lust. Ich merkte schnell, daß ich mich dabei recht geschickt anstellte, und von Kindesbeinen an vermochte ich keinen Grund dafür sehen, das zu tun, was ich bereits konnte. Viel lieber versuchte ich mich an Dingen, die immer wieder neues Bemühen, Geschicklichkeit und Verstand erforderten und gerade das abverlangten, was einem nicht leichtfiel. Durch Arbeit sollte man sich aneignen, was einem abgeht, und sich nicht mit dem zufriedengeben, was man ohnehin und als Geschenk von Gott erhalten hat. Ich war immer der Meinung, nur Dummköpfe wollen das tun, was ihnen sowieso leichtfällt.
– Ihr sollt beide einmal Zimmerleute werden, sagte Vater, obwohl er uns beim Zimmern gerade nicht um sich haben mochte, sondern nur in der Mittagspause.
– Dürfen wir dann die Sägezähne anfassen? fragten wir hinterlistig und meinten so, Interesse an unserem zukünftigen Beruf zu bekunden.
– Aus euch werden einmal armselige Zimmerleute, wenn ihr euch gleich zu Beginn mit Hobeln und Sägen umbringt, meinte er auf seine logische Art und scheuchte uns weg.
Wenn er arbeitete, wollte mein Vater für sich allein sein. Ich bemerkte es schon früh: Wenn er mit anderen Zusammenarbeiten mußte, dann haute er dermaßen rein, daß er sich völlig vergaß und kaum mit seinen Kollegen Pause machte. Der tiefste Beweggrund dafür bestand nicht, wie man annehmen könnte, in einer angeborenen Tüchtigkeit, sondern darin, daß er auf diese Weise auch unter den anderen ganz für sich sein konnte. Die Arbeit allein stillte sein ganzes Bedürfnis nach Gesellschaft. Ich glaube, daß ich daraus meine eigene Einstellung bezogen habe, die größte Gemeinschaftsleistung eines Menschen sollte darin bestehen, die Kunst zu beherrschen, bei der Arbeit ohne Einsamkeitsgefühle oder den Wunsch, etwas kaputtzuschlagen, mit sich allein sein zu können. Mein Vater war ungemein stark; doch ich weiß nicht, ob Kraft und Stärke einen zum Einzelgänger machen oder ob umgekehrt der Wunsch, allein zu sein, Kraft und Stärke verleihen – allerdings nicht solche, die Seele und Gefühl brauchen. Körperlich starke Menschen sind in ihrem Innern erstaunlich weich und ungefestigt und selten von starker psychischer Kraft. Kraft und Muskeln sind die einzigen Freunde und seelischen Genossen des körperlich Starken. So ist es mit den meisten Kraftprotzen auf allen möglichen Gebieten.
Nur während Vater das Essen in sich hineinschlang und ein wachsames Auge auf alles hatte, durften wir das Werkzeug näher betrachten. So konnten wir kaum einmal eines auch nur berühren, ehe er es schon bemerkte und mit dem Suppenlöffel nach uns schlug. Auf diese Weise bekamen wir eingebleut, daß es seine Werkzeuge waren, und das schmierte er uns auch oft genug aufs Butterbrot:
– Faßt nicht mein Werkzeug an! Nehmt die Flossen weg! Ihr könnt damit nicht umgehen und ruiniert mir nur den Schliff, ihr Dussel! Ich sehe schon, daß aus euch nie richtige Zimmerleute werden.
Er änderte schnell seine Meinungen. Seine Wünsche wechselten dauernd das Gesicht und widersprachen sich. Wir wußten nicht, wie wir mit diesem wetterwendischen Aufbrausen umgehen sollten, und wurden steif und übervorsichtig, wagten kaum, uns zu rühren, damit Hobel, Sägen und Stecheisen nicht durch unsere Ungeschicklichkeit oder Zerstörungswut den Schliff verloren. Da legte er gehässig und gemein noch einmal nach:
– Wie könnt ihr euch nur einbilden, daß Burschen wie ihr in einem Dorf, in dem es nicht einmal Möchtegerntischler gibt, etwas von Werkzeug verstehen?
Wäre ich Psychologe, dann würde ich sagen, daß ich mit der Zeit eine Aversion gegen seinen Werkzeugkasten entwickelt hätte. Nachdem das Haus fertig war, lockte es mich nämlich nur noch äußerst selten, mich auf den Dachboden zu schleichen und den Deckel von der Kiste zu heben, um einen Blick auf die vielerlei scharfen und faszinierenden Instrumente zu werfen, die niemand anfassen durfte, wenn ihm sein Leben lieb war. Ein Kind verlangt es nämlich nicht so sehr, täglich einen von Respekt erfüllten Blick auf die Werkzeugkiste seines Vaters zu werfen, sondern es möchte viel lieber hineingreifen, um seinen Eltern Ungehorsam zu zeigen und auf der Stelle unter grauenvollen Umständen und mit schrecklichem Blutverlust als Opfer böser Mächte zu sterben, darauf zu Gott auffahren und sich die Welt von oben aus dem Himmel betrachten, an der Seite dieses höchsten und gütigen Vaters, bei dem es seine Eltern für ihre Verständnislosigkeit und die erlittenen Mißhandlungen im Erdenleben anklagen kann.
– Ja, das verstehe ich gut, mein liebes Kind, sagt Gott dann. Wenn ich dein Papa auf Erden wäre, hättest du den lieben langen Tag hobeln und sägen dürfen wie das Jesuskind in der Werkstatt Josefs, seines Scheinvaters. Glaubst du etwa, ich hätte kein Verständnis für dich? fügt er noch verständnisvoll hinzu.
Im stillen war ich Gott dankbar und begann ungefragt, an ihn zu glauben, an den Vater im Himmel. Und dieser Glaube hatte seine Vorteile; zu wissen, daß jemand besser war als Papa.
An Stelle der Werkzeugkiste machte ich mich daher über die Knopfdose von Mama her, die ihr natürlich nicht weniger gehörte als Papa sein Werkzeugkasten. Der Unterschied zwischen ihnen bestand darin, daß Mutter in ihrer Kindheit immer alles mit ihren Geschwistern teilen mußte, so daß sie früh die Kunst lernte, daß eine oder andere auch ohne alleiniges Eigentumsrecht zu besitzen. Am häufigsten hielt ich mich aber doch draußen unter freiem Himmel auf und beobachtete dort die Wunder des Körpers und der Natur oder meditierte und ging, was das Beste überhaupt war, in eine Art Nirwana ein, fern von den Dingen, der Welt und den Menschen. Vaters große Brechstange zog allerdings immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Sie war eigenartig geformt, wahnsinnig schwer, aus einem besonderen Material und trug einen seltsamen Namen: Kuhfuß. Es mußte sich also wohl um einen Knochen aus Eisen handeln, der aus einer mir unbekannten Kuh stammen mußte. Von daher faßte ich früh Interesse für das Schlachten, denn ich wollte doch zu gern sehen, wo dieser Kuhknochen saß.
– Es ist nur ein Name und kommt nicht wirklich aus einer Kuh, sagte Mutter.
Ich fand auch das Wort Kuhfuß als solches merkwürdig, und es weckte mein Staunen. Der Kuhfuß als Werkzeug verlor darüber keineswegs seinen Wert. Im Gegenteil wurde er noch geheimnisvoller und blieb in meiner Vorstellung präsent. So staune ich noch immer über einen Kuhfuß mehr als über die mir bewiesene Tatsache, die ich als Autor, der Bücher in vier verschiedenen Verlagen veröffentlicht hat, zuerst nicht glauben wollte, daß nämlich Frauen aufgrund ihrer Genauigkeit die besseren Korrekturleser sind. Trotzdem hat es mich nie verlangt, mit Körperkraft einen Kuhfuß zu schwingen, um als gestandener Mann zu gelten. Doch wenn ich einmal bei der Arbeit eins einsetzen muß, durchrieselt mich ein seltsames Gefühl: Ich empfinde eine geheimnisvolle Erleichterung in Körper und Geist. Während die meisten Jungen davon träumten, einen Kuhfuß zu besitzen, um ihn täglich, so wie ein Krückstock einen Hinweis auf das lahme Bein eines Alten liefert, als Beweis ihrer Kraft in einer Hand mit sich herumzutragen, fand ich es viel geheimnisvoller und spannender, an der Hauswand zu sitzen und zu fühlen, wie trockener Sand in meiner geschlossenen Faust kitzelnd zwischen den Fingern hindurchrann, und zwar kitzelte es um so mehr, je leerer die Faust und je schneller das Rinnsal wurden, das meine Hand im Gegenzug mit Leere zu füllen schien. Darin drücken sich ein Gleichgewicht und eine Komplementarität zwischen Stofflichem und Nichtstofflichem aus, zwischen dem, was sich anfassen läßt, und dem, was sich nur mit dem Denken und den Sinnen erfassen läßt. Es ist der Zusammenfall von Form und Inhalt. Ich konnte Stunden so zubringen, manchmal ganze Tage, und dabei das Wohlgefühl genießen, Materie und Nicht-Materielles zugleich in meiner Hand und im Leben zu spüren und vielleicht auch noch die Kunst, den Zusammenklang von Form und Inhalt im Dasein.
Die ständige Anwesenheit des Meeres schlug das Auge in Bann und weckte nicht weniger den Wunsch nach Selbstvergessenheit als der Sand. Diese stets veränderliche und farbige Weite, die irgendeine innere Entsprechung in mir hatte. In meiner Erinnerung meine ich gesehen zu haben, wie sich, wenn wir meinem Vater das Essen brachten, ein weißer Nebel über die weite See legte, der sich dann langsam auflöste. Und das war nicht der gewöhnliche graue Nebel oder die kochende Gischt des Frühjahrs, die das Meer auf dem Weg ständig über uns stäubte, wenn hohe Brecher in die Felsnischen am Ufer rollten, in die Spalten im Fels gesaugt wurden und an den schwarzen Wänden brachen. Die See brüllte dann laut und wütend und schoß in weißen Fontänen gegen den Himmel und über das Land. Dem folgte ein nasser Schleier, der mit bloßem Auge zu sehen war, sobald er wie ein Wolkenbruch auf die Steine niederprasselte.
– Geht nicht zu nah ans Meer, sagte Mutter.
Ich dachte oft, jener mystische Nebel sei nichts anderes als aufsteigender Meeresdunst gewesen, weil er sich auf meine Erinnerungen legte und mich nicht weiter bedrohte. Doch im Lauf der Zeit bin ich dazu übergegangen, diesen Dunst als etwas jenem Nebel Ähnliches zu betrachten, in dem sich der Verstand eines Menschen so gern einmal verliert, weil er hofft, er käme unbeschadet wieder daraus hervor, den Kopf voll mit einem anderen und kreativeren Dunst, dem Meditation innewohnt und in dem umherschweifende Wörter für ein Werk bereitliegen.
Aus irgendwelchen Gründen nahm meine Mutter immer den steinigen Weg am Ufer entlang, obwohl es von Höfn aus auch einen zwar ebenfalls steinigen, aber halbwegs befahrbaren gegeben hätte. Doch den haben wir nie benutzt. Er führte streckenweise durch gespenstisches Gelände, nicht direkt ein Lavafeld, aber doch eine Anhäufung von Geröll, das zu unregelmäßigen Haufen aufgeworfen lag, so daß sich mit der Phantasie, die Kindern zum Ausmalen des Schrecklichen zu Gebote steht, leicht alle möglichen Gespenster darin erkennen ließen. »Die Könige« nannten wir das Gebiet. Einmal wollte ich mich ganz allein dort umsehen, weil ich wissen wollte, was die Könige so trieben, doch meine Mutter verbot uns, dort herumzustromern. Statt den bequemeren Weg zu nehmen, turnten wir also an den Felsnasen über dem Meer entlang, das manchmal nicht zu sehen war, wenn wir uns gerade in einer Mulde befanden; doch sein Tosen war hinter den felsigen Graten stets deutlich zu hören. Mein Bruder war mutiger als ich und wollte auf den Grat stürmen. Ich folgte ihm, nicht ganz so verwegen, um ebenfalls das Meer mit Steinwürfen zu reizen; aber das durften wir nicht.
– Ärgert die See nicht, laßt sie in Frieden! sagte Mutter streng.
– Warum? fragten wir, schon mit einem Stein in der Hand ausholend, um ihn einem Brecher an den Kopf zu werfen, der gerade gegen das Ufer heranschäumte.
– Man darf sie niemals ärgern, ebensowenig wie die Kühe. Denn es kann sein, daß sie dann beide nicht mehr geben.
Jemanden zu hänseln oder zu ärgern – manchmal die einzige Abwechslung, wenn es sonst gar nichts zu tun gab war in den Augen meiner Mutter das reinste Gift. Dabei sah es doch ganz so aus, als freue der Mensch den Menschen nur auf eine Weise, nämlich durch gegenseitige Provokation. Ein Mann fordert den anderen heraus und macht ihn fertig, wenn der es zuläßt und nicht selbst schneller ist. Frauen dagegen beglücken einander mit Eigenlob, ihren Krankheiten, vorgetäuschter Liebenswürdigkeit und übler Nachrede, die sie anstelle eigener Meinungen und Urteile weitergeben und auch in schwierigen Fragen und in der Politik bevorzugen. All diese Eigenschaften waren und sind vor allem der gut verhohlene Drang mancher Männer und Frauen, auf andere loszugehen. Frauen jedoch fühlen sich im Recht und meinen, aus diesem Gefühl heraus besonders Männer und Kinder zurechtweisen zu dürfen, andere Frauen aber mit der heiligen Wahrheit, die im boshaften Klatsch liegt.
Mama entschied sich wie in anderen Dingen gegen das Einfache oder das, was andere taten. Also durften wir das Meer nicht ärgern, ihm nichts Böses andichten, mußten so tun, als wären wir auf unserem täglichen Marsch über den schlechteren Weg in Gefahr geraten, dabei froh den Hang unterhalb des Hafenhauses hinabhüpfend. Dort lag eine tiefe Senke mit flachem Grund, aber steilen und schwer zu erklimmenden Rändern. Hatten wir sie hinter uns, stolperten wir, auf schon ein wenig müden Beinen, den nächsten Abhang hinab. Trotzdem war es bis dahin noch ganz lustig. Dann aber kam nur noch Plackerei. Es war unendlich mühevoll, in die nächste Senke hinab und wieder heraus zu klettern, dann kam der schmale Saumpfad mit Blick aufs Meer, in das wir nicht einmal Steinchen werfen durften.
Es mag ja noch Spaß machen, in so eine Senke hineinzulaufen, aber ihr größter Nachteil ist, daß man auch wieder heraus muß, schließlich will niemand sein Leben lang in einer Senke festsitzen, und die Löcher rund um Höfn waren gräßlich. Dazu kam, daß wir bei jedem Wetter in unförmig steifen schwarzen Regenmänteln gehen mußten, die stets ein paar Nummern zu groß gekauft wurden, damit wir nicht zu schnell aus dieser teuren, aber notwendigen Schutzkleidung herauswuchsen. Wenn sich im Frühling einmal die Sonne sehen ließ und auch ganz sicher kein Wachstuchmantelwetter im Anzug war, wurde Firnis auf den Stoff aufgetragen, damit er wasserdicht blieb. Dann wurden die Mäntel zum Trocknen auf die Leine gehängt. Da baumelten sie am Kragen in blassem Sonnenschein und Sturm und schaukelten hierhin und dorthin oder zappelten heftig wie der Leib eines Gehenkten am Strick. Wenn wir sie wieder überzogen, knarrten sie laut oder quietschten, wenn sich das ölgetränkte Gewebe so am Fleisch festsog, als sollten wir es nie wieder abbekommen und darin sterben, erstickt wie Herkules, der so dumm gewesen war, das Nessusgewand überzuziehen. Die Sagen, von denen man hörte, gewannen an Bedeutung, wenn sie einen Bezug zum eigenen Leben erhielten. Der Regenmantel aber duftete, und es fühlte sich toll an und gab einem ein künstlerisches Gefühl, den Geruch des frisch gewachsten Mantels tief einzuatmen.
Stets mußte man den Mantel anhaben oder ihn wenigstens über dem Arm tragen. Mutter sagte:
– Es kann immer mal einen Schauer geben.
Oder es konnte jederzeit Südwestwind aufkommen und ernsthaft zu regnen anfangen. Wir gehorchten und wußten, daß man allemal leichter im Regenmantel ging als in vollgesogenen und durchgeweichten dicken Wollsachen. Meine gesamte Kindheit verbrachte ich in einer wächsernen Hülle.
Noch immer sehe ich meinen ersten schwarzen Mantel plitschnaß von Niesei oder Regen vor mir. Nicht weil mich auf dem Weg mit dem Essen ein Schauer überraschte, sondern weil es in meiner Erinnerung pausenlos regnete, bis der Zweite Weltkrieg ausbrach und auch armen Leuten etwas Sonnenschein in Form von barem Geld brachte sowie die Kenntnis einer besseren, wenn auch kriegerischen Welt jenseits unseres ruhigen, endlos weiten Meeres. Mit der Ankunft der Soldaten stellten sogar die Kinder fest, daß es erwachsene Menschen in der Welt gab, die nicht nur das eine Vergnügen kannten, Kinder zu ärgern, zu zwicken, an den Ohren zu ziehen, ihnen eine Kopfnuß oder eine Abreibung zu verpassen oder ihnen mit der Schuhspitze in den Hintern zu treten und zu fragen:
– Gefällt dir das und meinst du, ich könnte es deiner Mutter auch mal schnell besorgen?
Das Seltsame, das einen manchmal ganz durcheinanderbrachte, war der Widerspruch, daß die netten Ankömmlinge Soldaten waren, zu nichts anderem zu gebrauchen, als mit ihren Waffen andere Soldaten umzubringen. Im Ausland also freute der Mensch den Menschen in andauernden Kriegen; da war das gegenseitige isländische Hänseln doch besser. Das war die allgemein verbreitete Meinung über die Ankunft der Besatzungsarmee. In den Köpfen der Kinder aber stellte sich die Frage: Wenn schon Soldaten so freigebig Schokolade und Freundlichkeiten austeilten, wie mochten dann erst die übrigen Menschen sein, die nicht in der Armee dienten, sondern in ihren Heimatländern ein friedliches Leben führten und nichts weiter im Sinn hatten, als mit gut riechender Schuhcreme ihre Schuhe zu putzen, sich den Wohlgeruch glänzender Brillantine ins Haar zu reiben und dann aus ihren grünen Zelten zu treten, um in der Abendruhe eine ebenfalls duftende Zigarette zu rauchen?
Es war kaum vorstellbar, daß solche Menschen sich einen Spaß daraus machten, auf kleinere Kinder zu pinkeln, damit sie merkten, wie salzig, süßlich, bitter und warm ihr Urin nach Tüchtigkeit schmeckte.
Was früher eine unbestimmte Vermutung gewesen war, wurde zur Gewißheit: Jenseits des Meeres, das wir als kleine Kinder so gern ärgern wollten, lagen andere, zivilisiertere Welten, viel besser als die friedliche, in der wir lebten, auch wenn sich die Menschen dort im Krieg befanden. Die Konvois von Kriegsschiffen, die südlich von Nes am Horizont entlangfuhren, zeugten davon.
Ich stand oft mit Blick über die Brandung am Ufer und hielt nach dem Unbekannten Ausschau, ehe ich mit einem Stock in den Tangbüscheln danach zu stochern begann, ob nicht ein wertvolles Bruchstück jener verborgenen Welten an Land gespült worden war, und sei es nur eine Flasche mit einem seltenen Verschluß. Wenn man ihn öffnete, wäre vielleicht noch der Rest eines wunderbaren Dufts darin. Vielleicht fand sich sogar eine Glühbirne – obwohl wir nicht einmal wußten, was das überhaupt war – oder eine Dose mit schwarzer Schuhwichse, oder man hatte womöglich einmal das unverschämte Glück, daß ein Kriegsschiff explodiert war und Dinge aus seinem Wrack angespült wurden. Üblicherweise fanden wir nur den einen oder anderen Seehasen als eine Art Entschädigung des Gaumens für all das Entgangene.
In der Bucht unterhalb des Saumpfads fand diese Suche erst viel, viel später statt. Der Untergrund war noch immer, wie er vom Anbeginn der Wege an gewesen war, mit vereinzelten harten Grasbüscheln bewachsener sandiger Erdboden. Es war kein Ton zu hören, außer den Geräuschen der Natur, dem Brausen des Seewinds und dem Geschrei der Vögel. Maschinengeräusche hatten die Ruhe noch nicht gebrochen. Am Ende des letzten Abhangs tasteten wir uns vorsichtig um den Rand einer Felsnase und kamen in eine tiefe sandige Mulde voll mit wurmstichigem, von der See geschliffenem Treibholz, dicken Stämmen und dürren Ästen, die mit viel Phantasie nach fernen Ländern dufteten. Dieses weiße Holz war nicht über das Meer getrieben, um in unserem zukünftigen Herd verfeuert zu werden, sondern es gehörte dem Grundbesitzer, der auch das Strandrecht besaß. Etwas vorgelagert befanden sich Felsnischen mit steilen Wänden, in denen sich ohne Unterlaß mit heftigem Getöse die Wellen brachen und diejenigen mit schäumender Gischt übersprühten, die sich auf die Steine hinauswagten. Wenn wir allein waren, hatten wir unseren Spaß daran, diesen Schaum auf unsere wasserdichten Mäntel spritzen zu lassen, die so weit geschnitten waren, daß wir sie über die Köpfe ziehen und uns geschützt darunterkauern konnten, um trockenen Fußes zu hören, wie die See auf das Wachstuch einprasselte.
Doch wenn Mutter dabei war, durften wir keinen Quatsch machen, wie unsere Spiele immer genannt wurden. Sie konnte mit derartigem Unfug nichts anfangen, denn auf eine gewisse Weise war sie niemals Kind gewesen. Ihre Mutter hatte sie schon früh in die Verantwortung genommen und sie zu einer Art zweiter Mutter für ihre Geschwister gemacht, sobald sie sich irgendwie nützlich machen konnte. Kinder waren für ihre Eltern nichts weiter als überflüssige Esser, bis sie endlich zu etwas nutze wurden.
Rot vor Scham und Reue, weil sie eigene Ansichten über so unantastbare Menschen wie die eigenen Eltern hegte, sagte meine Mutter über ihre eigene:
– Mama war mehr für die Arbeit im Freien als im Haus. Sie war immer in Umständen und lud die Kleinen dann neben der übrigen Hausarbeit bei mir ab.
Ihre Worte waren nicht ohne Bitterkeit. Am Ende warf sie mit einem heftigen Kopfschütteln ihre Zöpfe, mußte schwer durchatmen und sich manchmal sogar hinsetzen. Quälender Zweifel schien in ihre Augen zu treten, und sie atmete tief durch, damit sie fortfahren konnte:
– Ich wußte eigentlich nie, was ich selber war. Ein Kind jedenfalls nicht.
Danach machte sie eine Pause, vielleicht um abzuwarten, ob Gott sie auf der Stelle mit einem Blitz erschlug oder ihr undankbares Herz anhielt, weil sie eine unfreundliche oder gar sündige Meinung über ihre Mutter geäußert hatte. Doch das tat er nicht, und um ihre Fortexistenz zu bekräftigen, fügte sie abschließend hinzu:
– Ich mußte immer nur arbeiten und wurde dafür auch noch geprügelt.
Dann ging sie in die Küche, und man selbst blieb mit den Schlägen seines Herzens zurück und lauschte, wie sie dumpf in der Brust klopften, und zugleich hörte man die Stille rund ums Haus.
Als sich Großmutter und Großvater scheiden ließen, scheint Oma lieber meine Mutter als die jüngeren Kinder mit sich genommen zu haben, damit sie auf ihre zukünftigen Halbgeschwister aufpassen und das Essen kochen konnte. Da war sie zehn Jahre alt. Nützlichkeit, Verwendbarkeit ging allem anderen vor, und das Miteinander der Menschen glich häufiger einem geschäftlichen Vorgang als zwischenmenschlichem Umgang. Auf diese Weise ist bei den meisten das Gefühlsleben verstümmelt worden; niemand lebt von der Nützlichkeit allein, am allerwenigsten im Seelischen, denn wirkliche Nützlichkeit – ebenso wie die, die etwas mit dem wirtschaftlichen Wohlstand eines Volkes zu tun hat – sollte eine Folge von Menschlichkeit und Rücksichtnahme sein. Mit diesen beiden Eigenschaften als Wegweisern läßt sich auf vernünftige Weise herausfinden, was jedem einzelnen liegt und seinem Leben dient. Nützlichkeitsdenken allein führt früher oder später zur Sklaverei, wie es ungebremster Utilitarismus zu allen Zeiten tut, wenn es auch vielleicht nicht genau die gleichen Formen annehmen wird wie zur Zeit meiner Eltern. Ebenso wird es zur gewalttätigen Herrschaft eines einzelnen oder einer Gruppe über andere führen, seien es Verwandte oder Unbekannte, Unternehmen oder politische Bewegungen. Nützlichkeitsdenken entspringt nämlich der elterlichen Gewalt, und es trägt ihre Züge, besonders die des Denkens der Mütter und dessen, was die Natur auf ihre Schultern geladen hat, indem sie sie die Kinder zur Welt bringen läßt – allein gemäß ihrer Natur, aber nicht durch ihre freie Entscheidung.
Mama hatte schon in ihrer Kindheit die Nase voll von Kindern und mehr als genug von ihrem endlosen Genöle, lange ehe sie selbst Kinder bekam und unvermeidlich Mutter wurde, jedenfalls körperlich. Doch wegen der Erziehung, die sie von ihrer Mutter erhalten hatte, und die von ihrer Mutter und die wiederum von ihrer und so fort ad infinitum, konnte sie zwischen echter Fürsorge und reinen Nützlichkeitserwägungen oft nicht unterscheiden und glaubte, der Umstand, daß ihre Mutter die große Tochter für zu etwas nutze hielt, sei ein Zeichen von Liebe und Zuneigung gewesen. Manchmal schienen ihre Gefühle und ihr Mund nicht gleicher Meinung zu sein, und so sagte sie:
– Meine Mutter hat mich vorgezogen. Alles hat sie auf mich abgewälzt.
Manchmal war es eigenartig, ihr Kind zu sein, ihre Bitterkeit zu hören und selbst Mitleid mit ihr zu fühlen, fast schon von dem Moment an, wo man selbst überhaupt erst ein Gefühl für Mitleid entwickelte. Nicht weniger empfand ich rätselhafte Schuldgefühle und hatte durch ihre Äußerungen über ihre Mutter den Verdacht, ich könnte ihr selbst ebenfalls ein Klotz am Bein sein; schließlich war sie noch eine junge Frau und hätte durchaus einiges von ihrer Jugend nachholen, das Leben genießen und Freude haben können, »wenn ich niemals geboren wäre«. So wurde die Geburt zu einer Art Sündenfall, ein allgemeines Verbrechen gegen die Frauen an sich, und vielleicht sind Zeugung und Geburt des Menschen in dieser Welt nichts anderes als eine böse Tat, ein übles Verbrechen der Natur gegen die Freiheit der Frau.
Meine Mutter war auf die Erfüllung ihrer Pflichten bedacht, die unter anderem darin bestanden, ihren Mann mit einer warmen Mahlzeit zu versorgen und nicht mit einer, die längst abgekühlt war, weil die Jungen vom Weg auf die Klippen hinausrannten, um eine Macht zu ärgern, die viel stärker war als sie. Wir stapften durch Sand und ausgewaschene Böschungen aufwärts, dann kamen oben steinige Flächen, in denen sich tiefe Löcher befinden sollten, obwohl es überhaupt keine gab außer in der Angst vor bodenlosen Klüften, von denen wir uns in der Phantasie ausmalten, wie sie sich plötzlich vor unseren Füßen öffneten, so daß uns die Erde mit Haut und Haar verschlang. In Wirklichkeit öffneten sich weder Löcher noch Klüfte, und wir mußten uns mit völliger Ereignislosigkeit abfinden, die wir höchstens mit ein bißchen Phantasie würzen konnten. Das tat ich ohne Unterlaß, nicht um der Spannung willen, sondern um eine geheimnisvolle Stimmung zu schaffen, bis wir uns atemlos unserem künftigen Haus und seinem Hausherrn näherten und ihn in einem Haufen von Sägespänen stehen sahen, an Händen und im Gesicht über und über mit Sägemehl gepudert.
Dann sagte er:
– Tja, da guckt ihr. Aber so sieht ein richtiger Vater aus.
Wir nickten zustimmend.
Und ich glaube, was er sagte, war vollkommen richtig. Denn kaum hatte er sich das Sägemehl abgebürstet, mit dem Henkelmann zwischen den Knien zum Essen niedergelassen und angefangen, mit der Gabel die Fischstücke herauszupicken, sah er kein bißchen mehr wie ein Vater aus, sondern lediglich wie ein gewöhnlicher hungriger Mann, der sich satt essen will wie alle anderen. Er war genauso geworden wie der Hausherr in Höfn, der am Küchentisch saß und ab und zu seine Jungen mit der Gabel piekste, wenn sie ihm die fettesten Bissen wegzufischen versuchten. Uns fiel es nicht im Traum ein, das zu probieren. Vater saß allein über seinem Essen aus dem Henkelmann, und wir sahen ihm beim Kauen zu.
– Warum bekommt ihr erwachsenen Männer immer das Beste? fragten wir neidisch.
– Weil wir verheiratet sind, antwortete Vater.
Als wir das Wort »verheiratet« hörten, schwiegen wir eingeschüchtert und betreten.
– Erst dann dürft ihr gierig die größten Brocken verschlingen, das zarte Brustfleisch und die Augen aus den Lammschädeln, wenn ihr verheiratet seid, eigene Boote auf Fang fahren laßt und Frau und Kinder habt. So ist es immer gewesen, sagte Vater und verteidigte sich und sein Essen im Henkelmann.
Wir waren der Ansicht, lange warten und viel auf uns nehmen zu müssen, um endlich solche Privilegien zu erwerben, und wir dachten, wenn das wahr wäre und ein bißchen Brustfleisch einen so hohen Preis wie eine Ehe kostete, dann wäre es vielleicht besser, darauf ebenso zu verzichten wie auf die Augen aus den Lammköpfen, und statt dessen nur Fisch zu essen, dafür aber frei und ungebunden zu bleiben.
Während Vater aß, erörterten wir noch weiter die berechtigten oder unberechtigten Ansprüche auf das Essen. Auch Mutter mischte sich in die Debatte. Sie setzte sich auf einen Stein und sagte:
– Als ich in Reykjavík bei so vornehmen Herrschaften wie denen vom CVJM in Stellung war, bekam ich nichts anderes als Reste zu essen. Und die Frau des Hauses sagte immer noch zu mir: »Möge es dir wohl bekommen, aber vergiß nicht, draußen in der Küche dein Tischgebet zu sprechen, und laß vom Fischschwanz noch etwas für die Katze übrig!«
Papa lachte über diese christliche Einstellung, und Mama fuhr fort:
– Das war eine vornehme Madam, die sogar an gewöhnlichen Werktagen in einer gefältelten weißen Schürze herumlief, außer wenn sie aus dem Haus ging. Dann machte sie im Herd ihr Lockeneisen heiß und brannte sich auf einer Seite Locken. »Meine Gute, wenn deine Anstellung bei uns endet, darfst du das Brenneisen mitnehmen«, sagte sie zu mir. »Derartige Locken sind keine Sünde gegen Gott wie diese Dauerwellen, die jetzt in Mode kommen.« Später schenkte sie mir den Lockenstab als Dreingabe zu meinem Lohn, von dem sie zum Ausgleich ein wenig einbehielt.
Mama hatte immer etwas vom Fisch für die Katze übriggelassen, und auch das Rückgrat hob sie auf. Eine der Töchter spielte damit gern ein Spiel. Sie mußte es kurz in die Höhe halten, und dann wollte sie raten, wie viele Wirbel es hatte.
– Sie war ganz schön pfiffig, sagte Mutter.
– Wollte sie nicht lieber den Schwanz? fragte Papa.
– Ich hatte Glück mit meiner Stellung, sagte Mutter und tat so, als hätte sie die Anspielung nicht verstanden. Wenn man bei Krämern in Stellung war, die nichts Kostbareres verhökerten als zum Beispiel Schnürsenkel, bekam man nie ein schlechteres Zimmer als eines im Keller oder neben der Waschküche. Meine Schwester aber, die stets nur bei feinen Leuten arbeitete wie den Thors oder dem Kinobesitzer Björn oder Snæbjörn mit der englischen Buchhandlung, weil sie sich dabei selber fein vorkam, mußte stets in einer fensterlosen Kammer hinter dem Trockenboden schlafen. Jeden Abend bückte sie sich unter der Unterwäsche durch, die sie selbst am Tage gewaschen hatte, und kroch mit nassem Bukkel ins Bett.
– Das geschah ihr recht, dieser Arschkriecherin, sagte Vater.
– Das war sie gar nicht, gab Mutter zurück. Sie wollte immer nur gern vornehmes Benehmen lernen.
– Indem sie jede Nacht den Rücken von dem naß hatte, was den Thors oder dem Kinobesitzer aus der Unterhose tropfte? fragte Vater.
– Auf mich tropfte jedenfalls nie anderes als Gottes Wort, sprach Mutter unbeirrt weiter. Die beiden Eheleute stammten aus den angesehensten Pfarrersfamilien des Landes und unterhielten sich ständig über Pastoren und irgendwelche Ausritte. Dagegen habe ich bei meiner Schwester nie etwas Vornehmes entdecken können. Wir sind einfach so verschieden.
So setzten schon damals die endlosen Debatten zu Hause ein, die unterschiedlichen Ansichten, Geschmäcker und Eigenschaften, die miteinander in Widerstreit gerieten, die verschiedenartigen Erfahrungen, die nach Geltung und Anerkennung verlangten, Auseinandersetzungen über grundlegende Einstellungen und Überzeugungen, Streitereien – alles längst, bevor das Haus fertig wurde.
In jenem Jahr kam der Frühling im Nieselregen langsam, aber so sicher, wie das Haus unter Vaters Händen wuchs. Er hatte das Fundament gegossen und damit begonnen, das Fachwerk aufzurichten. Es sollte ein mit Wellblech verkleidetes Holzhaus werden. Bei Sonnenschein blinkten die Stapel der grauen Bleche, und lange bevor wir die Baustelle erreichten, rochen wir schon den intensiven, süßlichen Duft ungehobelter Balken und Bohlen.
Der Geruch von galvanisiertem Wellblech und der Duft frischer Hobelspäne von den Paneelbrettern sowie der schwache Geruch von Sägemehl überdeckten den Erdgeruch auf den offenen Schotterflächen, den starken Humusduft, den Gestank von Tang unten vom Ufer und den bitteren Geruch des hellbraunen Gerölls, obwohl der sich nicht überdecken ließ, sondern nach einem Frühlingsregen intensiv in der Luft hing. Die Zugvögel, die in meiner Erinnerung stets wie fremde, bunte Blumen waren, zogen in kleinen Schwärmen einer nach dem anderen mit Pfeifen, Trillern und Gesang über ein armes Land mit noch ärmerer Bevölkerung und ließen sich je nach genetischer Programmierung im Gelände nieder, tippelten auf hohen Stelzen einher oder flüchteten vor uns. Manche ähnelten gebückten alten Menschen oder wirkten einfach nur müde und abgekämpft von dem langen Flug. Mir ging einiges durch den Kopf, während ich ihnen zusah:
Weshalb kommen diese hübschen, bunten Vögel hierher?
Aus keinem besonderen Grund. Es ist ihre Natur. Alles, was schön ist, ist es nicht aus einem Grund, sondern weil die Schönheit zu seiner Natur gehört.
Singen denn nur Zugvögel so schön?
Ja. Niemand kann schön singen, der nicht weit in der Welt herumgekommen ist. Die Vögel, die das ganze Jahr hier auf den Geröllflächen bei uns ausharren, können lediglich krächzen oder kreischen.
Manche piepen.
Oder kreischen, piepen, krächzen nacheinander.
Weshalb kommen die Zugvögel überhaupt?
Es sieht so aus, als kämen sie nur, um im Sommer hier zu brüten und zu beweisen, daß sie Grips genug im Kopf haben, sich früh genug im Herbst wieder davonzumachen und dem Winter aus dem Weg zu gehen.
Können sie nicht woanders brüten?
Nein.
Warum nicht?
Die Sorge treibt manche Vögel in die Ferne. Ich wäre auch in die Ferne geflogen, um euch Nahrung zu beschaffen, wenn ich Flügel hätte. – Diese Art innerer Dialog zwischen meinen verschiedenen erwachenden Charaktereigenschaften spielte sich in mir ab, nachdem ich wieder und wieder im Schlepptau meiner Mutter über Geröll- und Sandfelder und ausgewaschene Böschungen den langen Weg zu unserer künftigen Behausung zurückgelegt hatte.
Wir jagten den Vögeln nach, um sie zu fangen. Sie liefen vor uns davon, blieben stehen, piepten und sahen sich rasch über einen Flügel um, ob wir ihnen auch folgten. Darauf ließen sie eine Schwinge hängen, schleppten sie über den Boden und taten so, als wären sie verletzt. Dann wußten wir, daß sie ein Nest gebaut hatten, und verfolgten sie nicht länger. Sie aber trippelten weiter über Geröll und Halden.
Uns wurde erzählt, Zugvögel seien ganz besonders lebenserfahrene Tiere, die die räuberische Natur des Menschen kannten und verschiedene Methoden anwandten, uns in die Irre und von den Nestern mit den Eiern und später Jungen wegzulocken. Die Eier hatten die gleiche Färbung wie der Erdboden. Nur selten konnten wir eins finden, auch wenn es nur so von Vögeln wimmelte.
Unser künftiger Nachbar kam zuweilen von seinem ebenfalls neu erbauten Haus zu uns herüber und beobachtete schweigend, wie schnell wir vorankamen; dann sagte er bedächtig:
– Manche verstehen ihr Handwerk. Hier wird kein Pfusch getrieben.
Sein Haus hatte Vater im Frühjahr und Sommer zuvor gebaut, während wir uns in der engen Schule einrichteten. Mein Bruder und ich hatten manchmal auf der Treppe des Nachbarn sitzen dürfen, um zu lernen, was es heißt, Höhenangst und Schwindel zu empfinden. Ich war der Jüngere und in größerer Gefahr, herunterzufallen. Der Nachbar hielt mich oben auf dem gegossenen Handlauf. Dann nahm er mich in den Arm und sagte:
– Mein Junge.
Er sagte kaum einmal etwas anderes. Seine Frau sprach noch weniger. Ihm wuchs beträchtlich viel Moos aus den Ohren und den Nasenlöchern, und er hatte die Angewohnheit, nicht tief gebückt, aber doch so vorgebeugt zu gehen, als würde er andauernd etwas suchen, zwergwüchsige Lämmer zum Beispiel. Aber er fand nie welche. Auf dem Kopf trug er, etwas schief gesetzt, stets die gleiche Schirmmütze, die er nie abnahm, außer bei Beerdigungen. Dann sah man, daß seine Stirn oberhalb eines roten Randes schneeweiß war und der Schädel flach nach hinten abfiel.
War die Mütze so schwer?
Papa sprach sehr laut mit ihm, damit die Worte durch den Hammerlärm und das Moos in den Ohren drangen. Ansonsten sah er selten von der Arbeit auf, und man konnte meinen, selbst wir, die wir ihm das Essen brachten, wären unwillkommene Besucher. Zweifellos waren wir in seinen Augen ebensolche Taugenichtse wie alle anderen, kaum in der Lage, ihm auch nur ein Brett anzureichen.
– Ach, ich weiß selbst besser, wo es liegt, und hol’s mir lieber selber, sagte er, wenn wir uns Mühe gaben, das richtige Stück Holz zu finden und es ihm anzureichen, damit er schneller vorankam.
Wenn wir mit unserem Bemühen fortfuhren, schob er uns schweigend zur Seite, sachte, aber bestimmt und mit der Handkante voran, so daß wir begriffen: »Kommt mir nicht zu nahe, faßt nichts an! Das ist meine Arbeit.«
Er brauchte keine Handlanger, konnte alles allein bewältigen. Außer ihm sollte es am Ende niemanden geben, dem etwas zu danken war oder der sagen konnte: »Na ja, ich habe ja auch meinen Teil dazu beigetragen.« In allem, was er tat, achtete er peinlich genau auf sein alleiniges Urheberrecht. Solange er mit etwas beschäftigt war, ging seine Arbeit außer ihn niemanden etwas an; andererseits interessierte ihn das fertige Ergebnis kaum mehr, sobald es in die Hände derer übergeben war, in deren Auftrag er die ganze Zeit gearbeitet hatte. Was die Leute dann davon hielten, war ihm egal. Er hatte sein Bestes getan.
Etwa Ähnliches findet sich leicht bei Künstlern. Auch sie sondern sich ab, beschäftigen sich nur mit ihren eigenen Werken und wissen, daß kein anderer sie für sie vollbringen kann. So stehen und fallen sie allein mit ihren eigenen Fähigkeiten und Werken, und so sind Künstler stets allein, doch nie einsam. Sie brauchen keine Hilfe oder sind nicht auf die gleiche Weise auf Unterstützung angewiesen wie andere soziale Wesen.
Meine Mutter hielt sich gewöhnlich mit dem Essen abseits und wartete. Sicher stand sie irgendwo im Windschatten und fürchtete, der Fisch könne kalt werden oder das Fett stocken, bevor es dem Herrn Gemahl beliebte, langsam und sorgsam das Werkzeug aus der Hand zu legen, sich die Hände abzuwischen und sich mit dem Besteck, das in einer alten Farbdose aufbewahrt wurde, ans Essen zu machen. Es war ihm in der Kindheit beigebracht worden, auch wenn einmal kaum Messer und Löffel vorhanden wären und gleich, wo er sich gerade befände, müsse er doch jederzeit so sauber zu Tisch gehen und mit derart tadellosen Manieren essen und kauen, als säße er an der Tafel des Königs in dessen Schloß und man servierte ihm einen zarten Jungvogel auf einem goldenen Teller.
Auch wenn sie es sich nicht immer verkneifen konnte, bewirkte es nicht das geringste, wenn Mutter einmal sagte:
– Willst du denn nicht essen, bevor alles kalt wird und das Fett stockt?
Das brachte überhaupt nichts. Er ging stur nach seinem eigenen Kopf. Was den Umgang mit anderen betraf, war sie auf ihre Art ebenso eigenbrötlerisch wie er. Aufgewachsen in der Einsamkeit des Hochlands, war sie sich selbst genug. Daher haben wir, ihre Kinder, alle unser Erbteil mitbekommen, was das Bedürfnis nach Alleinsein angeht. Einmal war es eine der markantesten Eigenschaften von Menschen, die an der Küste oder auf dem Lande, aber nicht in größeren Siedlungen aufwuchsen, die es in diesem bevölkerungsarmen Land ohnehin kaum gab. Es entging niemandem und war leicht zu sehen, daß dies Menschen waren, von denen jeder für sich stand, in keinem anderen Schutz als dem, der sich bei ein paar Felsen finden läßt.
– Die beste Gesellschaft finde ich in meiner Arbeit, sagte mein Vater manchmal.
Meine Mutter ließ kaum eine Gelegenheit auf Geburtstagen und anderen Festen aus, etwas Unpassendes vom Stapel zu lassen. Wenn die Stimmung am höchsten schlug und jedes Klatschweib von anderen zu erzählen wußte, die gleichermaßen den Halt im Leben verloren und Dutzende von Fehlgeburten erlitten hatten, und wenn die Männer lauthals Seemannsgarn von riesigen Fangerträgen und endlosen Nachtwachen an Bord zum besten gaben, konnte sie plötzlich wie aus heiterem Himmel sagen:
– Meine Welt ist mein Zuhause.
Den Leuten blieb das Wort im Hals stecken und sie verstummten mitten in der Erzählung ihrer Heldentaten. Glücklicherweise hatte sie ihr Geschenk schon überreicht und konnte sich ohne weitere Peinlichkeiten verabschieden und gehen. Wir dagegen saßen noch betreten da und bekamen mit, daß sich die anderen Gäste der Feier offenbar fühlten, als hätten sie von der einzig wahren Hausfrau eine Ohrfeige bekommen. Alle Frauen sahen aus, als hätten sie einen Spontanabort erlitten, und die Männer gafften und verstanden nicht, wie jemand so ungesellig sein konnte. Die fröhlicheren unter den Frauen faßten die Bemerkung als an ihre Adresse gerichteten Affront auf.
– Hat dieses Mensch denn gar kein Interesse an Fehlgeburten oder an der Fischerei? hieß es hier und da.
Doch bald liefen die Leute wieder zu alter Form auf, die Zahl der Fehlgeburten ging nicht zurück, ebensowenig die Erträge der Fischerei, bis endlich alle müde wurden und die Redseligkeit allmählich in Gähnen und Rülpsen unterging.
Ähnlich wie es Künstlern in ihrem Umgang mit anderen Menschen oder der Öffentlichkeit widerfährt, öffnete sich ein unsichtbarer Spalt zwischen unserem Vater und uns. Er ließ uns nur zu sich hinüber, wenn es ihm selbst paßte oder wenn er gerade bester Laune war. Meist folgten danach umgehend Verwürfe wegen unserer Untauglichkeit oder Faulheit, wir würden nichts für ihn tun, nie die Arbeiten erledigen, die er uns auftrug. Am häufigsten bekamen wir das im Herbst zu hören, wenn er von einer auswärtigen Saisonarbeit heimkehrte und sich die Ergebnisse unseres Gehorsams besah, den wir in seiner Abwesenheit hätten aufbringen sollen. Gehorsam zu sein, ohne daß die Autoritätsperson selbst anwesend sein mußte, sich also selbst Chef und Untergebener zu sein, galt als die höchste Tugend.
Sommer für Sommer bestand unsere Aufgabe darin, Steine aus dem umgegrabenen Land zu lesen und ihnen sorgfältig die Erde abzureiben als Mutterboden für das Kartoffelbeet, auf das im nächsten Frühjahr Braunalgen aufgebracht wurden.
In den ersten Tagen nach Vaters Abreise latschten wir unserer Faulheit zum Trotz aufs Feld und begannen pflichtschuldig, doch ohne große Begeisterung, Steine zu roden.
Der Regen klatschte auf Steine und Geröll, von dem der ihm eigentümliche Geruch aufstieg. Wir versuchten, so viele Steine wie möglich auszugraben, merkten aber bald, daß unter jedem Stein weitere steckten; nicht einer oder zwei, sondern doppelt so viele, wie wir ausgegraben hatten, immer mehr und immer größere Steine, ohne Ende. Das Erdreich nahm beständig ab, je tiefer wir gruben, die Erde war voller häßlicher Steine.
– Was ist das für ein Mist? fragte mein Bruder und hörte auf.
Ich machte weiter, denn ich war mein eigener Herr, ob es nun wenige oder viele Steine gab und ob mein Vater nun hinter mir stand oder weit weg war.
Am Ende glaubten wir, es sei besser, die Saatkartoffeln einfach gleich zwischen die zerbröselten Steine zu legen, als weiterhin nach Mutterboden in der Erde zu buddeln. Als wir zu diesem Resultat gekommen waren, erreichte die Faulheit beim Roden ihren Höhepunkt, und wir stellten es nach und nach ein, sonst hätten wir uns ohne Zweifel durch die Erde gegraben und am Ende unserer Tage die Fußsohlen der Chinesen gesehen, ohne mehr Erdreich als für die paar Kartoffelpflanzen zu finden, deren Ertrag kaum zur Hälfte den Blecheimer füllte, den Mutter für alles benutzte. Sie wässerte darin den Salzfisch, nahm Schwimmblasen aus, füllte Wischwasser zum Putzen hinein, sammelte darin Kartoffeln und verbrauchtes Spülwasser und weichte unsere Strümpfe darin ein.
– Ihr schafft auch überhaupt nichts und werdet einmal die größten Taugenichtse, sagte Vater, wenn er von seinen Gelegenheitsarbeiten zurückkam und zum Feld hinaufging, um zu inspizieren, was wir geleistet hatten und ob wir auch unsere Jahresmenge an Steinen ausgegraben hatten, die um den heiligen Gemüsegarten zu einer Mauer aufgeschichtet werden sollten, und um das Kartoffelbeet, für das ich mich nicht im geringsten interessieren konnte, ehe am Kartoffelkraut die blauen oder blaßrosa Blüten aufgingen.
Mein Vater versuchte nicht etwa, uns durch seine körperliche oder geistige Anwesenheit zur Nachahmung anzuregen. Stets verrichtete er irgendwo anders Knochenarbeit. Was er eigentlich zu seinem Lebenswerk hätte machen wollen, verrichtete er in seiner Freizeit oder zwischen zwei Aufträgen. Das Zimmern war seine Privatangelegenheit. Man durfte ihn daher auch höchstens einen winzigen Zipfel von dem Bereich des Gefühlslebens sehen lassen, der eigentlich keineswegs nur einem selbst Vorbehalten, sondern auch als Geschenk für andere gedacht ist. Dieser Bereich besteht besonders aus dem Wunsch, mit anderen Freude und Leid und Verständnis zu teilen und Leben und Arbeit in Gemeinschaft zu verbringen, und er ist so etwas wie die Suche nach Anleitung und Führung durch die Eltern, einer der dringlichsten Wünsche von Kindern. Kinder dürsten geradezu nach ihren Eltern, doch wenn die Menschen in der Ehe einmal so weit sind, Kinder zu bekommen, dann dürsten sie oft längst nach anderem.
Gewöhnlich bekommt man in der Kindheit weder geistig noch körperlich genügend Zuwendung von seinen nächsten Anverwandten, sondern eher ein Gefühl der Leere, gemischt mit Langeweile und einem geheimnisvollen Sehnen, Verlangen und unlöschbarem Durst, den das Kind irgendwann später im Leben mit übermäßigem Trinken stillen oder vertreiben will. Jedenfalls hierzulande. Wenn die Menschen anfangen, Kinder zu bekommen und Eltern zu werden, sind sie entweder selbst noch zu sehr Kind, um Gefühle für ihren Nachwuchs zu hegen, oder zu erwachsen und lebenserfahren, um noch den Begleiter und manchmal auch Gleichgesinnten ihrer Kinder zu spielen. Die Eltern sitzen in irgendwelchen Teufelskreisen des Lebens fest, und die Kinder sind anfangs wonnig und noch ganz gut zu handhabende Spielzeuge; doch die Erwachsenen verlieren den Spaß an diesen Spielzeugen, wenn sie älter werden und selbst bestimmen möchten. Später wollen die Spielzeuge dann irgendwann unweigerlich sogar frech die Spielzeugfabrikation leiten. Der Lebenswille tauscht die Rollen aus. Die Spielzeuge versuchen ihre Eltern in Apparate zu verwandeln, die nur noch dazu da sind, ihnen alles in die Hände zu spielen. Und dann ist da auch noch dies, ebenfalls ein Gesetz: Die Kinder haben ihre Eltern vom Tag der Geburt an wahrgenommen und beobachtet. Die Eltern aber waren schon reif und erwachsen, als sie die Kinder bekamen, und das Erwachsensein macht sie selbstbezogen und lenkt sie von den Kindern ab, sie haben den Kopf voll eigener Probleme.
Zunehmendes Alter bringt es mit sich, daß sich Eltern immer weniger in ihre Kinder hineinversetzen können.
– Sie sind aus den Kinderschuhen herausgewachsen, und ihr Gefühlsleben ist verholzt, sagte meine Mutter dazu.
Wenn es hoch kommt, sind Eltern sauer eingelegte Reste der Kinder ihrer Eltern, aber nicht die Eltern ihrer Kinder, und sie haben mehr von ihren Eltern in den Köpfen als sie für ihre Kinder im Gefühl haben.
Die Natur und das Wesen des Menschen haben ihn so geprägt, daher ist der Abstand zwischen Eltern und Kindern fast unüberbrückbar, außer im Wunschdenken.
Mein Vater war durch seine ferne Nähe und Fremdheit interessant, so daß man sich mit ihm eher wie mit einem Wunschbild verbunden fühlte, als daß er sich auf unsere Denkweise eingelassen hätte, die auch komisch oder, gelinde gesagt, zu dumm und unreif für ihn war. Unsereins hingegen zerbrach sich ständig den Kopf und fragte sich, was er eigentlich für ein Mensch sei; und so weckte er früh die gesunde Frage, die für die geistige Reife und Selbständigkeit von Kindern im späteren Leben so wichtig ist:
Wer ist mein Vater eigentlich?
Wer ist meine Mutter?
Wenn ich meinen eigenen Weg finden will, muß ich etwas über sie wissen, unbeeindruckt von den verklärenden Legenden, die sich um die Eltern rankten.
– Normalerweise fragen sich Kinder so etwas nicht, sagte meine Mutter. Viele Eltern wecken eben nicht einmal Fragen bei ihren Kindern.
Das kommt entweder daher, daß es den Kindern an Phantasie oder Gefühlswärme mangelt, oder die Eltern waren das, was man unbedeutend nennt, und weckten keinerlei geistige Unruhe. Derartige Kinder verschwenden keinen Gedanken darauf, was für Menschen ihre Eltern sein könnten. Manchmal liegt das daran, daß die Eltern gewisse Bedürfnisse bei ihnen weckten, die sie später nach eigenen Vorstellungen stillten, um sie auf dem weiteren Lebensweg loszuwerden, anstatt das wachsende Problem in ihren Köpfen zu verankern, dem Kinder so schwer ins Auge sehen können.
Man könnte meinen, Eltern seien das heikelste Problem für ihre Kinder, bis diese ihnen, selbst erwachsen, im stillen mit dem scheinheiligen und gehässigen Satz für ihr Sterben danken:
Ich glaube, Vater wäre froh, daß er endlich Ruhe gefunden hat.
Im fortgeschrittenen Alter dann erwacht bei nachlassendem Verstand und mit zunehmender Aufdringlichkeit die zähe Frage:
Wer waren meine Eltern?
Doch dann ist alles zu spät. Die Kinder kommen zu keinem Ergebnis, und das Schuldgefühl brennt. Die mutigen, klugen, geistig selbständigen Kinder aber fragen sich das fast von dem Moment an, in dem sie zu Verstand und einiger Reife gekommen sind, und später fügen sie noch hinzu:
Wer bin ich, besonders wenn ich mich als Abkömmling meiner Eltern betrachte?
Männer haben größeren Respekt davor, über ihre Mutter nachzudenken als über ihren Vater, und sie verweigern jegliches Kopfzerbrechen, das von unangenehmen Dingen im Umgang mit ihr ausgelöst werden könnte. Sie wagen es nicht, sich der Frage zu nähern:
Wer ist meine Mutter?
Man könnte meinen, die Mutter sei eine Kriminelle oder etwas, über das man sich in herabsetzenden Worten äußern dürfe.
Die meisten scheuen sie wie ein gebranntes Kind das Feuer. Sie fertigen sie rasch ab und versuchen zu behaupten, daß sie immer nur lieb, nett und gut gewesen sei.
Die Vorstellungen der Söhne über ihre Mütter sind, wenn kein Vexierbild, so doch vage und gefühlsduselige Zerrbilder. Vielleicht haben sie es verdient. Die Mutter fordert in ihrem Umgang mit dem Kind fast von Anfang an, daß es in seinem Denken die Unstimmigkeit zwischen zwei verschiedenen Dingen, die es erspürt und erfährt, zusammenbringt, zum einen nämlich die Mutter als ganz gewöhnliches Wesen zu erleben, zum anderen die an es gestellte Erwartung, von ihr als etwas ganz Einzigartigem zu denken und zu reden. Daraus resultiert die Angst des Kindes vor der Mutter ebenso wie die Angst der Mutter vor dem Kind. Das Kind fürchtet, es benehme sich dem Widerspruch entsprechend nicht gut genug, und die Mutter glaubt, sie habe ihm das Vexierbild von sich nicht tief genug eingeprägt.
Die Mutter ist die wahre Wurzel der Angst.
Als ich das meinem Vater darlegte, guckte er wie ein Schaf und sagte:
– Ich verstehe dich nicht. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wäre ihr liebstes Kind gewesen.
Alle haben irgendwie Angst vor ihrer Mutter. Sie leiden an dem Schuldgefühl, ihr mit der Geburt die Freiheit geraubt zu haben, begreifen aber andererseits nicht, warum es ihr ein permanentes Anliegen ist, das Kind wieder loszuwerden. Die Mutter will ein uneingeschränktes Verfügungsrecht über ihren Körper, darüber, ob sie ein Kind bekommt oder nicht; hat sie aber erst einmal eines zur Welt gebracht, geht es darum, wie sie es, außer vielleicht am Abend, möglichst anderen aufhalst.
Mütter leiden ebenfalls an Schuldgefühlen, weil sie meist froh waren, als sie das Kind endlich aus dem Mutterleib heraus hatten. Es sieht ganz so aus, als würde ihr Gewissen ihnen einflüstern, eine echte Mutter müsse ihr Kind ewig mit sich herumtragen, ohne es einmal in diese schlechte Welt zu setzen. Nach christlicher Auffassung scheint die Mutter ihren Leib als eine eigene Welt für sich anzusehen, in der sie den eingeborenen Sohn ein Leben lang mit sich herumtragen müsse oder zumindest so lange, bis er aufgrund gewisser Naturgesetze tot zur Welt kommt. Auf diese Weise erwürben sie vereint ein ewiges Leben bei Gott, dem einen, wahren Vater, der ihr großes Vorbild, die Jungfrau Maria, mit einem saftlosen und geschlechtslosen Engel befruchtete, seinem Einfall, den er zu dem Zweck vom Himmel gesandt hatte, um ihn über den Mann zu erheben, den sie von da an im Vergleich mit dem höchsten Vater im Himmel allenfalls noch als eine Art Scheinvater ansieht.